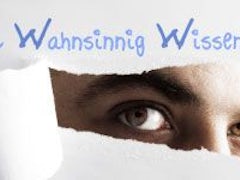Wie schlecht es um seinen Ruf im Internet bestellt ist, das merkt der Unternehmer Hans Klamnt, als er seinen Namen in die Suchzeile bei Google tippt. Nach Sekundenbruchteilen sieht er die Trefferliste mit den ersten zehn Einträgen. Und was er sieht, beunruhigt ihn, denn der 50-Jährige und seine Firma werden mit "Betrug", "Pleite" und "dubiosen Geschäften" in Verbindung gebracht.

Hans Klamnt, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, weiß, dass die Vorwürfe falsch sind, doch wissen es auch die anderen? Alle Welt googelt Geschäftspartner, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Es ist eine Art Sicherheitscheck, wie das Scannen am Flughafen. Und viele Menschen glauben, was sie am Bildschirm lesen. Warum sollte Google Verleumdungen prominent auflisten?
Die Reputation von Klamnt ist in ernster Gefahr, denn die digitale Visitenkarte entfaltet enorme Wirkung. Die amerikanische Suchmaschine hat sich zur ersten Anlaufstelle für Internetnutzer entwickelt. Neidische Konkurrenz, enttäuschte Partner und auch Erpresser nutzen das immer häufiger aus. "Das Vordringen von Google und Facebook senkt sicher die Schwelle zum Cyberstalking", sagt Hendrik Speck, Professor für Digitale Medien an der Fachhochschule in Kaiserslautern.
Eine solche Situation ist ungemütlich, natürlich will sich der Betroffene wehren. Doch wer ist der Verleumder? Man mag einen Verdacht hegen, doch die meisten Schmähungen auf Internetseiten tragen keine Absender; das vorgeschriebene Impressum fehlt.
"Gegen den Urheber der Verleumdungen vorzugehen ist nahezu unmöglich, wenn der Internetserver irgendwo auf den Antillen steht, da brauchen sie Rechtshilfe und einen Privatdetektiv, und das dauert ewig", sagt der Hamburger Rechtsanwalt Gerald Neben.
Verleumder auf den Antillen
Selbst wenn der Betroffene mit viel Zeit- und Geldaufwand juristisch Erfolg hat und die Seite vom Netz gehen muss - binnen weniger Minuten ist eine andere Internetseite mit denselben Schmähungen installiert. Dafür muss der Verleumder nicht einmal auf die Antillen fahren. Das Machtverhältnis zwischen Opfer und Täter ist sehr asymmetrisch.
Also richtet sich der Ärger auf denjenigen, der die Schmähungen im Internet findet und darstellt: Google. Die Suchmaschine solle die diffamierenden Äußerungen aus ihrem Index nehmen, fordern Betroffene.
Auch Hans Klamnt hat bei dem US-Konzern einen entsprechenden Antrag gestellt. Doch Google beruft sich auf das Recht der freien Meinungsäußerung und verweist darauf, man müsse als technischer Anbieter neutral bleiben.
"Webseiten mit Tatsachenbehauptungen nehmen wir nicht einfach aus unserem Index. Wir wissen ja nicht, ob die behaupteten Tatsachen wahr oder falsch sind", sagt Arnd Haller, Leiter der Rechtsabteilung Nord- und Zentraleuropa bei Google.

Was tun bei unwillkommenen Facebook-Kontakten? Welche Informationen gebe ich der Öffentlichkeit preis? Darf ich mein Date googeln? Zehn Tipps für das richtige Verhalten im Netz.
Dem widerspricht Rechtsanwalt Neben: "Wenn die Suchmaschine nicht löscht, dann hält sie die in Frage stehende Aussage für rechtmäßig und steht damit automatisch in der Haftung." Man könne nicht mit Drittäußerungen Geld verdienen und dann die Sorgfaltspflicht ignorieren, so der Fachanwalt.
Doch Google hat Leitlinien: Problemlos verlaufe die Löschung von Inhalten, wenn der Betroffene die einstweilige Verfügung eines Gerichts vorlege. "Sonst löschen wir nicht, es sei denn, es liegt ein klarer und schwerwiegender Rechtsverstoß vor, wie beispielsweise in Fällen der Kinderpornographie", sagt Haller.
Die Betroffenen sind damit unzufrieden, denn es ist schwer, eine einstweilige Verfügung zu bekommen. "Wenn Sie den Verleumder nicht greifen können, weil der Server im Ausland steht, dann wird sich kein Gericht in Deutschland der Sache annehmen", sagt der Kölner Rechtsanwalt Frank Feser.
Ein weiteres Problem: Google-Rankings können manipuliert werden. "Für einen Fachmann ist es relativ einfach, negative Bewertungen oder Verleumdungen von Firmen oder Privatpersonen nach oben auf die Google-Trefferliste zu katapultieren", sagt Internetexperte Speck.
Natürlich könne dadurch kein internationaler Großkonzern nachhaltig verunglimpft werden, kleinere Firmen und Privatleute hingegen schon. "Die negativen Beurteilungen und Kommentare müssen dazu auf möglichst vielen Internetseiten verlinkt werden", sagt Speck. Das lasse sich in Blogs, aber auch indirekt in Twitter und Facebook völlig automatisieren.
"Wenn diese Verleumdungen dann noch in Wikipedia integriert und von automatisierten Nachrichtenseiten aufgenommen werden, lässt sich die öffentliche Wahrnehmung von Firmen oder Privatpersonen dauerhaft beeinflussen", sagt Speck.
Google löscht, alles wird gut
Auch wenn die Vorwürfe völlig aus der Luft gegriffen sind, es besteht immer die Gefahr, dass etwas hängen bleibt. "Wir leben in dieser Hinsicht wie im Mittelalter. Leute kommen an den Pranger und können sich nicht wehren", sagt Feser.
Natürlich kann Google nicht alle Informationen im Netz von sich aus überprüfen. Der Aufwand wäre enorm kostspielig und wohl dennoch vergeblich. "Man kann aber erwarten, dass die Suchmaschine reagiert, wenn eine betroffene Person konkret darauf hinweist, dass etwas unrechtmäßig über sie im Internet steht und ganz oben auf der Trefferliste angezeigt wird", sagt Rechtsanwalt Neben.
Wenn Google löscht, ist das Hauptproblem gelöst - die prominente Platzierung der Verunglimpfung. Verschwunden ist die Schmähung aber nicht, sie hat ihren festen Platz irgendwo im Internet. "Das Löschen, Vergessen aber auch Verzeihen gehören schon längst nicht mehr zum Grundvokabular des digitalen Zeitalters", sagt Hendrik Speck.