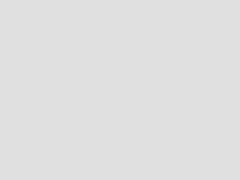Man weiß ja nie genau, wen man trifft, hat man sich unbekannterweise zu einem Spaziergang verabredet. Aber ein Mensch, der versucht, als Tier zu leben? Wir fahren aus der Innenstadt Münchens zum Startpunkt unseres kleinen Rundgangs am Stauwehr Oberföhring. Die Witterung ist kalt und feucht, so wie es wohl weder Mensch noch Tier mögen. Charles Foster, Brite, groß gewachsen und doch unscheinbar, freundlich, zurückhaltend, hat schon zahlreiche Pressetermine hinter sich. Einige Kollegen konnten es sich nicht verkneifen, ihm Masken von jenen Tieren aufzudrängen, deren Lebensweisen er nachgespürt hat. Man sieht ihm die Hoffnung an, dass das jetzt nicht schon wieder kommt.
natur: Ich finde Ihren Ansatz sehr interessant, mancher würde sagen merkwürdig, tatsächlich so leben zu wollen wie beispielsweise ein Dachs. Bringt es wirklich etwas, sich auf die Knie zu begeben und von da auf die Welt zu schauen?
Foster: Ich verstehe, was Sie meinen. Ein Mensch auf Knien fühlt sich meist eher unwohl - und ist dann zunächst nur das: ein Mensch, der sich unwohl fühlt. Natürlich kann man sagen, dass es einem nichts bringt, wenn man probiert, körperlich zu leben wie ein Tier. Darauf kommt es aber gar nicht an. Wichtiger ist der Wechsel der Perspektive, wenn wir uns aus knapp zwei Metern Höhe, aus der wir gewöhnlich auf die Welt blicken, herunter auf die Blickhöhe begeben, die wir hatten, bevor wir Zweibeiner wurden. Das verändert eine Menge. Natürlich wird man sich auch dann nicht, wissenschaftlich korrekt gesprochen, fühlen wie ein Tier. Aber man kommt diesem Zustand doch etwas näher.
In Ihrem Buch beschreiben Sie das sehr eindrücklich. Aber in Wirklichkeit geht es darin doch um etwas anderes.
Richtig. Viele glauben, es handele sich dabei um eine Art Handbuch, nach dem Motto: So wirst Du ein Dachs, Fuchs oder Hirsch. Das ist allerdings eine sehr oberflächliche Erwartung. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich mittlerweile langweilt, gefragt zu werden, wie Regenwürmer schmecken. Ich bedaure es beinahe, dass ich das in meinem Buch so genau beschrieben habe.
Unausgesprochen ist also verabredet: Ich werde ihn nicht nach dem Geschmack von Regenwürmern fragen. Er wird - was wohl auch nicht zu erwarten war, aber man weiß ja nie - keinen Wurm ausgraben und mich dazu auffordern, ihn zu probieren.
Es geht um viel mehr. Wenn Sie so wollen, verfolge ich mit meinem Buch einen philosophischen Ansatz, nämlich: Was heißt es, ein Mensch zu sein? Was heißt es zu leben? Was ist die Welt?
Und auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen hilft es, zu leben wie ein Tier? Wie soll das funktionieren?
Sehen Sie dort, dieser Baum da.
Er eilt auf den Stamm einer Esche zu, breitet die Arme aus, blickt begeistert hinauf zur Krone.
Als Mensch sehe ich ihn und gleichzeitig schwingen da ungeheuer viele Ebenen von Vorstellungen, Bedeutungen und Interpretationen mit. Das ist wie eine Art gewaltiges Hintergrundrauschen. Hinter diesem Rauschen verschwindet der eigentliche Baum beinahe. Als Mensch kann ich also den wirklichen Baum gar nicht mehr so sehen, wie er ist. Dabei ist dieser Baum doch viel wunderlicher als all meine Gedanken, Ideen und Assoziationen zu ihm. Dieses Hintergrundrauschen möchte ich ausschalten oder wenigstens eindämmen.
Und das gelingt Ihnen?
Na ja, manchmal, für wenige Augenblicke. Das ist überwältigend.
Sind das die Momente, in denen Sie dem Tiersein besonders nahe kommen?
Vielleicht.
Weshalb sollte man das eigentlich wollen, fühlen wie ein Tier? Kann man das überhaupt?
Das sind gewichtige Fragen. Die Antworten darauf suchen Wissenschaftler schon sehr lange.
Wäre es nicht sinnvoller, Tiere genau zu beobachten, wenn man wissen will, wie sie fühlen?
Das glaube ich nicht. Dabei kommen eben eine Unmenge von Interpretationen und Rückschlüsse zur Geltung, die das verhindern. Ich lande also bei einem Konstrukt. Wenn ich dagegen meine Nase in den Dreck stecke, eine Nase, die biologisch betrachtet der eines Dachses ziemlich ähnlich ist, dann komme ich mit meinen Empfindungen dabei der Sache vielleicht doch näher, als wenn ich untersuche, wie die Riechzellen eines Dachses funktionieren, sein Nervensystem auf Gerüche reagiert und so weiter. Da würden jetzt sehr viele Biologen aufschreien, weil das ein sogenannter Anthropomorphismus ist, also das gedankliche Übertragen menschlicher Eigenschaften auf Tiere. Ich glaube aber, dass ich damit weiter komme als mit dem reduktionistischen Ansatz, der vertritt: Wenn ein Hund aufjault, weil er geschlagen wird, darf ich nicht behaupten, er leide. Ich halte das für wissenschaftlich borniert. Charles Darwin hätte das übrigens genauso gesehen.
Hängt das auch damit zusammen, dass sich der Mensch Tieren gerne überlegen fühlt?
Bestimmt. Denken Sie nur an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Da wird der Mensch ausgeschickt, sich die Erde untertan zu machen. Menschen lieben diese Vorstellung. Die Tatsache, dass wir in vielen Bereichen große Gemeinsamkeiten mit den Tieren haben, stört da nur. Ich will damit nicht behaupten, dass wir Menschen nichts Besonderes wären, wir sind sehr besonders. Aber darum geht es in meinem Buch auch gar nicht. Ich werde oft gefragt, ob ich Menschen nicht mag. Das stimmt auf keinen Fall. Ich finde, Menschen sind erstaunliche Geschöpfe. Enttäuschend finde ich nur, dass wir so wenig aus unseren Gaben machen.
Er beugt sich über ein Stück Erde am Hang des Isarufers und zeichnet mit dem Finger ein Quadrat in die Luft.

Dieser Quadratmeter Boden hier hat so vieles zu bieten, einen ganzen Kosmos. Wir haben fünf Sinne, nutzen meist aber nur einen davon, unseren Sehsinn. Wir nutzen also nur 20 Prozent der gesamten Information über die Welt, die uns zugänglich wären. Wenn man sich dagegen hier hinkniet und intensiv schnüffelt, dann wird man - zumindest mit etwas Übung - feststellen, dass sich die Gerüche beinahe mit jedem Zentimeter wandeln. Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie genauso intensiv auf Geräusche lauschen und auch Ihren Blick schulen. Stellen Sie sich dann noch vor, Sie gingen mit diesen geschärften Sinnen durch einen Wald. Was wäre das dann für ein Wald, durch den Sie gingen? Er wäre viel mehr als der Wald, den Menschen für gewöhnlich wahrnehmen. Diese Vorstellung ist doch faszinierend. Die Botschaft lautet deshalb: Der Mensch ist ein noch viel erstaunlicheres Wesen als es ein Dachs je sei kann, weil wir ja auch noch Shakespeare oder Goethe lesen können.
In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihre Anstrengungen, zu leben wie Dachs, Fuchs, Fischotter, Rothirsch und Mauersegler. Weshalb genau diese fünf Arten?
Zunächst hatte das einen ganz trivialen Grund: Es mussten Tierarten sein, die charismatisch sind, mit denen sich viele Menschen identifizieren können und über die sie etwas lesen wollen. Außerdem mussten es auch Tiere sein, die ich persönlich mag. Ich habe nie verstanden, wie sich ein Autor intensiv mit dem Leben eines Psychopathen beschäftigen kann, um über ihn zu schreiben. (Er verzieht das Gesicht, als ob er gerade in eine Zitrone gebissen hätte.) Ich könnte das nicht. Jedenfalls brauchte ich einen persönlichen Zugang zu den Tieren. Es mussten aber auch Arten sein, über die es genügend wissenschaftliche Literatur gibt. Zum Beispiel darüber, wie ihre Sinne funktionieren, wie sie sich orientieren und so weiter. Und, last but not least, mussten es Tiere sein, für die sich auch meine Kinder interessieren, denn sie sollten mich ja zum Teil bei meinen Exkursionen begleiten.
Störten Ihre Kinder nicht eher bei Ihren Unternehmungen?
Im Gegenteil. Sie haben so viel weniger vergessen, wie man eine Verbindung zur Natur aufbaut als ich. Sie sind die besten Lehrmeister. Denken Sie nur mal an Kleinkinder. Die sind noch nicht mal richtige Zweibeiner, die bewegen sich viel eher wie ein Dachs. Oder nehmen Sie meinen Sohn Tom. Er hat Dyslexie. Dadurch besitzt er einen viel direkteren Zugang zur Welt und zu den Dingen. Beneidenswert. Für ihn ist ein Stuhl ein Stuhl, ein Tisch ein Tisch, und zwar die Sache an sich, nicht das Wort, und ohne Hintergrundrauschen. Deshalb hat er auch einen viel besseren Dachs abgegeben, als ich je einer sein kann.
Heißt das nicht auch, dass uns die Sprache, in der wir denken und mit der wir die Welt erfassen, letztlich davon entfernt.
Ja. Letztendlich seziere ich mit meinen Worten die Welt und zerstückele sie damit. Das verstellt den Blick fürs Ganze. Ich glaube, dass das zu wenig in der Wissenschaft berücksichtigt wird. Wir betrachten die DNA von Lebewesen, vielleicht einzelne Zellen oder Ökosysteme, die auch nur ein gedankliches Konstrukt sind, und dabei geht der Blick fürs Ganze verloren. Wenn man ein Tier - gedanklich wohlgemerkt - zu sehr in seine Einzelteile zerlegt, wird man das Tier als Ganzes nie verstehen.
Sie haben unter anderem versucht, zu leben wie ein Fischotter. Wo wir gerade hier an der Isar entlanggehen: Wie würde ein Otter den Fluss wahrnehmen?
Er wäre vor allem die meiste Zeit unter Wasser. Und weil er das wäre, würde er vor allem Geräusche und taktile Eindrücke wahrnehmen. Sein Geruchssinn und seine vergleichsweise schlechten Augen nutzen ihm unter Wasser nicht viel. So würde er dann Steine umdrehen und nach Fischen oder andere Nahrung suchen. Den Fluss als Ganzes, so wie wir ihn jetzt sehen, mit zwei Ufern und einem Verlauf, würde er wohl gar nicht registrieren. Im Wasser ist man sehr auf seine unmittelbare Umgebung konzentriert.
Den Kopf unter Wasser, das Gluckern des Wassers in den Ohren, der Wasserdruck auf dem Körper - jeder, der das kennt, kann gut nachvollziehen, was Foster meint.
Haben Ihnen Ihre Experimente ganz persönlich etwas gebracht?
Für mich bedeuten meine Versuche, als Tier zu leben, einen Zugewinn an Empathie. Wenn ich ansatzweise verstehe, was im Kopf eines Tieres vorgeht, kann ich vielleicht auch besser verstehen, was in einem anderen Menschen vor sich geht. Vielleicht werde ich dadurch auch ein besserer Mensch, denn schließlich ist Empathie ein wichtiger Teil des menschlichen Daseins. Und Empathie ist etwas, das man trainieren kann wie einen Muskel.
Sind Sie eigentlich ein Zivilisationskritiker?
Ich bin auf jeden Fall sehr skeptisch in Bezug auf unsere moderne Zivilisation. Ich glaube, wir haben uns von unseren evolutionären, natürlichen Wurzeln abgeschnitten. Viele Menschen sprechen mich an und sagen: "Du musst doch verrückt sein." Denen sage ich: "Pass mal auf, Du zwängst Dich jeden Tag in enge Kleidung, Du verbringst den Tag in klimatisierten Räumen, gehst durch Shopping-Passagen und isst mit unzähligen Chemikalien kontaminierte Nahrung, obwohl Deine Anatomie, Deine Physiologie, Dein Immunsystem dafür gemacht sind, draußen durch den Wald oder die Steppe zu marschieren. Du bist der Verrückte."
Aber unsere Städte, in denen nun einmal viele Menschen leben, bieten doch wenig oder keine Natur mehr.
Das stimmt überhaupt nicht. Wildnis ist überall. Legen Sie mal ein Stück Brot oder Obst irgendwo hin, selbst in Ihrer Wohnung. Schauen Sie nach zwei Wochen nach. Da finden Sie einen wahren Dschungel, zum Beispiel aus Schimmelpilzen. Echte Wildnis. Oder nehmen Sie einen Vorstandsvorsitzenden im feinen Anzug. Der trägt wie wir alle Billionen von Mikroorganismen in seinem Darm mit sich herum. Das beherrscht er überhaupt nicht, das ist auch Wildnis.
Ist die Unterscheidung zwischen der Welt des Menschen und Wildnis oder Natur also nicht haltbar?
Ich glaube nicht. Wir sind Teil der Natur, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir von Zivilisation sprechen, dann meinen wir meist unsere Städte. Ich denke aber, dass Städte nur Teilbereiche der Natur oder Wildnis sind, in denen letztlich immer noch dieselben Regeln gelten.
Glauben Sie, dass deshalb - wie Sie schreiben - Füchse eine Stadt viel besser, intensiver nutzen, als es Menschen tun?
Ja. Sie sind viel alerter als wir. Beneidenswert. Sie haben unglaublich feine Sinne. Selbst mit ihren Pfoten können sie auf fantastische Art und Weise Vibrationen wahrnehmen.
In seinem Buch beschreibt Foster Dachse als sehr orts- und erdverbundene Lebewesen, denn sie leben in Erdbauen, sterben sehr oft darin, werden dort wieder zu Erde, in und von der Regenwürmer leben. Und von diesen Würmern ernähren sich wiederum Dachse zu einem großen Teil.
Sind Ihre Versuche, in die Haut von verschiedenen Tieren zu schlüpfen, auch Ausdruck der Tatsache, dass Sie ein Grenzgänger sind - nicht zuletzt weil Sie sich heimatlos fühlen?
In gewisser Weise ja. Dachse haben beispielsweise eine Verbundenheit mit dem Ort, an dem sie leben, die wir nie erreichen können.
Weshalb glauben Sie, fällt es uns so schwer, zu verstehen, dass unser Verhalten beispielsweise beim Konsum schwerwiegende Konsequenzen haben kann?
Schwierige Frage. Ich glaube jedenfalls, dass kein Tier so schwerwiegende Umwelt- oder Naturschäden anrichten würde wie wir.
Wirklich? Stellen Sie sich vor, Löwen besäßen Gefrierschränke, um Fleisch von getöteten Tieren zu konservieren. Glauben Sie nicht, dass die Löwen die Savanne leerräumten?
Ich glaube, das würden sie nicht tun. Sie würden es alleine schon deshalb nicht tun, weil ein Löwe sich nicht als Löwe fühlen würde, wenn er nicht auf die Jagd ginge. Und welcher Löwe wollte sich schon so fühlen? So wie Menschen sich nicht wohlfühlen, wenn sie komplett von der Natur abgeschnitten sind.
Aber im Zentrum des Menschseins steht eigentlich nicht die Natur, sondern soziale Beziehungen.
Richtig. Wenn Sie mich fragen: Wer ist Charles Foster? Dann antworte ich: Die Summe seiner Beziehungen. Wenn Sie mich davon abschneiden, dann verschwinde ich. Trotzdem gehören zu uns auch unsere natürlichen Wurzeln und die dürfen wir ebenso nicht kappen.
Dazu gehört aber, dass wir sterben müssen. Tiere wissen nichts davon. Glauben Sie, dass Tiere keine Angst vor dem Tod haben?
Sie haben vielleicht keine Angst vor der endgültigen Auslöschung wie wir. Ob sie keine Angst vor dem Tod haben, weiß ich letzten Endes nicht. (Er zögert.) Eine wirklich schwierige Frage. Ich kann sie nicht beantworten.
Haben Sie Angst vor dem Tod oder sagen wir besser vor dem Sterben?
Ich habe Angst vor dem absoluten Ende. Ich finde die Welt faszinierend und ich will nicht damit aufhören, mich faszinieren zu lassen.
Wie erfolgreich waren Ihre Versuche, die Lebensweise der verschiedenen Tiere auszuprobieren?
Ich bin auf ganzer Linie gescheitert. Ich habe, wenn überhaupt, nur ganz wenige Momente erlebt, in denen ich mich den Empfindungen eines Tieres genähert habe. Vor allem während ich versuchte, als Fuchs in der Stadt zu leben. Eine wirklich aufregende Erfahrung.
Wären die Antipoden Ihres Buches, zwischen denen sich die Kapitel abspielen, also richtig umschrieben mit Euphorie und Verzweiflung?
Das trifft es ziemlich gut.