François Fillon tritt gut gelaunt vor die Zentrale des Versicherungskonzerns Axa, wo der Chauffeur schon wartet. Henri de Castries, der Axa-Chef, geleitet den konservativen Ex-Premierminister Fillon vor die Tür. Die beiden Männer, die seit vielen Jahren befreundet sind, verabschieden sich herzlich.
Wer sich im Pariser Kosmos von Wirtschaft und Politik bewegt, wird gelegentlich Zeuge solcher Nähe, die nur auf den ersten Blick banal scheint. Die beschriebene Szene trug sich vor einigen Jahren zu. Damals begann Fillon, seine Kandidatur für das französische Präsidentenamt vorzubereiten. Jetzt steht die Wahl kurz bevor, der erste Wahlgang ist in zwei Wochen. Jetzt weiß man auch, dass Axa dem damaligen Abgeordneten Fillon Consultingaufträge für nicht näher ausgeführte "Beratungsleistungen zur Frage langfristiger Investitionen im Kontext der europäischen Finanzkrise" gewährte. Pariser Medien zufolge kassierte Fillon dafür 200 000 Euro. De Castries ist inzwischen nicht mehr Axa-Chef. Dafür macht er Wahlkampf für den skandalgeschüttelten Freund, der die Wirtschaft "befreien" will.
Auch Frankreichs Wähler wollen sich befreien - von einer politischen Ordnung, zu deren Merkmalen ein inzestuöses Verhältnis von Politik und Unternehmen gehört. Allen Umfragen zufolge wollen die Franzosen die etablierten Parteien aus Bürgerlichen und Sozialisten bei der Präsidentenwahl abstrafen, indem sie die Rechtsextreme Marine Le Pen und den parteilosen Sozialliberalen Emmanuel Macron in die Stichwahl schicken. Das wäre eine Revolution an der Wahlurne. Und: Der Sieg eines dieser Kandidaten wäre ein Misstrauensvotum gegen das von Charles de Gaulle 1958 für sich selbst ersonnene Präsidialsystem, das von einem statischen Zwei-Lager-System ausgeht und die Macht einseitig beim Staatschef konzentriert.
Die Firmenlenker sollten sich ein Beispiel nehmen am Emanzipationsdrang der Bürger und den Wandel der politischen Struktur und Kultur unterstützen. Sie können nicht wünschen, dass der Volksfuror am Ende die selbst unter Betrugsverdacht stehende Le Pen in den Elysée-Palast einziehen lässt. Die Dynamik des Umbruchs aber, die von den Wählern ausgeht, birgt die Chance, eine gesunde Distanz zur Politik zu erlangen. Denn die Wirtschaft zu befreien bedeutet nicht allein, wie Fillon meint, Abgaben zu senken oder das Arbeitsrecht zu entrümpeln. Auch zu viel Nähe hemmt - etwa zu ihm.
Der Nachwuchs: junge Männer, die in den Vorzimmern der Macht antichambrieren
Die Fünfte Französische Republik ist ein feudalistisch anmutendes System, in dem bisher zwei konkurrierende Hofstaaten alle fünf Jahre darum stritten, einen Monarchen auf Zeit zu stellen. Hinter diesem System steht die Vorstellung einer vormodernen, pyramidal aufgebauten Gesellschaft. Das Modell setzt sich bis auf die lokale Ebene fort, wo ein Bürgermeister zusehen muss, möglichst zugleich Abgeordneter in Paris zu sein. Dann ist er der Macht näher - und hat, das ist empirisch belegt, mehr Chancen, bei der Verteilung öffentlicher Gelder etwa für Infrastrukturprojekte bedient zu werden. Alles in diesem System drängt zum Sonnenkönig hin, auch die Manager und Unternehmer. Fern der Macht ist ihr Erfolg schwieriger.
Also gruppieren sich die politisierten Unternehmereliten mehr um die Macht herum, als sich als eigenständiger (Gegen-)Pol in der Gesellschaft zu verstehen. Diese Anordnung übertrifft die Auswüchse des Lobbyismus angelsächsischer Prägung bei Weitem: Die Machtkonzentration begünstigt Willkür durch Politik und Behörden, fördert Vetternwirtschaft, Abhängigkeiten und Geld-Skandale aller Art. Von denen hatten Konservative wie Sozialisten in den vergangenen Jahren einige. Die Wähler haben sie deshalb satt.
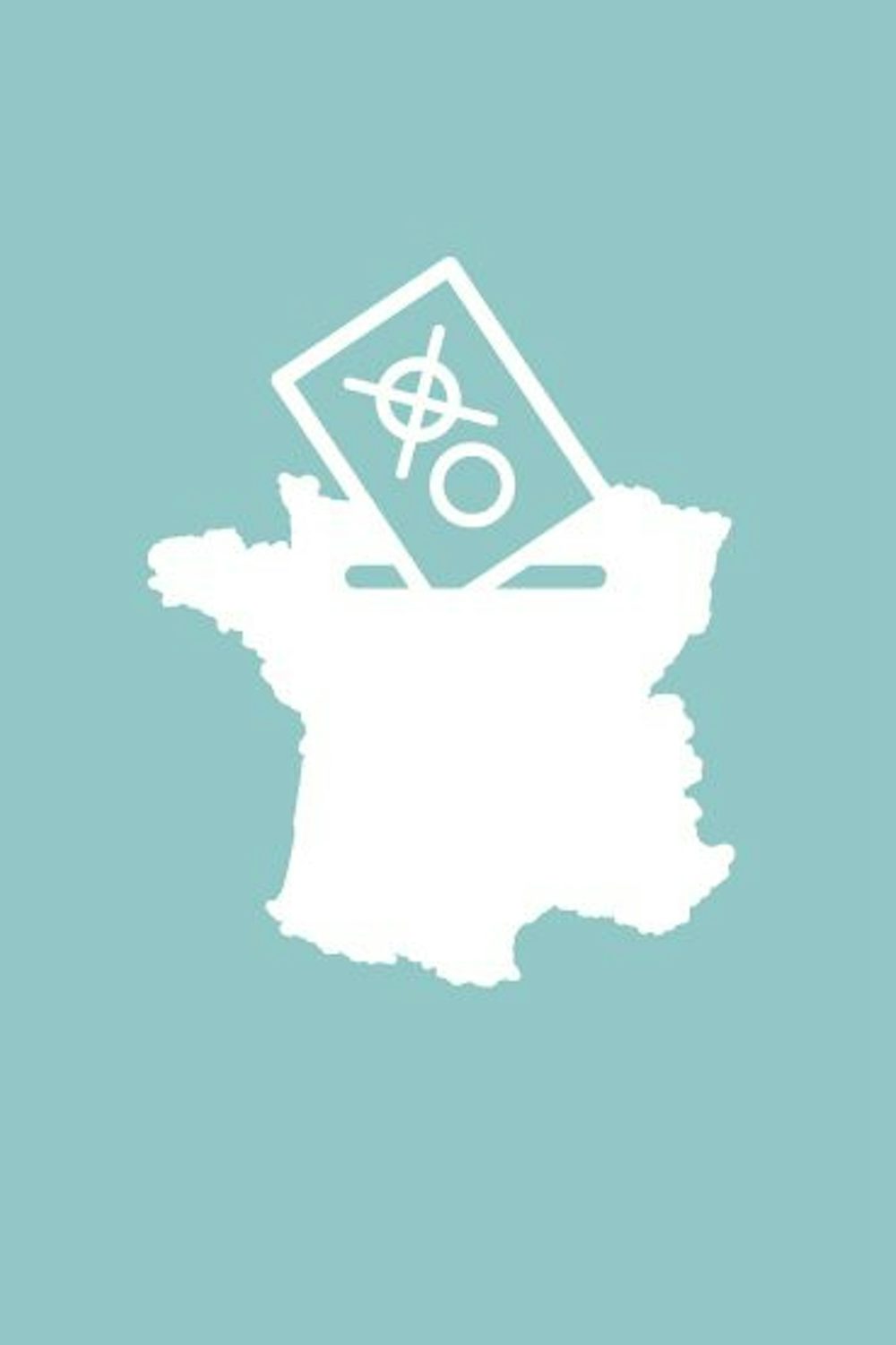
Das grenzdemokratische Regime in einem der Mutterländer der Demokratie ist schlecht für die Unternehmen. Denn es ist - trotz oder wegen aller Beziehungsgeflechte - hochgradig ineffizient: Egal, welches der beiden Lager in den vergangenen Jahrzehnten am Drücker war - Frankreichs Politik hat bewiesen, dass sie unfähig zu echten Strukturreformen ist, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nötig wären. Wenn das Arbeitsrecht komplex und die Unternehmenssteuer hoch sind, liegt das nicht nur an der vermeintlichen Reformverweigerung eines aufmüpfigen Volkes. Wer es sich persönlich gut gerichtet hat in der zeitgenössischen Form der Ständegesellschaft, will oder kann keine grundlegende Modernisierung des wirtschaftspolitischen Rahmens verlangen.
"La Noblesse d'Etat" - "Der Staatsadel". So hat der Soziologe Pierre Bourdieu 1989 die Eliten genannt, die in Kaderschmieden wie der Ecole Nationale d'Administration geformt werden und später dank Beamtenstatus eine risikofreie Pendelkarriere zwischen Spitzenjobs beim Staat und gut dotierten Managerposten in Firmen hinlegen.
In den Gängen des Elysée-Palasts und in Pariser Ministerien kann man diese Spezies und ihren höfischen Habitus studieren: Junge Männer - meist sind es Männer - mit strengen Seitenscheiteln antichambrieren in den Vorzimmern der Macht, warten ungeduldig, sich dem Hausherrn zeigen zu dürfen, unter irgendeinem Vorwand zu ihm hineinzuscharwenzeln, und sei es nur für zwei Minuten. Die Hofschranzen, die meist einen Titel als Ministerberater führen, haben die schönsten Maßanzüge und die edelsten Lackschuhe von ganz Paris. Selten trifft man sonst so selbstsichere - bisweilen: selbstgefällige - Menschen. In einigen Jahren werden sie an den Hebeln von (Staats-)Unternehmen sitzen.
Die Staatsfirmen erfüllen in der Ökonomie des Landes, wie in Deutschland, einen wichtigen gesellschaftlichen Zweck. Sie bieten Bürgern zum Beispiel Transportleistungen, die zur Grundversorgung gehören und die nicht allein unter dem Aspekt der Rentabilität beurteilt werden können. Es kann auch im Interesse von Gesellschaft und Wirtschaft sein, wenn ein privater Konzern mit Steuergeld gerettet wird, sollte das zu seiner schnellen Genesung beitragen. So geschehen bei Peugeot.
Das Problem in Frankreich ist, dass es nicht beim defensiven Ansatz bleibt. Sondern Staatsbeteiligungen zur politischen Einflussnahme selbst dort genutzt werden, wo kein übergeordnetes gesellschaftliches Interesse (mehr) erkennbar ist - etwa beim Peugeot-Rivalen Renault. Dabei schadet der Staat seinen Steuerbürgern noch: Die Dependance des Wirtschaftsministeriums, die öffentliche Beteiligungen im Wert von etwa 100 Milliarden Euro verwaltet, schneidet seit Jahren schlechter ab als der Pariser Börsenindex CAC 40.
Ein Topbeamter, der in den vergangenen Jahren an einer Schaltstelle gewirkt hat und heute bei einem Staatskonzern ist, liefert unter der Bedingung der Anonymität eine schonungslose Analyse: "Wenn eine Firma zu nah an der Politik ist, leidet sie irgendwann. Anders als behauptet wird, ist der Staat gerade kein langfristig orientierter Investor. Politik ist auf schnelle, herzeigbare Ergebnisse aus. Das verhindert langfristigen unternehmerischen Erfolg."
Die politische Machtkonzentration beeinflusst auch private Firmen: Welche der beiden etablierten Parteien gerade den König auf Zeit stellt, entscheidet über Karrieren in CAC-40-Konzernen. Zwei Beispiele aus der zu Ende gehenden Legislatur unter sozialistischer Regentschaft: Kurz nachdem Benoît Hamon, heute Präsidentschaftskandidat, 2014 Minister wurde, stellte der weltgrößte Luxuskonzern LVMH dessen Frau als Lobbyistin ein. Ungenierter kann politische Beziehungspflege kaum sein. Bei der Großbank BNP Paribas wurde zu Beginn der Amtszeit von François Hollande der für seine sozialdemokratische Affinität bekannte François Villeroy de Galhau zum Vizechef. Später betrieb Hollande seine Ernennung zum Gouverneur der Notenbank. Selbst Mittelständler müssen ab einer gewissen Größe darauf achten, sich mit der Macht gut zu stellen. So wie jener Möbelfabrikant aus der Provinz, der regelmäßig an Jagdausflügen mit konservativen Spitzenpolitikern teilnimmt, um Fillon nahe zu sein.
Nur vereinzelt bricht eine neue Generation das alte Schema auf
In Deutschland ist es für Unternehmer ebenfalls üblich, bisweilen allzu intensive Verbindungen zur Politik zu pflegen. Nicht wenige haben ein Parteibuch. Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann darf im Kanzleramt Geburtstag feiern. Und in Bayern kennt man Amigo-Affären. Der Unterschied ist, dass Machtnähe in Frankreich geradezu Bedingung für Erfolg ist.
Nur vereinzelt wird dieses Schema von einer neuen Unternehmergeneration aufgebrochen. Dezentrale, digitale und global ausgerichtete Geschäftsmodelle fügen sich eben schlecht in die hergebrachte Ordnung. Sie entsprechen nicht der etatistischen Vorliebe für große Unternehmen. Denn nationale Champions werden in Frankreich nicht zuletzt deswegen gefördert, weil hundert große Firmen aus der Schaltzentrale leichter zu überblicken sind als zehntausend mittelgroße. Seit Jahrzehnten ist das Steuerrecht so angelegt, sehr große und sehr kleine Firmen zu begünstigen. Ein starker Mittelstand, der ökonomische Macht in der Fläche verteilt und damit ein schwer kontrollierbares Gegengewicht ist, entwickelt sich da kaum.
Wohlmeinende deutsche Wirtschaftsvertreter bemühen gern den Vergleich mit "dem kranken Mann Europas", der vor 15 Jahren Deutschland gewesen sei. Das suggeriert, dass auch Frankreich nur ein paar Hartz-Reformen braucht. Es verkennt das Problem der französischen Wirtschaft. Das ist komplexer als das deutsche Kostenproblem der Nullerjahre: Es ist ein kulturelles Problem, weil derzeit das ganze französische Gesellschaftsmodell in Zweifel steht. Das wirft auch die Frage nach Rang und Selbstverständnis der Wirtschaft auf. Deren Elite bräuchte Mut zur Emanzipation. Wenn dieser Elite diese Lösung überhaupt gelingen kann.
Emmanuel Macron, ein Produkt staatlicher Kaderausbildung sowie Ex-Banker, ist neben Fillon der Liebling der französischen Unternehmer und Manager. Seinen Aufstieg zum Wahlfavoriten hat er dem Versagen der zwei Hofstaaten zu verdanken. Er stellt das Präsidialsystem aber immer weniger in Frage, je näher er der Macht kommt. Auch er droht als Wirtschaftsreformer zu scheitern, wenn er nicht zugleich politische Strukturen reformiert. Also Frankreich in eine bessere, in die Sechste Republik führt.