Unten an den Piers, dort, wo im 19. Jahrhundert die Waren angelandet wurden für die aufstrebende Stadt San Francisco und wo sich heute die Touristen einschiffen für den Ausflug zur gruseligen Gefängnisinsel Alcatraz, dort fühlen sich die Seelöwen wohl, seit Jahrzehnten schon. Sie fläzen auf einigen der in die Meeresbucht ragenden Landungsstegs und leben ihr Leben, das so wenig gemein hat mit der Hektik der kalifornischen Metropole, die trotz des ganzen Reichtums, der wirtschaftlichen Explosion im Zeichen des Internets und der städtebaulichen Expansion mühsam und eher vergeblich das Flair der Hippiezeit zu bewahren sucht.
If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair.
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there.
Scott McKenzie, Mai 1967
Gentle people, freundliche Leute trifft man auch heute an Pier 9. Blumen haben sie nicht im Haar, aber den entspannten Blick des Kreativen, der neugierig und fokussiert zugleich ist und von der Bedeutung seiner Arbeit auf eine freudige Art überzeugt. Auf Pier 9, in Großraumbüros, die in die alten Baustrukturen der Pierhalle eingefügt sind, hat die Firma Autodesk ihr Zukunftslabor bezogen. Auf zwei Stockwerken planen und werkeln Mitarbeiter an 2- und 3-D-Prozessen. Es geht zum Beispiel darum, ein Auto nicht mehr zu bauen, sondern im Showroom digital erfahrbar zu machen. Oder ein Monster für einen Film zwar zu bauen, aber eben nicht mit Hammer und Meißel. Sondern per Tastatur eingegeben in den Computer, ausgespuckt vom Drucker. Oder, die ganz große Nummer, eine Baustelle komplett im Computer zu orchestrieren, mit allen Abläufen, Bauschritten, mit perfekter Organisation der Anlieferung aller Baukomponenten, und bei Bedarf werden sie auch vor Ort von riesigen dreidimensionalen Druckern gefertigt.
Am Pier 9 basteln sie an solchen Lösungen herum, und häufig ist auch der Chef dabei, Carl Bass, 55-jähriger New Yorker, ein Hüne mit dröhnender Stimme, einer, der selbst gern Hand anlegt. Der Mathematiker und IT-Spezialist hat einst das Studium unterbrochen, um das Schreinerhandwerk und den Bootsbau zu lernen, er ist stolz auf seine Werkstatt daheim jenseits der Bucht in Berkeley, wohin er sich immer wieder zurückzieht nach langen Tagen im Chefbüro oder am Telefon.
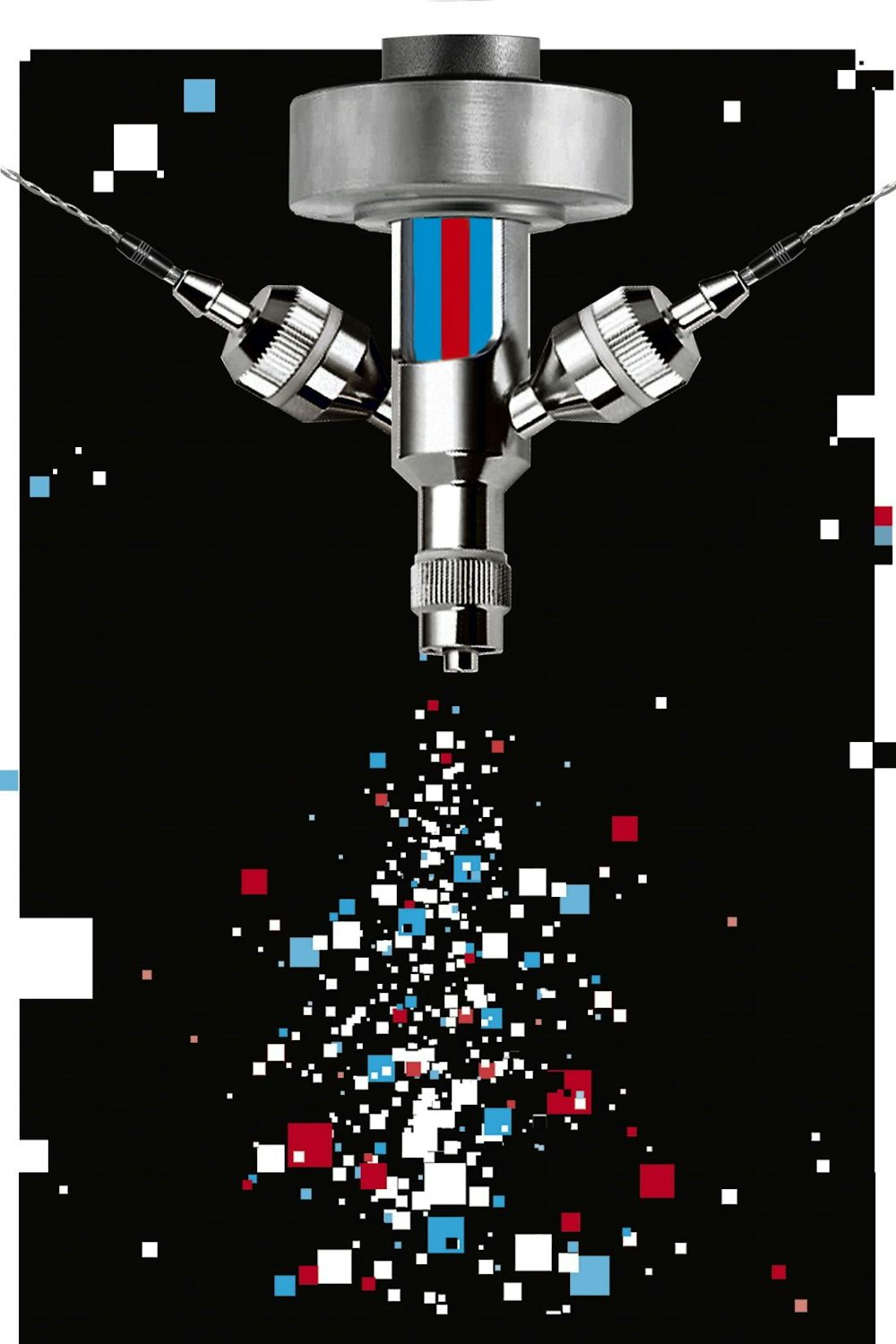
Drunten im Süden, im Silicon Valley, ist Fingerfertigkeit und schnelle Kombinationsgabe gefragt, um mal eben ein neues Programm zu schreiben, hier am Pier 9 geht es um Handarbeit, es geht um Design von Autos und vielen anderen Geräten. Es geht um klassische Industriearbeit, übersetzt ins digitale Zeitalter.
Autodesk ist ein amerikanisches Software-Unternehmen, gegründet 1982, 6800 Mitarbeiter, 2,3 Milliarden Dollar Umsatz. Die Autodesk-Software nutzen Millionen von Architekten, Ingenieuren und Medienmachern. Da geht es um Autos, klar, aber auch um Architektur, Gebäudetechnik, Maschinenbau und Unterhaltung, Modelle für Filme. Ein Geschäft mit Potenzial. Früher ein reiner Anbieter für Profis, versucht Autodesk seit einigen Jahren auch den Verbraucher direkt zu erreichen. Und Carl Bass, der Vorstandsvorsitzende, ist sehr sicher, dass man all die Dinge, die mit Texten gehen, auch mit seinen Konstruktionen möglich sind, zum Beispiel das Auslagern der Daten in die Cloud, den externen Server.
Autodesk hat sein Geschäftsmodell nicht exklusiv, Varianten gibt es auch anderswo, zum Beispiel bei Dassault Systèmes. Das Unternehmen deckt mit den zwölf Marken seiner 3DExperience-Plattform die komplette digitale Produktentwicklung und Vermarktung in Unternehmen jeder Größe über die unterschiedlichsten Branchen ab. Vor einem Jahr hat der Konzern den Visualisierungsmarktführer, die Münchner Firma RTT, übernommen und daraus die Marke 3DExcite geschaffen. Deren Software, Lösungen und CGI-Dienstleistungen für die hochrealistische 3-D-Visualisierung unterstützt dabei alle Phasen des Produktlebenszyklus wie beispielsweise - in der Sprache der Marketingleute - die "Inszenierung von Produkterlebnissen" im Verkaufsraum durch Augmented Reality, Stereo3D, und was die neue Technik so alles hergibt. Für die großen Konzerne ist das eine willkommene Gelegenheit, die Kosten für die Entwicklung und Vermarktung neuer Modelle zu reduzieren und die Markteinführungen zu beschleunigen.
Das ist einerseits eine technische Frage, und andererseits eine konzeptionelle. Die Trennungslinie zwischen beiden Welten ist der Graben, den Deutschland überwinden muss, wenn es in der neuen Zeit nicht nur mitmachen, sondern auch annähernd so erfolgreich bleiben will, wie es das bisher in der industriellen Entwicklung ist. Will sagen: Die Deutschen sind prozessorientiert, und sie sind auf Hardware spezialisiert. Sie sind gut darin, erstklassige Maschinen zu bauen. Sie haben gelernt, auch bei der Automatisierung dieser Prozesse ganz vorn dabei zu sein, in der üblichen Kategorisierung ist das "Industrie 3.0" (nach Dampfmaschine und Massenproduktion). Die Deutschen können also auch Software. Die Automobilindustrie mit Fahrzeugen, die mittlerweile beeindruckend intensiv mit Netzwerk ausgestattet sind, legt davon ein glanzvolles Zeugnis ab.
Nun aber geht es um die "4", um die Verknüpfung von allem und jedem unter möglicherweise völlig neuen Vorzeichen. Durchsetzen wird sich nicht mehr automatisch derjenige, der die besten Produkte baut, sondern derjenige, der die interessantesten und leistungsstärksten Servicepakete anbietet, mehr noch: der überhaupt völlig neue Geschäftsideen hat. Man kann das am Beispiel des aktuellen Machtgerangels in der Führung des VW-Konzerns beschreiben. Beim Kampf um Wolfsburg geht es ja nur auf den ersten Blick um das Ringen zweier alter Männer mit großem Ego, also des Porsche-Erben und Miteigentümers des Konzerns, des Milliardärs Ferdinand Piëch, und des bestverdienenden deutschen Konzernmanagers und VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn. Dahinter kann man mit Fug und Recht einen viel wichtigeren inhaltlichen Disput vermuten, der um die Frage kreist: Hat der gigantische Konzern mit zwölf Marken, 200 Milliarden Euro Umsatz und 600 000 Mitarbeitern nicht nur in der Vergangenheit eine außerordentliche Erfolgsgeschichte geschrieben, sondern ist er auch zukunftstauglich im digitalen Zeitalter?
Daran kann man zweifeln, wenn man sich anschaut, was die Konkurrenz so alles macht: BMW setzt auf die energiepolitische Karte und festigt gerade für sehr viel Geld seine Kompetenz bei Elektroautos. Daimler hat sich dem digitalen Zeitalter noch mehr verschrieben und investiert mit Car2go in Carsharing-Modelle: Das ist tatsächlich ein mutiger Sprung über den digitalen Graben, hin zu einem völlig neuen Geschäftsmodell für einen Konzern, der sich seit 130 Jahren, seitdem Carl Benz 1885 in Mannheim sein Dreirad gebaut und am 29. Januar 1886 seinen Motorwagen zum Patent angemeldet hat, dem Auto- Bauen verschrieben hat und nicht dem -Verleihen, -Teilen - oder sonst wie Handeln. Carsharing aber ist eine typische Erscheinung des digitalen Zeitalters, praktisches Beispiel für die Share Economy, die Wirtschaft des Teilens statt des Besitzens.
Das Gesundheitssystem wird weniger Geld haben, aber mehr Aufgaben bekommen
So viel zu Industrie 4.0, aber die digitale Revolution bleibt dabei nicht stehen. Sie wird auch die Dienstleistungen verändern. Die Reisebüros, die Medien, die Logistik, die Finanzwirtschaft. Und, besonders spannend, Bereiche, an die viele Bürger noch gar nicht denken. Zum Beispiel das Gesundheitswesen, das ohnehin vor dramatischen Veränderungen steht.
Der demografische Wandel schlägt hier voll durch, immer mehr Menschen werden immer älter, eine immer bessere Medizin bietet immer mehr Hilfsmöglichkeiten an. Das Gesundheitssystem, das ist eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre, wird mit weniger Geld auskommen müssen. Und bekommt zur selben Zeit immer mehr Aufgaben. Die Digitalisierung ist dann eine Chance, aber sie verändert auch das Verhältnis von Arzt, Patient und Kasse. Wenn erst auf der kleinen Chipkarte alle relevanten Daten aufgetragen sind, werden wir ganz andere Kosten-, aber auch Organisationsprozesse haben.
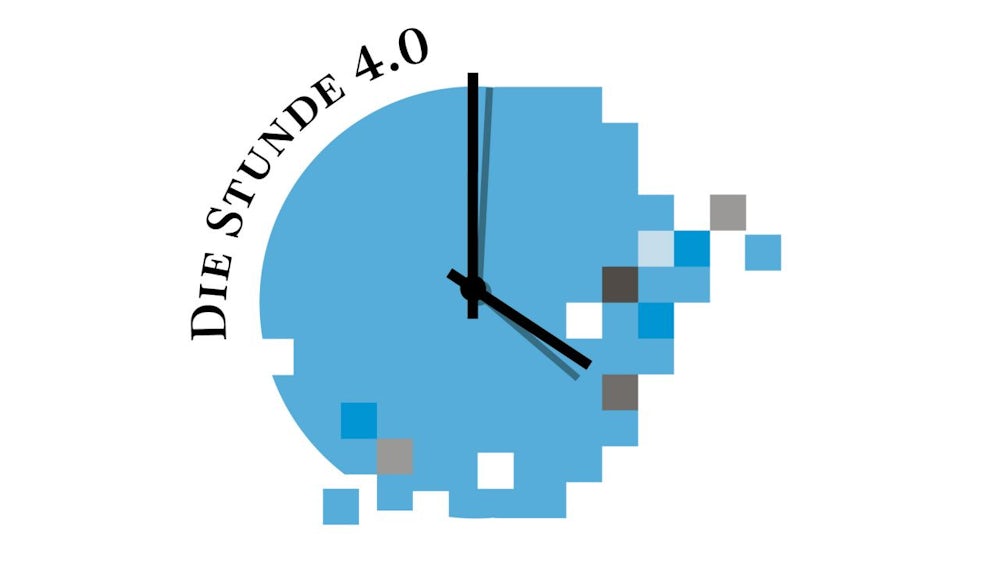
Das kann ganz praktische Auswirkungen auf die Versorgung in der Stadt und auf dem Land haben. Der Ausbau der Telemedizin kann helfen, systemische Probleme wie den Landärztemangel zu lösen. Das ist freilich noch die leichtere Übung. Viel aufregender ist es, wie sich das System insgesamt verändern wird. Auch wenn die Kassen und Versicherungen eine gewisse Vorstellung über die Struktur ihrer Klientel haben, so handelt es sich doch immer noch um ein generalisierendes System. Weil man weiß, dass bestimmte Vorsorgemaßnahmen spätere Erkrankungen zu verhindern helfen, übernimmt dann womöglich die Kasse die Kosten für diese Vorsorgeuntersuchung.
In Zukunft wird es möglich sein, den Gesundheitszustand jedes Bürgers permanent zu überprüfen. Je nachdem, wie viel Vorsorge er treibt, wie gesund er ist, kann man seinen Tarif individuell errechnen. Das wäre ein überaus effektives System. Der Weg zum gläsernen Patienten allerdings ist dann nicht mehr weit. Beim Gesundheitswesen sieht man viel deutlicher als bei der vermeintlich bürgerfernen Industrie 4.0, wie nahe bei der Digitalisierung Chancen und Risiken liegen. Hier den richtigen Ordnungsrahmen zu finden, wird für die kommenden Jahre die vielleicht wichtigste Aufgabe des Staates sein.