Am Strand von Gadani übertönt das Getöse von krachendem Stahl das Rauschen des Meeres. Das ist der Arbeitsplatz von Naseeb Gul, 56, der als junger Mann aus den Bergen im Norden des Landes hierher in den Süden von Pakistan gekommen ist. Naseeb Gul hat damals nur noch daran gedacht, wie er seinen "leeren Magen füllen kann", erinnert er sich an seine Suche nach einem Job bei einem der zahlreichen Abwrackbetriebe. Er wollte nur vorübergehend auf dem Schiffsfriedhof von Gadani bleiben, Geld sparen, um sich später eine kleine Existenz in seinem Heimatdorf aufzubauen. Das hat nicht funktioniert.
Der Traum vom Reichwerden beim Abwracken alter Schiffe ist geplatzt.
Naseeb Gul, der herzliche und zähe Typ, schuftet nun seit 30 Jahren auf dem elf Kilometer langen Strandabschnitt von Gadani, der 50 Kilometer nordöstlich von der Industriestadt Karachi am Arabischen Meer liegt. Gul ist einer von zehntausend Tagelöhnern, die hier unter lebensgefährlichen Bedingungen Hochseeschiffe in ihre Bestandteile zerlegen. Im vorigen Jahr waren es genau 111 der großen Kähne, die zu 90 Prozent aus Stahl bestehen. Gul und seine Arbeiterkollegen können als Tagelöhner sich und ihre Familien ernähren, zum Sparen für eine bessere Zukunft reicht ihr Einkommen nicht. Das große Geschäft mit der Entsorgung ausgedienter Tanker, Frachter und Containerschiffe machen andere: Reeder, Vermittler und Zerlegebetriebe.
Das Abwracken ist umso profitabler, je höher der Preis für den sogenannten Gebrauchtstahl gerade ist.
Und da der Gewinn umso höher ausfällt, je geringer die Kosten für das Zerlegen der Schiffe sind, landeten 2014 mehr als sechzig Prozent der ausgedienten 1026 Schiffe an den Stränden Indiens, Bangladeschs und Pakistans. Gemessen an der Tonnage waren es sogar mehr als siebzig Prozent.
Nach Angaben der in Brüssel ansässigen Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform endeten an asiatischen Billigstlohnstränden zwei von drei Schiffen, die früher europäischen Reedern gehört hatten, zum Beispiel Danaos und Euroseas in Griechenland oder Leonhardt & Blumberg, Conti Holding GmbH und MACS in Deutschland. Beim schmutzigen Abwrackgeschäft in Pakistan lässt man sich nicht gerne zuschauen.
Ausländische Besucher sind unerwünscht. Polizisten, die an den Zufahrtswegen postiert sind, schickten sie zurück, erzählen zwei Gewerkschafter, dafür bekämen die Polizisten von den Entsorgungs-Unternehmern Geld zugesteckt. Dieses Mal haben die Aktivisten einen großen Wagen besorgt, mit dem sonst Geschäftsleute unterwegs sind, Seiten- und Rückfenster verhängt. So geht es unentdeckt vorbei an dem Polizeiposten durch die Wüstenlandschaft der Provinz Belutschistan, die an Iran grenzt. Ein Kamel wandert einsam umher, dann taucht hinter Hügeln der Umriss eines halben Frachtschiffes auf, zum Greifen nah, ziemlich surreal. Ein Schiff in der Wüste - keine Fata Morgana.
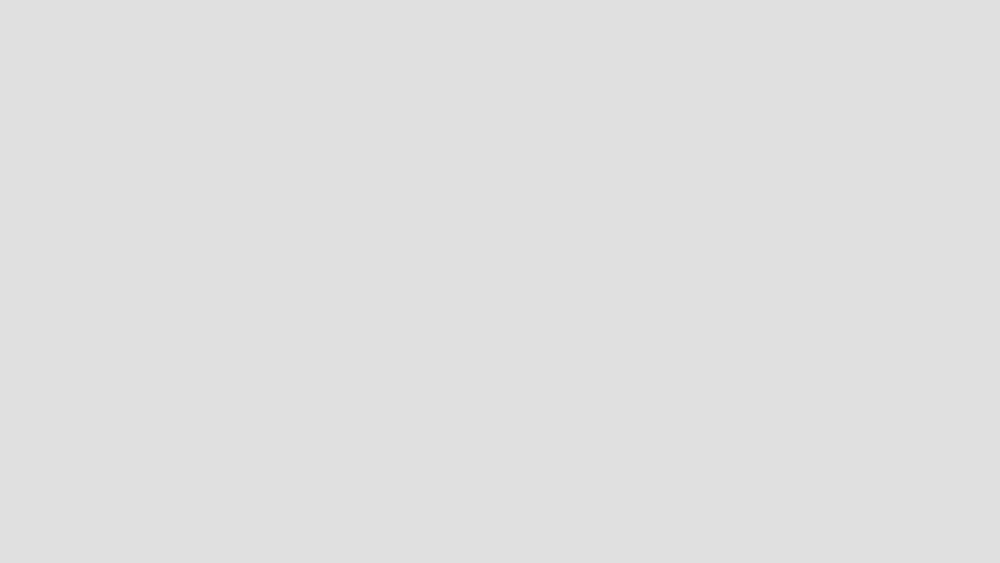
Der Strand von Gadani eignet sich hervorragend für das sogenannte Beaching, das finale Auflaufen eines Schiffe auf das schnell abfallende Ufer.
Eben hat ein Kapitän die Saisaban mit Volldampf auf den Strand gesetzt. Noch raucht der Schlot des Frachtschiffes mit den auffälligen Ladekränen. Die Geschichte der Saisaban ist typisch. Auf der japanischen Werft Hiroshima 1986 gebaut, transportierte ein norwegischer Reeder auf dem Massengutfrachter zunächst Holz. Das Schiff wechselte mehrmals den Eigentümer, zuletzt gehörte es der kleinen griechischen Reederei Mallah Ship Management Company. Die Reederei scheint sich auf den Kauf alter Schiffe spezialisiert zu haben - laut Shipbreaking Platform besaß sie bislang überhaupt erst zwölf Schiffe, von denen acht bereits in Südasien verschrottet worden sind. Hierher gelangen die meisten Schiffe durch die Hände der sogenannten Cash-Buyer.
Zwei Gesellschaften unter den Bargeld-Zahlern dominieren das globale Geschäft: Wirana aus Singapur und GMS aus Dubai. Sie kaufen den Reedereien Schiffe ab und veräußern sie an die Abwrackbetriebe - zu Marktpreisen abhängig von den lokalen Erlösen für den Stahl und den Währungskursen. Ein gutes Geschäft, vor allem für die Reeder. Für sie hat dieses Geschäftsmodell den großen Vorteil, dass sie beim Verkauf aus der Verantwortung für die Entsorgung heraus sind - und sofort den Resterlös für ihr altes Schiff erhalten.
"Erfahrung, Sinn für Kontinuität, Augenmaß für das ökonomisch Mögliche und Menschenkenntnis", wirbt die Reederei H. Vogemann GmbH & Company KG in Hamburg. Der 1886 gegründeten Traditionsreederei gehörte bis vor Kurzem auch das Frachtschiff 2car. Nach Ermittlungen der Shipbreaking Platform wehte an Bord, als es im Mai 2015 am Strand von Gadani zur Verschrottung anlandete, die Flagge von St. Kitts und Nevis. In dem Commonwealth-Inselstaat auf den Kleinen Antillen können Schiffe über Nacht angemeldet werden. Eine Mail und die Zahlung einer Gebühr reicht aus, sagt Patrizia Heidegger. Sie ist die Geschäftsführerin der Shipbreaking Platform, einer Koalition aus 19 Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Weil es so unkompliziert sei, lassen Cash-Buyer ihre Schiffe die "letzte Reise" oft unter der Flagge von St. Kitts und Nevis antreten.
Man habe das Schiff im Frühjahr an eine US-Gesellschaft verkauft, sagt Markus Lange, geschäftsführender Gesellschafter bei der Reederei Vogemann. Über den Verkauf sei Stillschweigen vereinbart worden, deswegen könne er auch nicht beantworten, ob der Käufer ein Cash-Buyer gewesen sei. Das Schiff sei fahrtüchtig gewesen, der Schiffs-TÜV noch eineinhalb Jahre gültig gewesen, betont der Reeder.
Die Shipbreaking-Aktivistin Heidegger hört solche Antworten oft. Wiederholt schon hätten Reedereien ihr weiszumachen versucht, sie wüssten nicht, was mit ihren verkauften Schiffen geschieht. Die NGO-Geschäftsführerin Patrizia Heidegger gehört schon zur zweiten Generation der Aktivisten, die sich für das Thema engagieren. Das Geschäft mit den Altschiffen floriert immer noch. Die Jobs beim Abwracken sind sogar begehrt, weil es oft keine anderen gibt und sie vergleichsweise gut bezahlt werden. Deswegen balancieren die Arbeiter auf den Schiffen oder seilen sich an den Wänden hinab, um die Giganten mit Schneidbrennern zu zerlegen. Sie müssen schuften, gewöhnlich an sieben Tagen die Woche, von Montag bis Samstag zwölf Stunden und am Sonntag sechs. Das wäre selbst in Pakistan illegal, wenn die Beschäftigten einen festen Arbeitsvertrag hätten. Aber hier arbeiten fast nur Tagelöhner.
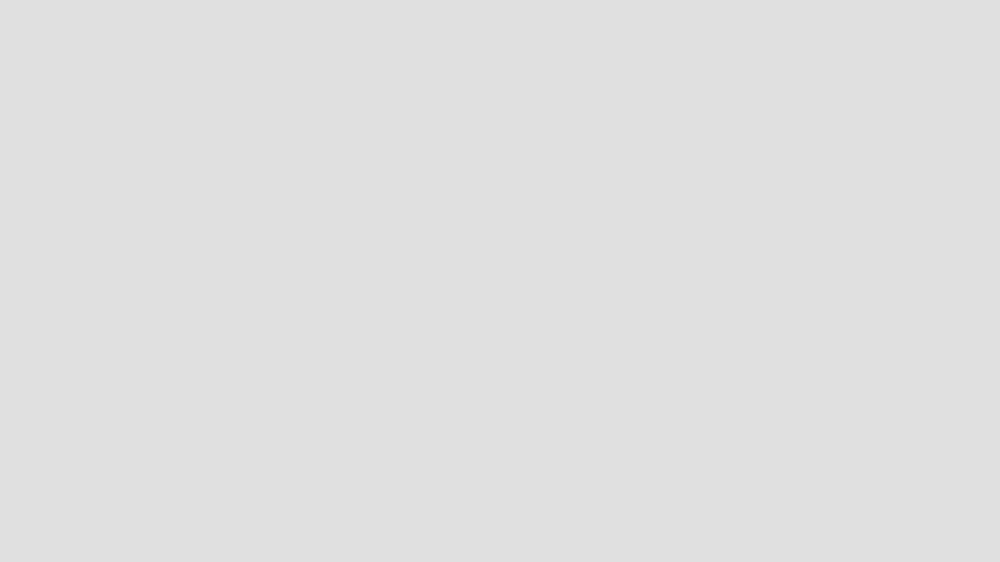
Wer protestiert, fliegt.
Gul steht zwischen haushohen Bergen von Stahlschrott und zieht seine kleine weiße Gebetsmütze vom Kopf. Er scheitelt mit der Hand sein schlohweißes Haar, eine Narbe wird auf dem Schädel sichtbar. Bei der Arbeit auf einem Schiff sei ihm ein Eisenstück auf den Kopf gefallen; die Wunde musste mit sieben Stichen genäht werden, berichtet er.
Gul hat mehr Glück gehabt als andere. Jeder kennt hier Geschichten von Toten oder Schwerverletzten. Gul erzählt von dem Kollegen, der auf einem Motorrad in ein Krankenhaus gebracht werden musste, weil es weit und breit kein Auto gab.
"Wir dürfen keinen Helm tragen, weil wir dann angeblich langsamer arbeiten."
Unglücke sind programmiert, weil einfachste Sicherheitsvorrichtungen fehlen. Weit und breit trägt niemand einen Schutzhelm, der 15 bis 30 Dollar kostet. "Selbst, wenn wir ihn uns selbst kaufen, dürfen wir keinen Helm tragen", sagt Gul, "weil wir dann angeblich langsamer arbeiten". Wenige Arbeiter tragen Schutzbrillen, kaum jemand festes Schuhwerk.
Auf einer Hütte an der Piste weht eine zerfetzte rote Flagge der National Trade Union Federation. Drinnen zieht der Gewerkschaftssekretär Rafig Baloch aus der Schublade des verstaubten Holztisches einen Hefter mit Unfallberichten. Der neueste stammt aus dem Dezember 2011: Eine herabfallende Eisenplatte zerschmetterte Mahundin den Kopf, als er gerade im Abschnitt 60 arbeitete. Einer von schätzungsweise Tausenden Todesfällen beim Zerlegen von Schiffen in Südasien. Eine genaue Zahl weiß niemand, weil über die Unfälle normalerweise kein Buch geführt wird.
Auch die Gewerkschaft hat das Zählen der Toten in Gadani seit dem Fall mit der Eisenplatte eingestellt, weil sie es sich nicht mehr leisten kann, dafür einen Mitarbeiter abzustellen. "Die Mitgliedschaft in unserer Gewerkschaft ist ein Kündigungsgrund", sagt Baloch. Nur sehr wenige riskieren dafür ihren Job, manche zahlen immerhin eine Geldspende.
Lange Zeit wurde das Abwracken von Schiffen durch Werften in den USA und Europa besorgt. Hohe Löhne und steigende Kosten aufgrund von Umweltauflagen führten in den 1970er-Jahren zur Abwanderung dieses Geschäftes nach Taiwan und Südkorea. Wer will, kann auch noch heute Schiffe fachgerecht in Docks zerlegen lassen, beispielsweise in China und der Türkei. Aber das hat seinen Preis.
Wer ein Schiff fachgerecht entsorgt, bekommt weniger Geld für eine Tonne Stahl. "Südasien präferieren die meisten Schiffseigentümer, weil Umwelt-, Sicherheits- und Arbeitsstandards nur gering entwickelt sind", sagt Patrizia Heidegger.
In den 1980er-Jahren waren findige Geschäftsleute in Indien, Pakistan und Bangladesch auf die Idee gekommen, Schiffe statt in teuren Docks viel billiger an Stränden zerlegen zu lassen. Wegen des wirtschaftlichen Booms in Asien stieg zudem die Nachfrage nach preisgünstigem Stahl aus Schrott. Vor allem von der Bauindustrie wurde er gebraucht. Nur wenige Kilometer von Gadani entfernt, verwandeln in der Industriestadt Hub Schmelzen und Fabriken den Schiffsschrott in wiederverendbaren Altstahl. Nicht allein der Stahl wird recycelt. Weil die Menschen hier alles gebrauchen können, werden die Schiffe restlos verwertet - auch das Mobiliar oder die technischen Geräte.

Rund um das Abwracken ist eine ganze Industrie entstanden. Sie gibt 850 000 Menschen Arbeit allein in Pakistan. Es sind Menschen wie Naseeb Gul.
Gul wohnt in einer Hütte. Deren Wände sind aus Resopal, das aus Kajüten stammt. Aufgereiht stehen in einer Ecke rote, gelbe, blaue und grüne Plastikkanister von Schiffen, mit denen die elfköpfige Familie frühmorgens Wasser holt. Statt selbst in die Heimat zurückzukehren, hat Gul seine Familie vor sieben Jahren in diese staubige und triste Gegend nachgeholt.
Er hatte erkannt, dass es mit dem eigenen Geschäft im Heimatdorf nichts wird. Außerdem trieben inzwischen die Taliban in der Nähe der afghanischen Grenze ihr Unwesen. "Hier ist es zumindest friedlich", schildert Gul sein Leben in Gadani. Mittlerweile arbeitet bereits auch einer seiner vier Söhne in der Abwrackindustrie.
Eigentlich sind die Weichen für bessere Verhältnisse beim Abwracken bereits gestellt: Die International Maritime Organization IMO der Vereinten Nationen hat bereits vor sechs Jahren ein Hongkong-Übereinkommen verabschiedet. Es legt weltweite Standards für die Arbeitssicherheit und den Schutz der Umwelt beim Schiffsrecycling fest. Doch außer Norwegen, dem Kongo und Frankreich hat bislang kein Land die Konvention ratifiziert. Auch Deutschland lässt sich Zeit. Im Herbst will die EU eine Liste von Werften bekannt geben, die ihren europäischen Standards entsprechen. Das habe Bewegung in die Branche gebracht. "Jeder will auf die Liste", sagt die Aktivistin Heidegger.
Aber Hintertüren für die Entsorgung von Schiffen auf andere Art und Weise bleiben bei einer europäischen Regelung offen - sie können ihre Schiffe natürlich weiterhin in andere Regionen verkaufen. "Solange die Reedereien nicht verbindlich in die Verantwortung genommen werden, verändert sich nichts", ist Heidegger überzeugt. Sie freut sich darüber, dass der norwegische Reedereiverband Mitte August erstmals erklärt hat, Reeder seien bis ans Ende der Lebenszeit für ihre Schiffe verantwortlich und müssten sich um ein sauberes und sicheres Recycling kümmern.
"Die Käufer haben sich nicht an die Verträge gehalten."
Einige Reedereien haben bereits freiwillig gehandelt. Hamburg-Süd reagierte genauso wie Maersk, die weltgrößte Reederei aus Dänemark, schon vor Jahren, nach einer Greenpeace-Kampagne. Hapag-Lloyd, mit 190 Schiffen die größte deutsche Reederei, hat 2014 umgesteuert. "Die Käufer haben sich nicht an die Verträge gehalten." Seit Mai 2014 verhält sich Hapag-Lloyd nun freiwillig schon einmal so, als ob die Hongkong-Übereinkunft bereits in Kraft gesetzt wäre. Allerdings gilt dieses Vorgehen nur für die eigenen rund 80 Schiffe.
Guls fünfjähriger Sohn Adul Qadir hat mit Filzstiften auf die Hütte aus alten Schiffswänden einen Dampfer gezeichnet, der mit rauchendem Schornstein durch die Wellen fährt. Wenn er mehr Glück hat als sein Vater und sein ältester Bruder Abdul Razik, dann wird er woanders Arbeit bekommen als am Strand von Gadani.
Auch Abdul Razik, der jetzt fünf Jahre als Abwracker arbeitet, kann sich nicht vorstellen, hierzubleiben. Er will Geld sparen und ein eigenes Geschäft aufmachen - es ist der gleiche Traum, den sein Vater hatte.