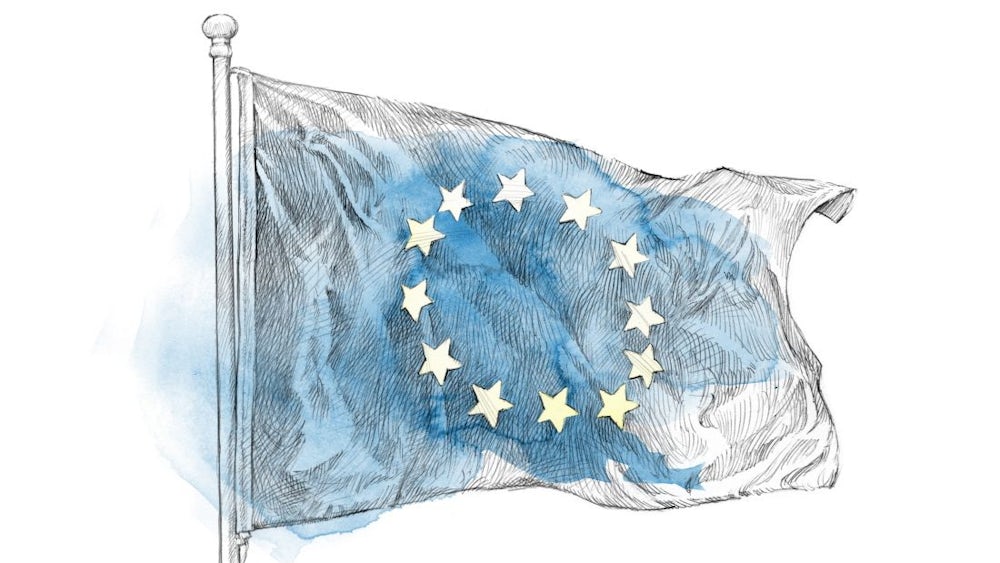Es ist ja wahr. Indem sie für den Brexit stimmten, haben die Briten eine rückwärtsgewandte Wahl getroffen. Das konnte man überall lesen. Vergegenwärtigt man sich aber die vergangenen Wochen, so erstaunt doch die Unfähigkeit der europäischen Medien, die Gründe für diese Entscheidung zu ermitteln. Man konnte meinen, die Trennlinie verlaufe zwischen den Verteidigern zivilisierter Werte und einer Horde fremdenfeindlicher, rassistischer Barbaren. Auf der einen Seite die Guten, auf der anderen die Bösen. Das verhinderte von vornherein jede ernsthafte Debatte. Wir erfuhren aus der Presse, dass große Autoren wie Ian McEwan und Hanif Kureishi der Europäischen Union einen vorher nie erreichten Grad an wirtschaftlichem und kulturellem Wohlstand zugutehielten - doch über die Standpunkte anderer vernünftiger und einflussreicher Leute, die sich mit seriösen Argumenten für den Austritt aus der EU starkmachten - Larry Eliot vom Wirtschaftsteil des Guardian etwa oder die deutschstämmige Labour-Abgeordnete Gisela Stuart - ging man hinweg.
Das Ergebnis war eine unsinnige Vereinfachung nach dem Freund-Feind-Prinzip. Es lässt sich ja einiges über die EU sagen, doch sicherlich nicht, dass sie die großen ökonomischen Probleme des Kontinents gelöst hätte; ebenso wenig, dass ihre Mitgliedsstaaten gegenseitige Solidarität üben würden und sich unzweifelhafter politischer Erfolge rühmen könnten; ja nicht einmal, dass sie eine unumstrittene und vertrauenswürdige supranationale Führung zu bieten hätte. In Wirklichkeit fordert die Wirtschaftskrise immer noch zahllose Opfer, die Arbeitslosigkeit verharrt (außer in Deutschland) auf hohem Niveau, die Angst vor massenhafter Einwanderung ist überall spürbar. Schließlich: Wer würde schon behaupten, dass ein Jean-Claude Juncker das Zeug zum europäischen Leader hätte - abgesehen von der Tatsache, dass niemand von uns ihn je gewählt hat.
Die Frage der Wahlen ist keineswegs unerheblich. Bei der Entscheidung zum Europaparlament sind es nationale Gesichtspunkte, die uns lenken. Seit Einführung des Euro sind fünfzehn Jahre vergangen, doch dass dies den Volkswirtschaften von Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und anderen Ländern gut bekommen wäre, kann man nicht gerade sagen. Ist das etwa kein Fehlschlag? Und dass es zwischen den Mitgliedsländern der EU nicht den geringsten Fortschritt beim Verständnis für die jeweils anderen Kulturen gegeben hat, ist das nicht ein noch schmerzhafterer Misserfolg? Wir haben das Recht auf Freizügigkeit, ein großartiges Recht - doch seit uns der islamistische Terrorismus heimsucht, ist ein Wettbewerb darüber ausgebrochen, wer die höchste Mauer errichten kann. Um uns zu informieren, lesen wir nur unsere nationalen Zeitungen. Von den anderen wissen wir, abgesehen von den üblichen Stereotypen, wenig bis nichts. Im Gegenzug wissen wir alles über die Vereinigten Staaten - wir sehen amerikanische Filme und amerikanische Serien, wir kaufen die Bücher amerikanischer Autoren, wir verfolgen die Präsidentschaftswahlen in den USA mit sehr viel mehr Interesse und Hingabe als vergleichbare Wählervoten bei unseren europäischen Nachbarn. Und auf diese Gemeinschaft sollen wir stolz sein?
Wir sollten es uns endlich eingestehen: Bis heute definieren wir uns über unsere nationalen Identitäten, die mit den von Brüssel diktierten, nicht selten unverständlichen Vorschriften lediglich kurz gehalten, wenn nicht gemaßregelt werden. Das stärkt nicht gerade das Freiheitsgefühl oder die Vorstellung von Selbstbestimmung. Es lässt sich doch nicht darüber hinwegsehen, dass die wichtigsten Argumente der überzeugten Europäer, sei es vor der Volksabstimmung in Großbritannien, sei es in den Tagen danach, auf Angst beruhten. Auf der Angst vor den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen durch den Austritt aus der EU. Aber mit der Angst kommt man nicht weit, nicht in der Demokratie.
Die Briten hatten diese Angst nicht. Sie sind nie überzeugte Europäer gewesen. Indem sie ihrem praktischen Temperament treu blieben (" in the end, business is business"), haben sie darauf gewartet, dass die Dinge sich bessern - ohne jemals besonders in dieses Europa zu investieren -, um am Ende, als der Zauber verflogen war, einzig und allein in sich selbst zu investieren. Doch seien wir ehrlich: Würde morgen auf dem Kontinent eine Volksabstimmung über dieses zum Geschäfts- und Bankenbunker verkommene Europa angesetzt, würde wohl keiner darauf wetten, dass eine überwiegende Mehrheit anders abstimmen würde als die Briten. Oder will jemand ernsthaft behaupten, dass alle Leave-Wähler im Vereinigten Königreich fremdenfeindliche Monster sind?
Ein Gutes hat die Zukunft immer: Wir können sie noch neu erfinden
Ich bin weder Soziologe noch Politologe. Die Schriftsteller - der mäßige Berufsstand, dem ich angehöre - verlassen sich normalerweise auf archaische, um nicht zu sagen primitive Instrumente der Wirklichkeitserfassung. Zudem handelt es sich bei ihnen um Wesen, die unfähig sind, kohärente Antworten mitzuliefern - das besorgen erstens die Religionen und zweitens die Ideologien. Trotzdem habe ich den Verdacht, dass ein bisschen Fantasie der europäischen Sache dienlich wäre. Diesem Europa, das ein für alle mal damit aufhören müsste, über Banken, Schulden, die Troika, Kursspannen und den Durchmesser von Zucchini zu sprechen, und sich stattdessen dem konkreten Leben der Millionen Menschen zuwenden sollte, denen es miserabel geht und deren gutes Recht es ist, ihr Unbehagen zum Ausdruck zu bringen.
Man verstehe mich nicht falsch: Ich sage nicht, dass der, der Schulden gemacht hat, sie nicht auch begleichen müsse, doch kann die Bedingung für die Tilgung aller Verbindlichkeiten im vereinbarten Zeitraum nicht lauten, dass sich der Schuldner das Leben nehmen muss. Denn in diesem Fall hätten wir es mit dem unter Chirurgen beliebten Bonmot zu tun: OP gelungen, Patient leider tot.
Ich habe viele Jahre im Vereinigten Königreich gelebt, wo ich mich bis heute immer wieder für längere Zeit aufhalte. Nicht im herrlich multiethnischen London, sondern in der Provinz, wo der Stimmenanteil für Leave wesentlich höher ausfiel als in der Hauptstadt. Vereinfachend könnte man sagen, dass dort ein gewisser, vielleicht nicht grundloser Pessimismus vorherrschte. Doch mit Pessimismus kommt eine Demokratie nicht weit. Sie wendet dann den Blick zurück in die Vergangenheit, und, sollte die Geschichte unseres Kontinents einen Sinn haben, erwartet uns da keine schöne Aussicht. Wenn die Zukunft hingegen auch sonst nichts zu bieten hat, ein Gutes hat sie immer: Wir können sie noch erfinden. Gewiss, soweit es sich um unser eigenes, ganz und gar individuelles Schicksal handelt, wissen wir, wie es ausgehen wird. Doch in der Zwischenzeit gibt es einiges zu tun, eine Menge Leben, dazu Widersprüche, Unsicherheiten, Irrtümer und Junckers, die überwunden werden müssen. Die Straße nach Europa ist entsetzlich lang. Bemühen wir uns, Optimisten zu bleiben. Ein bisschen Heiterkeit schadet nicht.
Mario Fortunato , 57, ist Schriftsteller. Er lebt in Italien und in Großbritannien. Aus dem Italienischen von Jan Koneffke.