Gegen Ende der "Winterreise", die Franz Schubert kurz vor seinem frühen Tod im Jahr 1828 komponierte, heißt es in dem unheimlich bewegenden Lied "Der Wegweiser": "Eine Straße muss ich gehen,/ Die noch keiner ging zurück."
Das Andante, die musikalische Bezeichnung für ein natürliches Schritt-Tempo, ist da längst in ein hoffnungsloses Dahinschleppen verwandelt. Wie besessen geht es, stolpernd zwar, aber ohne Pause, immer weiter ins Abseits. Schon lange vorher, im Eingangslied, war das Wandern keine Lust mehr gewesen, sondern bloß noch mühselig und notwendig, als Entfernung von einer aufgegebenen Liebe, der gerade noch, im Schwinden, ein paar letzte zärtliche, süße Töne nachgerufen wurden. "Sacht, sacht, die Türe zu!"
So geht das dann weiter - im vorletzten Lied singt der Wanderer zu choralartigen Tönen: "Im Dunkeln wird mir wohler sein". Dann kommt nur noch der "Leiermann", der Outlaw, der Straßenmusiker ohne Publikum, der immer nur wieder an seinem Instrument dreht und so einen schrecklichen Gedanken weckt: es könne nun, wo doch der Anfang bereits ein Abschied gewesen war, wo doch der Sänger gleich mit einer klagenden, absteigenden Schlussfigur begonnen hatte - es könnte nun alles wieder von vorne losgehen, ein endloser Zirkel ohne Erlösung: "Fremd bin ich eingezogen, / Fremd zieh ich wieder aus . . ."
Nur fünf Emotionen kontrollieren unser Gehirn? In der "Winterreise" sind es zigmal mehr
Warum soll man sich mit der "Winterreise" beschäftigen? Wenn das doch nur alles Tod und Düsternis ist? Nun, die Reisebeschreibung, die hier gegeben wurde, ist eben nur einer von vielen Wegen durch die "Winterreise". Schuberts damals völlig unerhörte Musik, die weder den Gedichtzyklus seines Zeitgenossen Wilhelm Müller, ein "balladeskes Wunderwerk" (Brigitte Kronauer), einfach nur banal "vertont" noch etwa den Sänger als einzigen Sinnträger einfach nur "begleitet", diese Musik erzeugt vielmehr mit ihrer ganz eigenen Sprache eine verblüffende Vielfalt von Stimmungen, Gefühlen, Sichtweisen, musikalischen Ideen. Dieser Nuancenreichtum ist es, der diesen Zyklus überhaupt erst so unerschöpflich und zeitlos zugänglich macht. Gewiss, hier übt auch eine "Sympathie mit dem Tode" ihren "Seelenzauber" aus, wie es in der Grammophon-Szene in Thomas Manns "Zauberberg" heißt (den Schallplattenspieler nennt der Sanatoriumsdirektor dort "die deutsche Seele up to date"). Aber wenn dies das einzige Thema bliebe und immer gleich ausgedrückt würde, dann wäre das Ganze sterbenslangweilig.
Die "Winterreise" - das sind vierundzwanzig von ungefähr 600 Liedern, die Schubert in seinen 31 Lebensjahren geschrieben hat - hat also auch in ihrer deutlich beschränkten Fröhlichkeit zigmal mehr Varianten der Empfindung zu bieten als jene fünf Emotionen, die laut dem aktuellen Pixar-Animationsfilm "Alles steht Kopf" in unseren Köpfen das Kommando haben sollen. Und deswegen sagt der schlaksige, kluge englische Sänger Ian Bostridge, der jetzt ein wundervolles Buch über die "Winterreise" geschrieben hat: "Vielleicht gibt es andere Wege, die Geschichte der Gefühle zu erforschen, aber sicherlich keinen, der eine solche Innerlichkeit und Kraft verspricht."

Für das Kunstlied, das in der deutschen Romantik wurzelt, ist es eine seltsame Situation heute. Auf der einen Seite pilgern Liebhaber auf der ganzen Welt zu Liederabenden und Schubertiaden; wenn Sänger wie eben Ian Bostridge oder Christian Ger-haher auftreten, sind große Säle in London, Madrid, Tokio oder München mehrere Monate vorher ausverkauft. All diese Fans wollen nicht einfach nur gerührt werden und sich ein wenig in Weltflucht üben (obwohl selbst diese Motive des Kunstgenusses nicht verächtlich behandelt werden sollten); es geht ihnen auch nicht in erster Linie um technische Virtuosität, um die Schauseite der Musik, sonst würden sie sich nur Opernarien mit irren Koloraturen anhören; sondern sie suchen gerade in Schuberts Liedern offenbar etwas Existenzielles, eine Weiterbildung von Herz und Verstand, ein reizvolles Wechselbad von Entfremdung und Identifikation, Schönheit und Schroffheit, Pathos und Witz: kleine Lehrstunden in, so sagt man heute, emotionaler Intelligenz.
Außerdem gibt es heute mehr gute Aufnahmen als je zuvor: In der Nachkriegszeit hatten allen voran Dietrich Fischer-Dieskau, aber auch Hermann Prey, Christa Ludwig oder Peter Schreier den Aufschwung von Aufnahmetechnik und Plattenindustrie dafür genutzt, das Liedrepertoire breiter zugänglich zu machen; und auch wenn so manches davon kaum zu übertreffen ist, kann man jetzt zwischen diversen weiteren, interessanten Einspielungen wählen: etwa von Matthias Goerne, Thomas Quasthoff, Christoph Prégardien oder auch Christine Schäfer und sogar Jonas Kaufmann (von dessen Winterreisen-Aufnahme indes dringend abzuraten ist). Das romantische Lied ist übrigens auch fürs digitale Häppchen-Hören viel besser geeignet als etwa eine Mahler-Symphonie.
Und doch, andererseits: Gegenwärtig ist das Kunstlied weiter denn je von seiner natürlichen Quelle abgeschnitten, dem Musizieren zu Hause am Klavier. Auch wenn sich die Liederzyklen, wie Ian Bostridge feststellt, ganz gut im Konzert bewähren, sind sie eigentlich fürs private oder halbprivate Singen gedacht, schon bei Schubert selbst, der in Wien in einem musisch-literarischen Freundeskreis lebte, der anders als Ludwig van Beethoven nie ein Konzert-Star war und der selbst von klein auf Hausmusik gemacht hatte.
Natürlich, es gibt heute noch viele Laienchöre und Enthusiasten, auch die Casting-Shows und Popstar-Träume gehören am Rande dazu; aber insgesamt ist gerade in Deutschland besonders viel passiert, um den Leuten das Singen zu vergällen. Die Gründe reichen von den Aufzeichnungsmedien über den Missbrauch im Nationalsozialismus und die Diskreditierung des Volksliedes bis zu Veränderungen in Erziehung und Schule. Das Singen, Urpraxis aller Kultur, droht zu verkümmern. Immer mehr Menschen überspielen ihre Armut an Musik damit, dass sie Gesang nur noch zum Kichern finden; einen Liederabend müssen sie dann natürlich erst recht als seltsam und lächerlich wahrnehmen. Da ist viel Distanz zu überwinden zu denen, die fast süchtig sind nach Liedern von Schubert bis Richard Strauss - bis man zumindest als Hörer spürt: Diese Musik lässt niemanden kalt, der sich darauf einlässt.
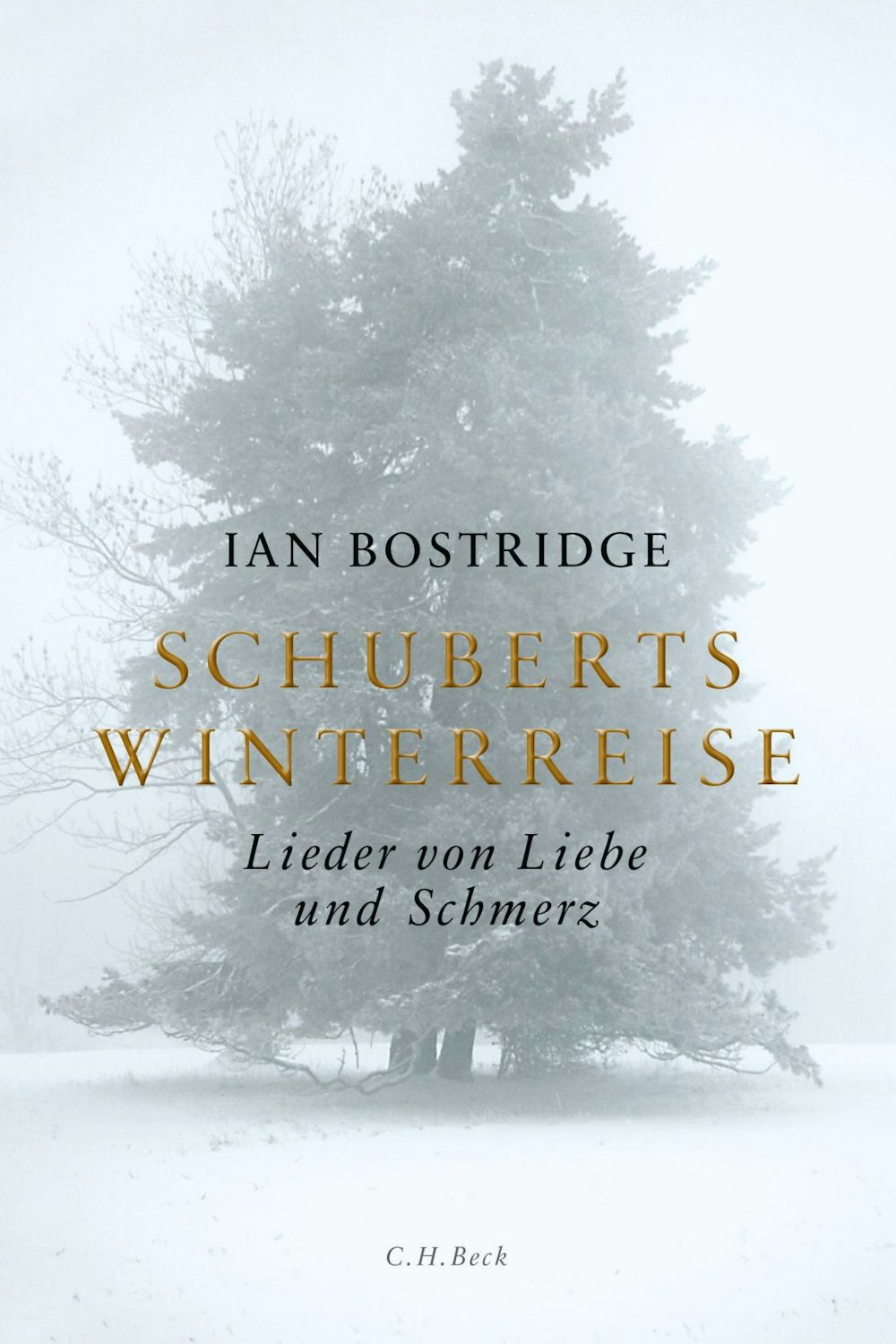
Das Posthorn schellt wie eine Nachricht auf dem Handy - leidet der Wanderer an Burn-out?
In dieser Lage nun kommt das Buch von Ian Bostridge wie gerufen. Seine Verehrer werden es ohnehin verschlingen und auch viel Neues lernen; und wer erstmals herangeführt werden will, wird staunen, wie viele Assoziationen und Einstiegsmöglichkeiten er bietet. Der "Leiermann" wird da mit Bob Dylans "Tambourine Man" verglichen; die Akkorde in dem Lied "Der greise Kopf" mit den Clustern, wie sie gerne in der Hintergrundmusik von Horrorfilmen eingesetzt werden. Und am Posthorn im Lied "Die Post" erklärt Bostridge, wie das scheinbar entrückte romantische und biedermeierliche Horn-Motiv hier im Gegenteil die gerade erst eingeführte Schnellpost aufruft, also die kommerzielle Kommunikations- und Transport-Revolution des 19. Jahrhunderts - Verspätungen der Postkutschen wurden nun nicht mehr in Stunden, sondern in Minuten angegeben, und die Wirkung der Posthorn-Töne vergleicht Bostridge mit dem Rausch durch Oxytocin-Ausschüttung, den heute eine neue Nachricht auf unseren Handys auslöst.
Leidet der Wanderer der Winterreise an Burn-out? Nein, die Assoziationen, die Ian Bostridge anstellt, werden nie zu platt, und er betont die Offenheit der Interpretation. Bostridge ist promovierter Historiker, er beschäftigt sich mit der "Winterreise", seitdem er sie vor dreißig Jahren erstmals in einem kleinen Konzert in seinem College in Oxford vorgetragen hat. Er schreibt klug und geschmeidig, und wie mühelos flicht er allerlei Interessantes ein, zu Schuberts Leben und Zeitgeschichte, Komposition und Aufführungspraxis (auch der eigenen natürlich), zur Natur und Metaphorik der Eisblumen, des Lindenbaums, der Irrlichter und der Krähen. Bostridges Belesenheit ist beachtlich, aber nie angeberisch. Man erfährt auch, dass Schubert auf dem Sterbebett "Der letzte Mohikaner" gelesen hat - biografische und politische Bezüge werden immer wieder hergestellt, aber nie zum einzigen Schlüssel erklärt.
Das Buch ist Lied für Lied gegliedert, und man sollte beim Lesen natürlich kapitelweise eine Aufnahme der "Winterreise" dazu hören. Etwas Schöneres kann man in diesem Herbst und Winter kaum tun.