Es gab einmal eine Dritte Welt. Sie lag meistens im Süden und verdankte ihren Namen einer Übertragung der Formel vom "Dritten Stand" auf die Weltpolitik. In den Sechzigern war sie aus der Idee der Blockfreiheit hervorgegangen. Sie war wirtschaftlich leicht zu identifizieren als jener Teil der Erde, in dem der größte Teil der Bevölkerung im Elend lebte, in dem die Menschen Analphabeten waren und die Reichen ihr Geld in die Schweiz trugen.
Geographisch gehörten seit den frühen Sechzigern fast alle afrikanischen Länder zur Dritten Welt, dazu große Bereiche von Asien und Lateinamerika, und während sich diese in lauter Nationalstaaten von oft zweifelhaftem Zusammenhalt teilte, behaupteten sich diese oft nur, weil entweder die eine oder die andere der beiden Großmächte den jeweiligen Staat zu seiner Einflusssphäre rechnete.
Diese Dritte Welt gibt es nicht mehr. Zuerst teilte sie sich in Entwicklungsländer und Schwellenstaaten, bald danach, mit dem Untergang des sowjetischen Imperiums und dem wirtschaftlichen Aufstieg Ostasiens, verschwand sie ganz. Was zurückblieb, sind Entwicklungsländer ohne Entwicklung wie Mali, Eritrea, Somalia. Sie liegen vor allem in Afrika, seit einigen Jahren auch im Nahen Osten. Ersetzt wurde die Kategorie "Dritte Welt" durch das Wort vom "Süden" oder vom "globalen Süden" - von wem, das lässt sich kaum mehr herausfinden. Waren es schon die Mentalitätshistoriker mit ihrer Vorstellung von der "Méditerranée"? War es die Weltbank, die das Wort zuerst im Jahr 1980 benutzte? Oder waren es doch erst die Kulturanthropologen und die Anhänger der "postcolonial studies"?
"Mediterranée" - das klingt nach Palmen und Sonne, aber auch nach Arbeitslosigkeit und Elend
Der Begriff unterscheidet sich von der "Dritten Welt" zunächst dadurch, dass er nichts Politisches mehr bezeichnet, sondern etwas vage Geografisches. Zum "Süden" gehört Italien jenseits von Rom, er liegt in Griechenland und in Libyen, er erstreckt sich von Mali über Indien bis nach Neu-Guinea. Es gibt gewaltige Unterschiede zwischen den Regionen und Ländern des Südens. Die einen sind Teil noch der reichsten Nationen, die anderen bilden die schlimmsten Armutszonen der Welt.
Gemeinsam ist ihnen, dass die dort ansässigen Volkswirtschaften deutlich weniger Reichtum akkumulieren, als das in industrialisierten Gegenden der Fall ist. Zugleich aber verbirgt sich in der Idee des Südens, als "Theory of the South" oder "Southern Theory" gefasst, die emanzipatorische Vorstellung einer eigenen Welt - oder besser: eigener Welten -, die ihre eigenen Identitäten besitzt, sich in zunehmendem Maß der politischen, ökonomischen und kulturellen Hegemonie des Nordens entzieht und für sich selbst sprechen kann.
Aber der "Süden" ist auch eine Gegend der Gewalt, eine Region, in der Nationalstaaten zusammenbrechen und Millionen von Flüchtlingen freisetzen, die dann nach Norden streben. Und ist der "Süden" nicht auch die "Méditerranée", warm und palmengesäumt, aus der jene jungen Leute kommen, die, arm und arbeitslos, den vergreisten Nordländern in ihrem sterilen Wohlstand neue Sitten beibringen werden - so wie es die Organisatoren der europäischen Kulturhauptstadt Marseille vor vier Jahren angekündigt hatten (die Vorhersage ist bislang nicht eingetroffen)?
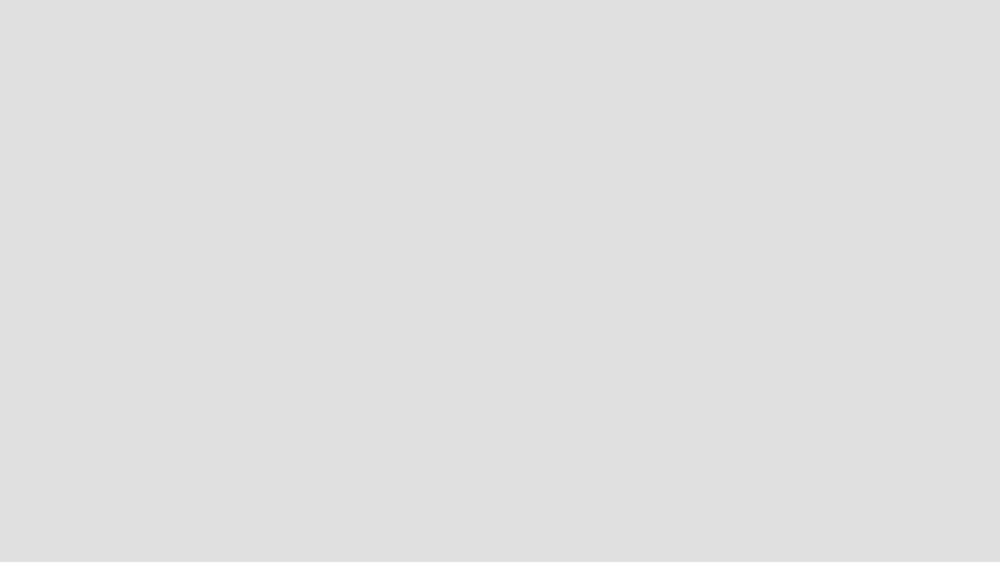
Je mehr sich die Visionen von Barbarei und paradiesischen Zuständen im Wort vom "globalen Süden" vermischen, je mehr Kulturtheorie und Identitätslehren sich daran heften lassen, desto untauglicher wird er als politischer Begriff. Im gleichen Maße aber scheint er um so interessanter für die Bildende Kunst und ihren Betrieb zu werden. Eine ganze Weltgegend liegt der Kunst vor Augen, in unendlicher Vielfalt und mit einem unendlichen Bedarf an Öffentlichkeit. Man kann sich um sie kümmern - oder fachlich ausgedrückt: man kann sie "kuratieren" -, während einem nicht nur das Weltgewissen verlässlich zur Seite steht, sondern auch eine praktische Dringlichkeit: Es gibt schreckliche Dinge zu berichten.
An einem zentralen Ort der Biennale in Venedig betreibt der isländische Künstler Ólafur Elíasson eine Manufaktur, in der Flüchtlinge aus dem Süden mit einfachen Mitteln grüne Leuchten herstellen. Grün leuchten die Ampeln, wenn man gehen oder fahren darf. Und grün sollen sie offenbar nicht nur auf den Wegen der Flüchtlinge leuchten, sondern auch auf jenen der Kunst, wenn sie den Flüchtlingen wie sich selbst die Richtung weisen, dorthin, wo man etwas Besseres als den Tod findet.
Der "Süden", der hier installiert wurde, ist eine Vorstellung von Weltverbesserung, in die Lebenspraxis des einzelnen Menschen umgesetzt. Er ist es im selben Sinn, wie der Flüchtling für viele Menschen hierzulande zu einer "Vision von politischer Praxis" wurde, wie es der Publizist Magnus Klaue in einem polemischen Essay über den "Gegensouverän" in der Zeitschrift Bahamas (74/2016) formulierte.
In beiden Fällen kommt es nicht darauf an, die Gründe des Elends zu bestimmen, deren Erfahrung der Flucht vorausging. Das Engagement erfüllt sich, wenn man auf das Leben in seiner Qual und in seiner Schönheit verweist - und Barmherzigkeit zeigt, an einem ausgewählten Ort und für gewisse Menschen. Man schaut sich die Dinge an, und eben weil sie als Kunst erscheinen, darf man glauben, man habe sich deswegen schon mit ihnen "auseinandergesetzt". In der Subsumierung aller politischen und ökonomischen Gegensätze unter ein kulturgeografisch bestimmtes Schicksal erweist sich der "Süden" als eher zweifelhafte lebensphilosophische Metapher. Es bedurfte der Kunst, um sie, nachdem Politik und Wissenschaft eher zögerlich mit dieser Kategorie umgegangen waren, in aller Öffentlichkeit zu etablieren.
Die Kunst spricht für die Armen und Erbarmungswürdigen. Aber was geschieht danach mit ihnen?
Dieses Verfahren hat offenbar System: Von der Bankenkrise und deren Folgen für Griechenland sprach Adam Szymczyk, der künstlerische Leiter der Documenta 14, als er von einem Jahr das Programm seiner Veranstaltung in der ersten Ausgabe einer Zeitschrift namens South niederlegte, einem Athener Kunstmagazin, das die Documenta 14 zur Vorbereitung der Ausstellungen für vier Ausgaben übernommen hatte. In seinem Text ist von Flüchtlingen die Rede, vom Elend in Syrien bis zur Subsahara, und bei der Kolonialgeschichte der Insel Réunion sind die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschritten. Die Schau, versprach Adam Szymczyk bei dieser Gelegenheit, sei eine "aktuelle Antwort auf die sich verändernde Lage Europas" - deswegen wurde sie in diesem Jahr ja um ein Geschwister in Athen erweitert. Sie werde über "verschlissene Vorstellungen von Territorium, Staat und Identität" hinausgelangen, kündigte der Kurator an, bis an die Grenzen des "Unaussprechlichen" und darüber hinaus.
Was aber ist diese "Antwort"? Was sind "worn-out ideas"? Wer hat sie kaputtgemacht und warum? Szymczyk bleibt die Begründungen schuldig, und die Antworten des Heftes bestehen im Zeigen von Bildern und im Erzählen von Geschichten. Mit der "Dritten Welt" hätte man schwerlich so umgehen können: Auf der Ausstellung "Postwar", die im vergangenen Jahr im Münchner Haus der Kunst gezeigt wurde, konnte man auch sehen, mit welchem Ernst sich Künstler aus Südamerika, Afrika und Asien an Kunst und Politik der "Ersten" und "Zweiten" Welt abarbeiteten.

Schaut man sich nun um, wie der "Süden" gegenwärtig auf den großen Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst präsentiert wird, stößt man auf höchst unterschiedliche Gegenstände. Einheitlich sind sie in der Inszenierung von Betroffenheit. Für Südafrika treten auf der Biennale in Venedig in einer Installation von Candice Breitz die Schauspieler Julianne Moore und Alec Baldwin auf, die Geschichten von sechs Flüchtlingen erzählen. Der brasilianische Künstler Ernesto Neto lässt einen Stamm vom Amazonas seine Rituale aufführen. Auch die dunklen Figuren, die sich Anne Imhof im deutschen Pavillon unter Glasscheiben winden lässt, sind vermutlich unglückliche Gestalten aus einem universalen Süden. Der Brite Hew Lock lässt im "Diaspora Pavillon" Modelle vergammelter Schiffe von der Decke hängen, die Bilder von Vehikeln der Flucht beschwören. Und so geht das weiter: Eine Gemeinschaft von prämierten Repräsentanten des Negativen und Erbarmungswürdigen scheint von großer Kunstausstellung zu großer Kunstausstellung zu ziehen, von Land zu Land. Sie erhält sich dadurch, dass jemand für sie bezahlt (meist sind es die Staaten, unter deren Namen die Künstler antreten): als Vertreter von Kunst.
Überhaupt hält, wie schon bei den vorhergegangenen Biennalen, die Figur des Flüchtlings viele der diversen Anliegen zusammen. Fragt man jedoch einmal genauer, was denn in dieser oder jener Gegend und mit diesen oder jenen Menschen geschehen soll, nachdem die Kunst für sie gesprochen hat, stößt man kaum auf konkrete Forderungen, geschweige denn auf theoretische Einsichten, gar eine Erklärung der Ereignisse, die eine Landschaft so verwandelten, dass man sie in großen Scharen verlassen muss.
Stattdessen kehren immer wieder dieselben Postulate wieder. Sie alle klingen, auf die eine oder andere Art, wie der Titel der Ausstellung von Zimbabwe: "De-Constructing Boundaries. Exploring Ideas of Belonging" - "Grenzen de-konstruieren. Vorstellungen von Zugehörigkeit erforschen". Solche Programmerklärungen könnten von einer beliebige humanitären Organisation erfunden sein. Sie laufen auf einen Ablasshandel im Diesseits hinaus.
Es ist nicht so, dass die Ereignisse, von denen diese Kunst handelt, nicht furchtbar wären, im Gegenteil. Doch bedeutet die Verwandlung eines solchen Ereignisses in Kunst offenbar, dass man sich einer moralischen Form der Mitteilung unterwirft, die von der Kunst vorgegeben wird. Sie ist im Bild des grünen Lichts gefasst: Wenn es leuchtet, darf jeder Künstler zeigen, was den Menschen aus dem "Süden", als deren Anwalt und Coach er auftritt, angetan wurde. So entsteht eine Völkerschau, die um so zweifelhafter ist, als sie das Gegenteil einer Völkerschau sein soll.
Am südwestlichen Ende der Via Garibaldi, an einer Stelle, an der jeder Besucher der Biennale vorbeikommen muss, betreibt der nordafrikanische Staat Tunesien einen Kiosk, an dem die Besucher den Pass eines imaginären Staates beantragen können. Selbstverständlich erhält jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, wer immer auch will, diesen Pass. Es steckt ein kritischer Gedanke in diesem Kunstprojekt: dass nämlich jeder Mensch, der eine Grenze überqueren will, sich von einem lebendigen Wesen in ein Rechtssubjekt verwandeln muss. Das aber kann er nur sein, wenn er Bürger eines Staates ist. Zugleich verbirgt sich auch in diesem Unternehmen eine Anmaßung: Sie besteht darin, dass sich die Kunst offenbar für die Instanz hält, in der alle nationalen, politischen und ökonomischen Beschränkungen aufgehoben werden - gerade weil sie von allen konkreten Bestimmungen absieht.
So entsteht der Widerspruch, dass die Kunst im "Süden" zwar das lebendigste Leben erreicht zu haben glaubt, im Grunde genommen aber die Kunstverehrung vergangener Zeiten reproduziert (abgesehen davon, dass eine Nation der Nationen eine widersinnige Veranstaltung ist). Anders gesagt: Wir erleben die Rückkehr der Trias vom "Wahren, Schönen, Guten" unter den Voraussetzungen von Globalisierung, Gewalt und Konzeptkunst.