Unsere Rhythmustherapie ist gerade zu Ende. Nicht etwa die 40-Minuten-Behandlung, also die Siebte, sondern das etwas schlankere 25-Minuten-Paket, die Achte Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Fröhliche Stromstöße haben uns erfrischt und aufgewühlt, alles war herrlich "optimistisch und spielerisch" - so eine typische Konzertankündigung im Radio. Wie versprochen gab es eine ordentliche Packung Virtuosität und Titanentum, dazu noch eine Dosis wienerische Eleganz und Witz. Eine Wucht!
Und jetzt lesen wir nach in der neuen Beethoven-Biografie von Martin Geck, was wir da eigentlich erlebt haben. Das war überhaupt nicht heiter, erfahren wir, sondern voller Sarkasmus, "eine Abrechnung mit sich selbst, ein Protest gegen das eigene sinfonische Ideal". Diese scheinbar muntere, ja überdrehte Achte in F-Dur sei in Wahrheit "selbstzerstörerisch nicht, was die Integrität der eigenen Persönlichkeit betrifft, jedoch im Umgang mit dem enthusiastischen Überbau des eigenen Schaffens: Nachdem dieser im Finale der Siebten bereits vom Ethischen ins Orgiastische verschoben worden ist, wird er nunmehr geradezu demoliert."
Dann hört man das noch mal ganz anders: "Hier spricht ein desillusionierter Idealist", schreibt Martin Geck in seiner Deutung, die ein früheres Buch von ihm, das nur den Sinfonien Beethovens gewidmet war, aufgreift. Aber natürlich, wie konnte der gewöhnliche Liebhaberhörer denn nur vergessen, auch die 8. Sinfonie in den Übergang zum Spätwerk einzubeziehen? Es ist 1812, als er sie fertig schreibt, Beethovens sogenannte "heroische" Epoche ist vorbei - trotz der Begeisterung der Wiener für sein krachendes Gelegenheitswerk "Wellingtons Sieg" im darauffolgenden Jahr, und trotz der gigantischen Aufbäumung, die mit dem Freuden-Schlusschor der Neunten noch einmal folgen wird.
Der Komponist verabschiedet in dieser Zeit endgültig sein Gehör, seine öffentlichen Auftritte als berühmter Pianist sowie die ominöse "unsterbliche Geliebte". Er ist ein Held der Musik in Wien und Europa, er kann hohe Honorare bei Verlegern und Auftraggebern verlangen, zugleich wird er immer wieder - der angebliche Schutzpatron aller bürgerlichen, freischaffenden modernen Künstler - von adligen Gönnern durchgefüttert. Aber ihn plagt ein kranker Körper, und dass er bei den Frauen kein Glück hatte. 42 Jahre alt ist er, 56 wird er noch werden. Schon zehn Jahre zuvor, im Krisenbekenntnis des "Heiligenstädter Testaments", hatte er notiert: "Mit einem feuerigen Lebhaften Temperamente gebohren selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, muste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen." Was allerdings nicht bedeutet, dass das romantisch-tragische Klischee vom ständig mürrischen, abweisenden Genie immer zuträfe - 1816 notiert eine Gastgeberin im Tagebuch: "Sein neckisches Wesen, die kleinen witzigen Ausfälle, sind so originell als Mensch wie als Musikdichter."
Beethoven schreibt im selben Jahr der Achten Sinfonie, 1812, die zarte, abgeklärte letzte Violinsonate, und er macht sich bald auf zu den späten Klaviersonaten, deren Botschaft lautet, so Geck, "nicht Sieg, sondern Ergebung, und der Weg dorthin wird weniger erstritten denn erlitten". Es gehe am Ende nicht mehr um die Menschheit, sondern um den Menschen. Weiß man das, wird nun die vermeintlich harmlose, zackige, "klassische" Achte zu einem Abschied vom Schwung der Revolutionszeit, von der "Eroica", von der Orchester-Emphase - und zwar durch Übersteigerung; und im selben Moment wird sie auch schon zu einer Vorahnung der Unerbittlichkeit, mit der im Spätwerk Motiv-Fetzen wiederholt, versetzt und gegeneinander gewirbelt werden, jedenfalls in den wilderen Sätzen, inmitten einer erschütternden Gelassenheit. Dann denkt man - das ist jetzt allerdings schon übersteigerter Martin Geck - vielleicht sogar weit voraus an den zweiten Satz des allerletzten Streichquartetts (ebenfalls F-Dur, op. 135), wo sich alles Melodische in Sinn-Fragmente und rhythmische Gesten auflösen wird. Oder zurück ans stürmischere, schroffe "Quartetto serioso" (op. 95) von 1810, das Beethoven offenbar als Privat-Studie für sich selber schuf.
Dies war jetzt nur ein einziges Beispiel, an dem Geck, bedeutender Musikforscher und erfahrener Komponistenbiograf, zeigen kann: Man muss Musik erleben, praktizieren, erfühlen - aber es ist doch ein Riesengewinn, sie auch im Gesamtwerk und in ihrer Zeit zu verstehen. Und dazu braucht es nicht unbedingt minutiöse formale Analysen, obwohl Notenlesen natürlich immer schlauer macht; sondern in einem allgemeinverständlichen Buch wie diesem geht es auch oft übers Hinhören und über die geistige Annäherung.
Zentrales Anliegen dieser Biografie - und länger schon seines Autors - ist es, gegen zwei puristische Ängste zu argumentieren. Die erste scheut den "Biografismus", also die plumpe Begründung von Werken mit Ereignissen und Gefühlen im Leben des Künstlers. Die zweite Angst gilt der ebenso plumpen Suche nach weiteren "Inhalten" in der Musik, politischen, poetischen und sonstigen. Dagegen steht das seinerseits sehr voraussetzungsreiche Ideal der "absoluten Musik". Es geht damit auch um den Einfluss des musikwissenschaftlichen Übervaters Carl Dahlhaus (1928-1989). Dieser schrieb etwa in seinem Beethovenbuch von 1987: "Der Triumph der Analyse besteht in dem Nachweis, dass ein Werk, zumindest ein geglücktes, nicht anders sein kann als es ist."
Eine strikte Scheidung von Form und Gehalt führt nicht weit
Das aber ist, folgt man Martin Gecks Ansatz, offenkundiger Unsinn, weil es in hermeneutische Zirkel führt: Die formale Interpretation einer Komposition droht zu bestätigen, was sie von vornherein bestätigt haben wollte. Geck hingegen verteidigt überzeugend die inhaltliche Interpretation, sofern sie denn die Plumpheit weglässt, die Tonsetzerkunst im Einzelnen nicht geringschätzt, reflektiert vorgeht und den Missbrauch durch die Rezeptionsgeschichte kennt - den Beethoven-Kult.
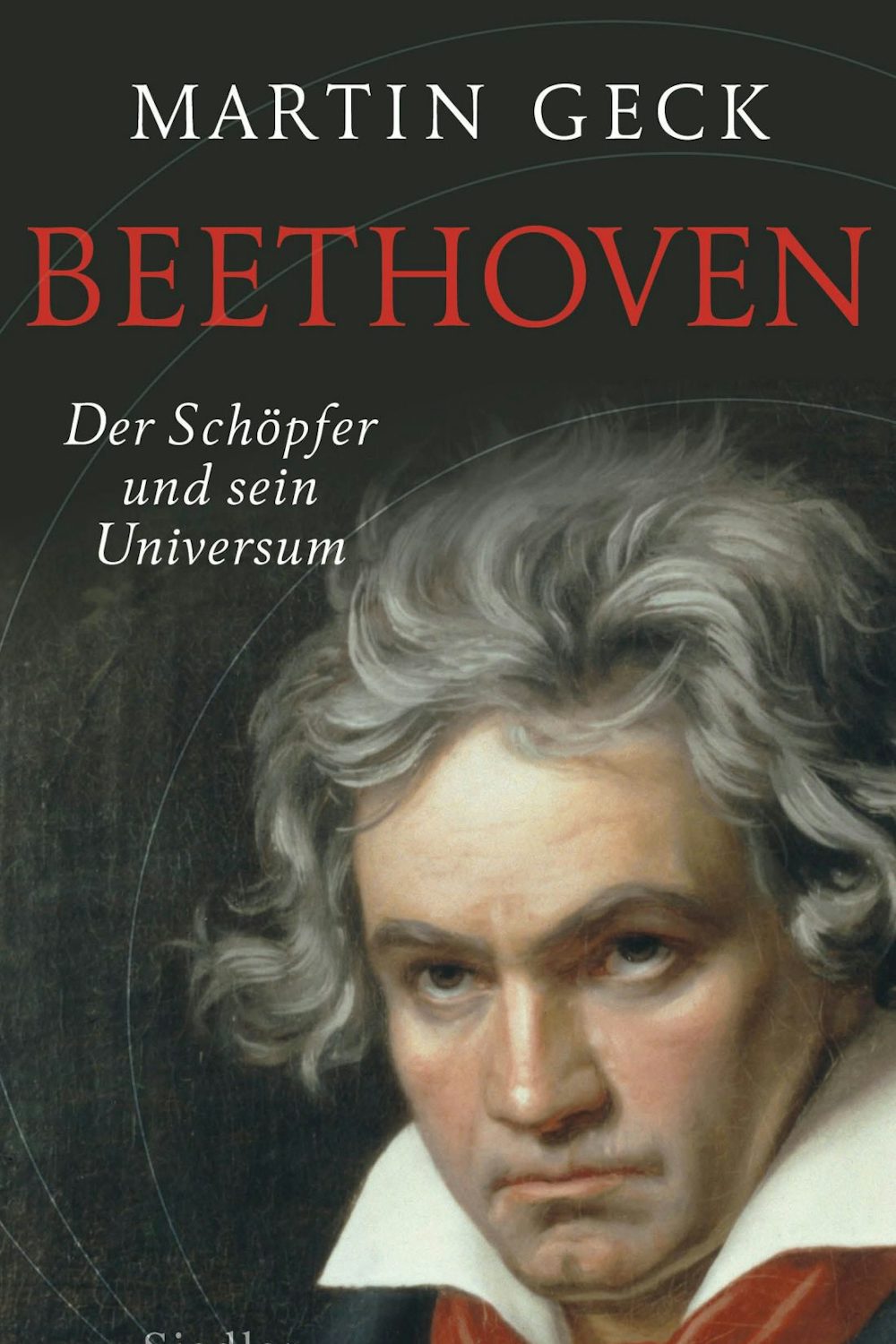
Das heißt für Martin Geck: Oft lässt sich weder die "kritische Einheit von Leben und Kunst" trennen, noch kann man bei einem Komponisten, der die Konvention nutzt und zugleich von innen sprengt, das Gedankliche, Gestische, Dichterische übersehen, auch wenn, wie in den meisten Fällen, klare "außermusikalische" Hinweise fehlen. Das jeden Hörer fesselnde Eigenleben von Beethovens Werken verliert dadurch ohnehin nicht seine Autonomie, aber "eine strikte Scheidung von Form und Gehalt führt (...) nicht weiter, denn eins teilt sich in dem anderen mit."
Sollte das zu abstrakt klingen, so ist es Gecks "Beethoven" gerade nicht. Er spielt es an einer Reihe von Stücken durch, von der "Pastorale" bis zur "übercodierten" Missa solemnis. Überall findet man Schönheit, aber keine interesselose. Und das Buch ist nach "themenzentrierten Expeditionen" anhand von anderen Geistesgrößen, Dichtern, Musikern und Kritikern angelegt. (Wer eine konventionellere, chronologische Biografie lesen will, greift zu der von Jan Caeyers von 2012 oder zu Martin Gecks eigener rororo-Monografie.) Zum Beispiel wird die "Sturm"-Klaviersonate in Beziehung gesetzt zu Shakespeare selbst, zu Rousseau, Hölderlin, Friedrich Schlegel und Claude Lévi-Strauss.
Der Autor hat viel gelesen, macht aber auch etwas sehr Lesbares daraus. Wir treffen Beethoven in einzelnen Lebensszenen, vor allem aber im Gespräch mit verehrten Vorgängern wie Bach und mit unter Einflussangst stehenden Nachfolgern wie Robert Schumann. Wir versuchen die Musik zu durchdringen mit den großen Interpreten und mit Philosophen bis zu Gilles Deleuze. Und, klar, Theodor W. Adorno darf Thomas Mann in Kalifornien auch noch mal die späten Sonaten vorspielen. Ob alle Bezüge hinhauen, ist nicht der Punkt, entscheidend ist das intellektuelle Verfahren. Martin Geck hat hier selbst ein nachdenkliches, waches Spätwerk geschaffen. Liest man es, ist man mit Beethoven nicht fertig, sondern fängt (wieder) mit ihm an.