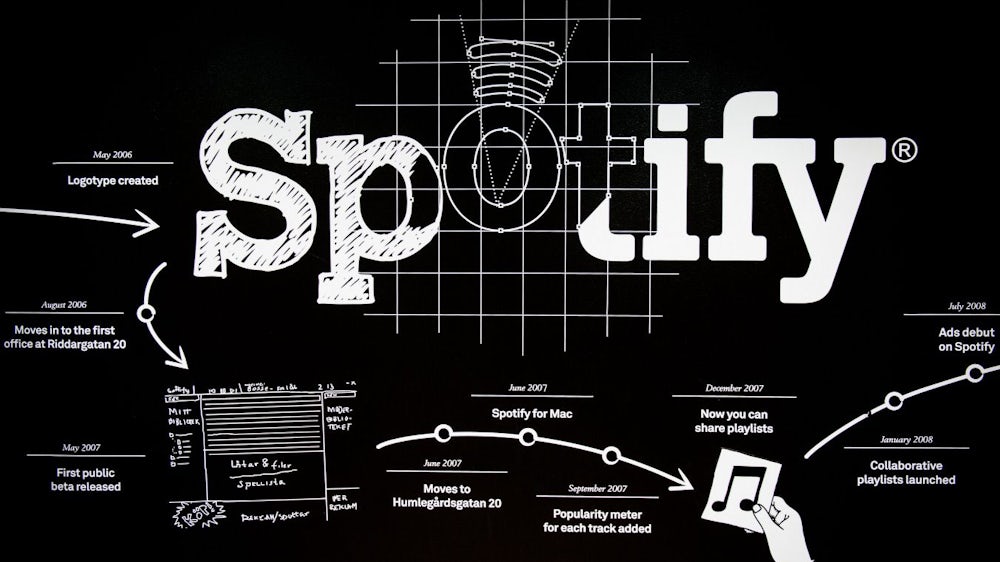Drei Menschen, deren Job, nein, deren Leben Musik ist. Der eine, Sebastian Schreiner, Manager des Jazzlabels enja, sitzt in seinem Lagerraum. Hinter ihm stapeln sich CDs auf hohen Regalen. Dunkel ist es hier. Sebastian Schreiner starrt auf einen leuchtenden Bildschirm, darauf blinken Diagramme und Zahlenkolonnen. Es geht um Absatz und Umsatz. Die Kurven zeigen nach unten. Er sagt: "Darum geht es ja gerade, und jetzt fängt auch noch Apple mit dem Streaming an." Das klingt wie ein Seufzer. Denn so viel ist klar: Streaming ist ein Wachstumsgeschäft, das so, wie es heute funktioniert, kleinen Labels und Künstlern nimmt, was sie zum Leben brauchen: eben Umsatz und Absatz. Und gerade hat Apple angekündigt, in das Geschäft einzusteigen.
Hörer haben den Jazz des Münchner Labels immerhin eine Million Mal abgespielt
Ein paar Hundert Kilometer südwestlich stromert Memo Rhein durch Schweizer Vororte. Rhein hat einst die Spider Murphy Gang erfunden (wie er sagt), und dann lange klassische Musik produziert. Heute ist er eine Art Privatdetektiv in eigener Sache, er sucht im Netz und in der realen Welt nach Menschen, die zum Beispiel bestimmte Aufnahmen von Violinsuiten von Rachmaninoff hochgeladen haben. Rhein hat da was dagegen. Er hält nämlich die Rechte an diesen bestimmten Aufnahmen. Das Geld, das die Menschen verdienen, die die Musik hochgeladen haben, gehört eigentlich ihm. Doch seine Gegner verwenden erfundene Namen, Adressen, Biografien.
Einmal steht er in der Schweiz vor einem Stadttheater, dessen Adresse die mutmaßlichen Betrüger als Firmensitz angegeben haben. Während er durch die Straßen läuft, hat er die Finger stets am Handy. Rhein streitet sich um Verträge, Geld und Rechte mit vielen, darunter auch mit dem Medienkonzern Sony, mit dem Google-Unternehmen Youtube und mit Spotify.
Den Dritten, Mathias Modica, kennen Freunde elektronischer Musik vor allem unter seinem Künstlernamen Munk. Der DJ ist Chef des Labels Gomma in München. Modica freut sich in diesen Tagen über einen Text des Schweizer Journalisten Gregi Sigrist, Titel: "Musikstreaming ekelt mich an." Streaming. Deshalb rennt Memo Rhein durch die Schweiz, deshalb seufzt Schreiner , deshalb flüchtet sich Modica in die Ironie.
Wenn Menschen Musik über Streaming hören, bleibt die Musik auf den Servern der Streamingfirmen und wird nur temporär auf das Handy, den iPod, das Tablet oder den Computer des Nutzers geladen, gestreamt eben. Hörer müssen sich nicht um den Speicherplatz für Musikdateien kümmern. Und sie wählen aus dem riesigen Angebot der Streamingdienste aus.
Deshalb nutzen immer mehr Menschen Dienste wie Spotify, um Musik zu hören. Interne Daten von Spotify zeigen, dass alleine diese Firma in Deutschland fast eine Million Kunden hat. Allerdings zahlen nur sechs Prozent davon eine Abogebühr. Der Rest nutzt eine abgespeckte Version des Dienstes gratis. Apropos gratis: Viele Menschen rufen einfach das Videoportal Youtube auf und hören sich Musik dort an. Auch das ist Streaming.
Bei Youtube arbeitet man daran, bald auch kostenpflichtige Inhalte anzubieten. Spotify, Youtube, Apple und ihre Konkurrenz schalten neben der Musik, die sich ihre Nutzer anhören können, Werbung. Das bedeutet, die Firmen haben maximal zwei Einnahmequellen: Werbung und - falls vorhanden - Abogebühren. Anders als bei verkaufter Musik, bei der der Kunde pro Titel oder Album bezahlt, wächst beim Streaming der Umsatz der Anbieter nicht mehr bei jedem Lied, das angehört wird, sondern nur bei jeder Werbung, oder bei jedem neuen Kunden, der eine monatliche Gebühr entrichtet.
Von diesen Einnahmen der Streamingdienste gehen dann zunächst ihr eigener Gewinn und ihre Betriebskosten ab. Was dann noch übrig bleibt, erhalten die Vertragspartner der Streaming-Anbieter, große Label oder Gesellschaften, die die Rechte an verschiedenen, oft Hunderttausenden Musikstücken verwalten und die aus diesen Titeln Pakete schnüren. Man nennt diese Firmen Aggregatoren. Bei Youtube heißt es, man zahle stets mehr als 50 Prozent der Einnahmen aus. Spotify beteuert, die Firma gebe "circa 70 Prozent der Einnahmen an die Musikindustrie ab" und habe allein im ersten Quartal 2015 mehr als 300 Millionen Dollar ausgezahlt. Überhaupt hält sich die Streamingindustrie für die Rettung der Musikbranche vor den Raubkopierern. Und ist das nicht auch viel Geld, das sie ausbezahlen? Ist es nicht. Spotify hat 300 000 Verträge mit Rechteinhabern.
Die nehmen sich, als nächstes Glied der Kette, dann auch noch ihren Teil. Erst dann kommen die Labels an die Reihe, also zum Beispiel Sebastian Schreiners Plattenfirma enja. Und dann, nachdem sich die Label ihren Teil vom Kuchen genommen haben, der zu diesem Zeitpunkt oft nur noch aus Brosamen besteht, sind die Künstler dran. Dabei dauert es oft Monate, bis das Geld schlussendlich an seinem Ziel ankommt. Und mit jedem Schritt wird intransparenter, wer sich wo bedient hat.
60 Prozent der Deutschen bezahlen überhaupt kein Geld für Musik
Auf Schreiners Bildschirm sind Abrechnungen zu sehen. Kunden haben in ein und demselben Zeitraum 10 000 Lieder seines Labels gekauft und eine Million Mal Titel gestreamt. Die Verkäufe stehen mit etwa 7000 Euro Einnahmen im Buch. Die Streams, 100 Mal mehr an der Zahl, mit weniger als der Hälfte, mit rund 3000 Euro. Das sind 0,0025 Euro pro Streaming-Vorgang. Absurderweise ist das, wenn man sich so umhört, wenigstens im Vergleich, gar nicht so schlecht. Parallel zum Geld machen sich Abrechnungen auf den langen Weg von den Streaming Diensten zu den Labels und Künstlern. Das sind endlos lange Excel-Listen. Viele enthalten Zehntausende Positionen, je eine pro angebotenem Titel. Und oft genug fangen die Umsätze pro Titel mit 0,0000000 an. So wenig ist Musik wert in diesem System. Das lohnt sich selbst für Superstars nicht immer. Künstler wie Taylor Swift und Pharrell, die millionenfach gehört werden, haben sich über die lächerlichen Einnahmen aus den Streamingdiensten beschwert. Allerdings haben sie Medienkonzerne im Rücken. Und die haben offenbar sehr viel bessere Verträge mit den Streamingdiensten als die kleinen Anbieter. Die kämpfen gerade ums Überleben in der neuen Streaming-Welt. Aber sollen sie das überhaupt?
"Ich glaube nicht, dass Künstler in Zukunft nur von Spotify-Einnahmen leben müssen - CDs, Downloads, Tickets und Merchandising bleiben ja weiterhin als wichtige Einnahmequellen bestehen", sagt der Pressesprecher von Spotify. CDs und Downloads, damit man das richtig versteht, sind exakt jene zwei Einnahmequellen, die Spotify gerade abschafft.
60 Prozent der Deutschen bezahlen laut der Gesellschaft für Konsumforschung überhaupt kein Geld für Musik. Was Merchandising und Tickets betrifft, sagt Modica, sei es so, dass Labels, "um einen Künstler aufzubauen," an diesen Einnahmen mitverdienen müssten: "Und somit werden die Künstlerverträge noch härter als sie eh schon im Laufe der Digitalisierung des Musikgeschäftes werden mussten."
Die Frage ist jetzt, was kleine Labels und Künstler denn tun können. Sich dem Streaminggeschäft ganz zu verweigern, würde in Anbetracht steigender Nutzerzahlen bedeuten, die Zukunft zu negieren. Modica und Schreiber ziehen es vor, die Streaming-Dienste als Marketing zu nutzen, wie eine Werbefläche. Schreiner lässt seine Kunden einige Titel streamen, aber wer ganze Platten seiner Künstler hören möchte, der soll sie an anderer Stelle bitte kaufen.
Bei einem Mann wie Memo Rhein löst man mit Fragen nach der Zukunft eine Lawine aus. Wer ihm zuhört, begreift, warum. Youtube, Spotify und künftig wohl auch Apple verhandeln nämlich maximal mit den Plattenfirmen großer Konzerne wie Sony Music, ansonsten nur mit Aggregatoren. Künstler und kleinere Labels werden nicht einmal wahrgenommen. Rhein zeigt gerne unbeantwortete E-Mails an Youtube und Spotify, alle mit sinnvollen Ideen und konstruktiven Vorschlägen.
Kontaktverweigerung und Funkstille scheinen ihm Teil eines größeren Plans zu sein, denn Rhein erfährt auch nicht, wie das Geld auf dem Weg von den Streamingdiensten zu ihm versickert. Nur dass es versickert, erscheint ihm offensichtlich. Er rechnet vor, dass ihm aus den Leistungsschutz- und Urheberrechten seiner Musik auf Youtube bis zu 28 000 Dollar pro Monat zustünden. Tatsächlich erhalte er von Sony, das zwischen ihn und Youtube geschaltet ist, nur Hunderte bis wenige Tausend Dollar. Dabei seien die Abrechnungen so ungenau, dass es unmöglich sei zu erfahren, wo das Geld abgeblieben ist. Dem gegenüber stehen in Rheins Kalkulationen Kosten für die betreffenden Studioproduktionen. Summen im Millionenbereich.
Sony war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, allerdings zeigt ein Artikel des amerikanischen Netzmagazins The Verge, das einen Vertrag zwischen Sony und Spotify veröffentlichte, dass der Konzern zum Beispiel in Form einer 42 Millionen Dollar großen Vorauszahlung ganz andere Konditionen bekommt als die kleinen Wettbewerber, die über Aggregatoren an das ihnen zustehende Geld gelangen müssen.
Spezialverträge, die den großen Plattenläden helfen und den Künstlern und kleinen Labeln schaden, gibt es vermutlich auch zwischen denselben und Youtube beziehungsweise Google. Die großen Labels haben bereits in Youtubes Frühphase, bevor und während Youtube ein Teil von Google wurde, kräftig kassiert. Jetzt, sagt Rhein, lehnten sie sich wohl auch gerne mal zurück, wenn es Streit darüber gebe, wer denn nun die Rechte an einem bestimmten Titel halte, der auf Youtube zu hören sei - kurz: welchem Rechteinhaber das Geld, das auf Youtube erwirtschaftet wird, überhaupt zustehe. Wenn mehr als eine Firma Rechte an einem Titel anmeldet, zieht sich Youtube, wo täglich neue Raubkopien hochgeladen werden, auf eine neutrale Position zurück und zahlt vorerst an keine Partei mehr Geld aus. Den Streit sollen dann Minilabels und einzelne Künstler, die ihre Rechte tagtäglich verletzt sehen, mit ihren Mega-Konkurrenten vor Gerichten klären. Daran haben aber große Firmen, die offenbar schon regelmäßig große Summen von Youtube erhalten, wenig bis kein Interesse.
Youtube hat einiges unternommen, um Rechteinhaber wenigstens zu informieren, wenn ihre Musik oder Videobilder auf Youtube verwendet werden. Eine spezielle Software soll das Material erkennen, und dann dem rechtmäßigen Besitzer die Möglichkeit geben, daran zu verdienen, indem Werbung geschaltet wird - oder die Musik von Youtube sperren zu lassen. Schön und gut, sagt Rhein, die Youtube-Software erkenne zwar Titel, aber bei Klassik etwa keine unterschiedlichen Einspielungen. Und ob das die Berliner oder die Wiener Philharmoniker sind, die gerade Beethoven spielen, entscheidet eben darüber, wer das Geld für die Leistungsschutzrechte bekommt.
Das Spiel um die Zukunft der Musikbranche hat gerade erst begonnen
Die Schwierigkeit, einen Titel überhaupt zu identifizieren, ist ein Problem, das die Digitalisierung geschaffen hat. Seit Musik ein körperloses Gut geworden ist und vor allem in einer Form ohne Trägermedium existiert, ist ihr monetärer Wert frei bestimmbar, ihre Verbreitung hingegen unkontrollierbar. Rhein arbeitet mittlerweile selbst an einer Software, mit deren Hilfe er beweisen will, dass ihm Geld für Hunderte von Aufnahmen zusteht - unter anderem für die, die offenbar aus der Schweiz hochgeladen wurden. Wenigstens dort hat er in diesen Tagen Erfolg. Einige Raubkopien seiner Aufnahmen verschwinden aus dem Netz. Ein kleiner Sieg.
Das Spiel um die Zukunft seiner Branche aber hat gerade erst begonnen. Apples jüngste Ankündigung zu seinem Einsteig ins Streaminggeschäft ist: Die ersten drei Monate sind für Neukunden kostenlos. Das Geld für dieses Experiment zahlt aber nicht Apple. Der Konzern hat beschlossen, einfach Künstlern und Label kein Geld zu bezahlen. Ein paar Indielabels kündigten Protest dagegen an. Aber wer kann es sich leisten, nicht dabei zu sein? Rhein liest darüber und schreibt per E-Mail: "Langsam sammelt sich bei mir ein unerträgliches Wutpotenzial, was aber keinen weiter bringt . . . es muss gelöst werden . . . sonst sind wir dem Beschiss auf Ewigkeit ausgeliefert." Ja, doch, sieht ganz danach aus.