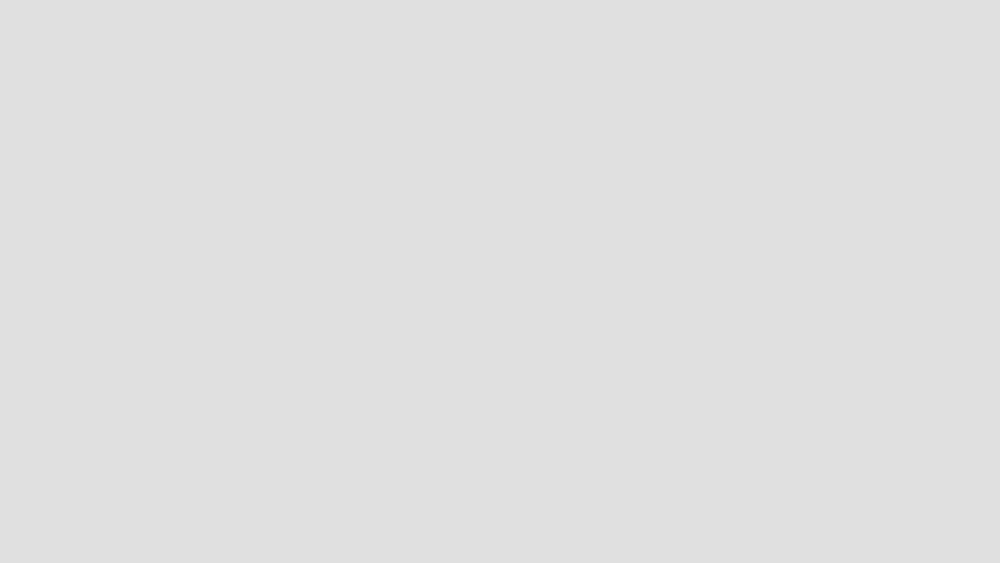Wenn es um das Interesse der Verbraucher an Bio-Lebensmitteln geht, liegt der deutsche Markt weit vorn. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Denn ob Biogetreide oder Biomilch: Rund ein Viertel davon kommt aus dem Ausland. Der Bund will deshalb mit Förderprogrammen helfen, für ein größeres einheimisches Angebot zu sorgen. Im "Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft" (BÖLN) stehen jährlich Mittel von 30 Millionen Euro für Landwirte bereit.
Die Bundesregierung will den Anteil ökologisch bebauter Flächen von derzeit acht auf 20 Prozent bis 2030 steigern. Branchenexperten wie Hubertus Paetow, Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), halten es allerdings für wichtiger, die gesamte Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Auch dafür gibt es schon Förderungen. Für betriebliche Investitionen in eine besonders umweltschonende und tiergerechte Landwirtschaft gibt es etwa aus dem Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) Zuschüsse von 20 Prozent, bei Stallbauten sogar von 40 Prozent des förderfähigen Investitionsvolumens.
Die EU drängt darauf, dass die afrikanischen Partner 80 Prozent ihrer Importzölle streichen
Die Landwirtschaftliche Rentenbank in Frankfurt bietet zinsgünstige Kredite an, die bei den Hausbanken beantragt werden können. "Besonders gefragt sind derzeit Finanzierungen für Investitionen in neue Stallbauten, die dem Tierwohl noch besser gerecht werden", sagt Christian Bock, Bereichsleiter Fördergeschäft bei der Rentenbank. Über ihr Programm "Nachhaltigkeit" unterstützt die Rentenbank ressourcenschonende Maßnahmen im Ackerbau, mit denen etwa Emissionen oder der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Ebenso gibt es Fördermittel für ökologisch wirtschaftende Landwirte, deren Produktion den Richtlinien der EU-Öko-Verordnung entspricht. "Wir finanzieren darüber hinaus die nachhaltige Weiterverarbeitung wie zum Beispiel eine energieeffiziente Produktion in der Molkerei", erläutert Bock. Zudem gibt es Förderkredite für die Direktvermarktung, wie sie häufig auch Ökobetriebe zur Belieferung von Wochenmärkten nutzen. Nicht zuletzt vergibt die Rentenbank Zuschüsse für die Entwicklung, Markteinführung und Verbreitung von Innovationen. Die Betriebe müssen einem steigenden Wettbewerbsdruck standhalten, aber auch immer höheren Erwartungen und Anforderungen gerecht werden. "Das gelingt nur durch praxistaugliche Innovationen", betont Bock.
Was der Agrarsektor leistet, hat auch viel mit den globalen Handelsströmen zu tun. Deutschland und die EU stehen vor allem beim Handel mit den Entwicklungsländern vor der Herausforderung, faire Rahmenbedingungen zu schaffen, Europa sieht die Lösung in einer gegenseitigen Marktöffnung. So sehen Economic Partnership Agreements (EPAs) mit west-, ost- und südafrikanischen Staaten eine deutliche Reduzierung der Zölle vor. Die EU hat schon viele dieser Importschranken abgebaut, nun soll Afrika nachziehen. Die einseitige Vorleistung Europas verstößt gegen das Diskriminierungsverbot der Welthandelsorganisation WTO.
Konkret drängt die EU darauf, dass die afrikanischen Handelspartner 80 Prozent ihrer Importzölle streichen. Mit den verbleibenden 20 Prozent könnten sie nach wie vor ihre Landwirtschaft schützen. Allerdings helfen Importzölle Afrika schon jetzt kaum, sich gegen Billigprodukte aus Europa zu wehren. Zwar hat die EU Exportsubventionen seit 2013 abgeschafft. An der exportorientierten Agrarpolitik der Europäischen Union hat das aber nichts geändert. "Es gehen noch mehr ruinöse Billigprodukte aus der EU-Überschussproduktion in den Weltmarkt und auch nach Afrika", sagt Marita Wiggerthale, Expertin für Welternährung und globale Fragen bei der Nichtregierungsorganisation (NGO) Oxfam Deutschland. Niedrigpreise belasten zwar auch die Existenzgrundlagen bäuerlicher Betriebe in Europa. Ein Teil davon aber wird immerhin durch Direktzahlungen in Form von Flächenprämien aus EU-Mitteln kompensiert. Kleinbäuerliche Produzenten in afrikanischen Ländern haben hingegen kaum Chancen, sich gegen die Billigexporte aus Europa zu wehren und werden in ihrer Existenz bedroht. Die Übermacht der ausländischen Konkurrenz verhindert die Entwicklung einer eigenständigen Agrar- und Ernährungsindustrie.
Hygienische Standards werden oft nicht ausreichend kontrolliert
Nigeria, eines der gemessen am Bruttoinlandsprodukt wichtigsten Länder in Westafrika, verweigert deshalb die Zusage zu einem EPA. 13 andere Staaten der Region wollen mitmachen. Ghana und die Elfenbeinküste haben schon Interimsabkommen unterzeichnet. Afrikanische Länder finden nicht zu gemeinsamen Regeln für den Handel untereinander und nach außen. Auch an der internationalen Arbeitsteilung wird sich nicht allzu viel ändern. Die afrikanischen Staaten liefern die Rohstoffe und die EU exportiert verarbeitete Lebensmittel. "Afrika geht damit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette verloren", sagt Wiggerthale. Umso wichtiger wäre es, eine einheimische Agrar- und Ernährungsindustrie aufzubauen. Dafür aber braucht Afrika eher Unterstützung statt Freihandelsverträge. "Die EU sollte anerkennen, dass für den Handel zwischen armen und reichen Ländern nicht die gleichen Regeln gelten können", sagt Wiggerthale. Anders gelagert ist die Kontroverse um das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die südamerikanischen Länder könnten damit durch weniger Zölle und höhere Freihandelsquoten noch größere Mengen Geflügel- und Rindfleisch am europäischen Markt absetzen. In der EU wiederum würden sich vor allem Autohersteller über größere Exportchancen in Südamerika freuen. Kritiker aber warnen, dass Fleischhersteller etwa in Brasilien, die bei niedrigeren Löhnen und laxeren Nachhaltigkeitsstandards produzieren, europäische Bauern in Bedrängnis bringen könnten.
Der Deutsche Bauernverband (DBV) fordert faire Abkommen. Bedenken melden zudem sozial-ökologische Verbände von Greenpeace über Foodwatch bis hin zu PowerShift an. "Eine stärkere Nachfrage nach Rindfleisch aus Brasilien führt dort auch zu einer höheren Produktion von Futtermitteln und wegen des damit verbundenen Landbedarfs zu einer noch aggressiveren Abholzung von Wäldern", warnt Alessa Hartmann, Expertin für internationale Handelspolitik bei der NGO PowerShift.
Nicht genügend berücksichtigt sei eine bessere Kontrolle der hygienischen Standards. Erst im vergangenen Jahr war durch einen großen Gammelfleischskandal publik geworden, dass in Brasilien mehrere Konzerne die staatlichen Hygiene-Zertifikate durch Bestechungsgelder erlangt hatten. "Die EU verzichtet ausdrücklich auf strengere Kontrollen der Schlachthöfe, die oft sogar illegal betrieben werden", sagt Hartmann. Gefordert wird lediglich, dass der Exportstaat die Einhaltung der Standards des Importlandes ausreichend garantiert. Helfen, so Kritiker, wird das Abkommen vor allem den Großbetrieben. "Damit geraten landwirtschaftliche Strukturen, eine nachhaltige Weidehaltung und existenzsichernde Erzeugerpreise für bäuerliche Betriebe weiter unter Druck", sagt Hartmann.