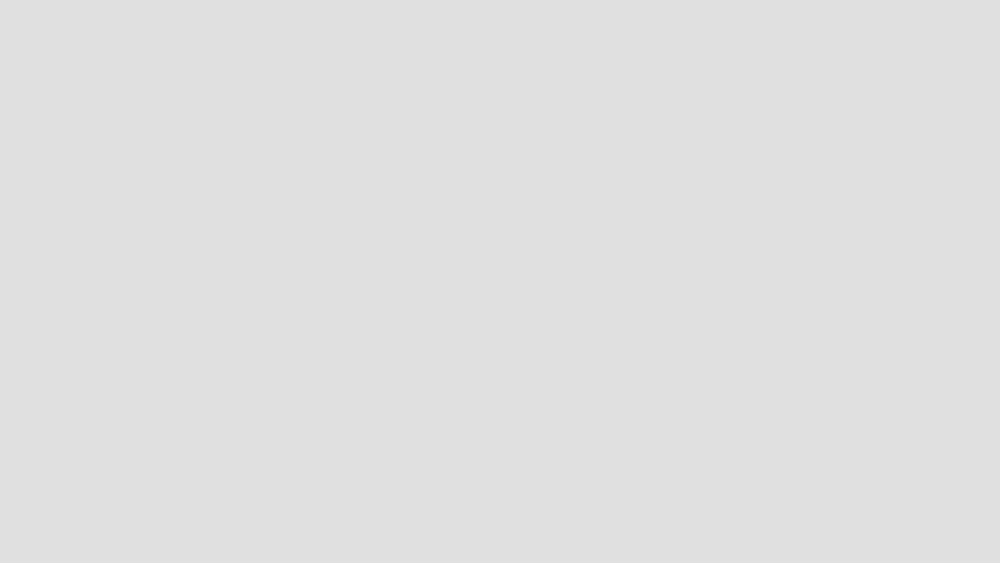
Braun werden im Gänsehäufel
Andere Städte mit großen Flüssen mögen am Ufer liegen, Wien liegt am Strand, und zwar am "schönen Strand!" der Donau. So heißt es schließlich schon im Donauwalzer, und Johann Strauss hat immer Recht. Der Wiener kann nämlich tatsächlich Strandurlaub zu Hause machen, wenn er zum Beispiel an die Alte Donau fährt, mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad. Hier an einem toten Seitenarm des Flusses liegen öffentliche Strandbäder mit so idyllischen Namen wie Polizeibad, Straßenbahnerbad oder Arbeiterstrandbad. Vor allem aber liegt hier das legendäre "Strandbad Gänsehäufel", das an heißen Sommertagen auf seinen Rasenflächen einen beträchtlichen Anteil der Wiener Bevölkerung aufnehmen kann, ohne wirklich voll zu wirken. Wenn es in den städtischen Straßenschluchten dampft vor Hitze, ist dies der ideale Fluchtort. Im erfrischenden Flusswasser lässt sich wunderbar schwimmen, und besser gebräunt, das ist vieltausendfach empirisch bewiesen, kann man auch an der Adria nicht werden.
Der Wiener ist zu seinem großen Glück jedoch nicht nur mit einer Donau gesegnet, sondern die Donau gibt es hier ungefähr vier Mal. Neben der Alten Donau fließt die Neue Donau, die von der eigentlichen Donau durch eine rund 20 Kilometer lange, künstlich aufgeschüttete Insel getrennt wird. Natürlich ist die Donauinsel auch ein Freizeitparadies. Und dann gibt es noch den Donaukanal, der sich in steinerner Rinne durchs Stadtzentrum quält. Schön und blau ist die Donau hier nicht, eher trüb und grau. Egal. Am Kanalrand wird Sand aufgeschüttet für die fast perfekten Strandbars.
Peter Münch

Espresso am Ufer der Drecksbrühe
Wer die Themse in ihrer Gänze durchschwimmt, tickt nicht ganz sauber. Zwar fließt der 346 Kilometer lange Fluss durch malerische Gegenden und schwillt in der Nähe von London auf die ihm gemäße, erhabene Größe an - dennoch ist es prinzipiell keine gute Idee, ihn schwimmend zu durchmessen. Erfahren hat das zum Beispiel der Komiker David Walliams, der das Unterfangen 2011 für einen guten Zweck wagte. Er schwamm, um Geld für Bedürftige zu sammeln. Walliams brauchte acht Tage, er wurde von Schwänen angegriffen und von Insekten zerstochen. Zudem litt er unter dem "Themse-Magen", weil das Flusswasser, je näher man London kommt, zu einer ziemlichen Drecksbrühe wird, sprich: Er hatte massiven Durchfall und übergab sich. Das Gute an der Geschichte: Die Briten nahmen Anteil an seiner Qual und spendeten mehr als eine Million Pfund für die Stiftung "Comic Relief", die sich für Benachteiligte einsetzt.
Dennoch nähern sich vernunftbegabte Londoner ihrem Fluss so: Sie überqueren die Westminster Bridge gen Süden, biegen nach rechts ab und spazieren am Ufer entlang. Herrlicher Blick auf Big Ben und das Parlament. Kurz vor der nächsten Brücke steht links eine kleine Kaffeebude, in der es ungelogen den besten Espresso der Stadt gibt. Den bestellt man, setzt sich auf einen der klapprigen Stühle an der Uferbefestigung, nippt und - mehr nicht. Besser geht's nicht.
Christian Zaschke
Lebensgefährliches Distinktions-Dingens
Wer in Köln groß wird, der lernt früh, dass der Rhein nicht zum Schwimmen da ist. Der einsilbige Fluss, der durch die einsilbige Stadt mit dem einsilbigen Dom fließt, ist eher ein Mittel der Selbstverortung. Der Kölner würde vielleicht sagen: ein Distinktions-Dingens. Menschen, die auf der linken Seite des Rheins leben, bezeichnen die rechte Seite des Rheins despektierlich-traditionell als "Schäl Sick"; also die falsche, die andere Seite. Menschen, die auf der rechten Seite leben, finden ihre Sick in der Regel nicht so schäl. Ob man nun aber von links oder rechts kommt - ohne den Rhein hätten die Einwohner nicht diesen Horizont plus Dom, und ohne den Rhein würde sich Köln wohl eher nicht wie die viertgrößte Stadt Deutschlands anfühlen.
Im Sommer kommen Fahrradfahrer, Jogger, Spaziergänger, Skater, Kurzzeit-Camper und Eingeölte an den Fluss, sie kommen an das betonierte Ufer, die Wiesen im Rheinpark oder den Strand in Rodenkirchen. In den kleinen Buchten wird zwar auch gebadet, empfehlenswert ist das jedoch nicht; Schwimmen ist am Rhein in Köln lebensgefährlich, die großen Schiffe können hohe Wellen schlagen, die Strömungen sind unberechenbar. Das sind die Alkoholisierten in der Altstadt aber auch, ebenso wie die Party-Frachter, auf denen auch 2017 noch "Atemlos durch die Nacht" gebrüllt wird. Dann doch lieber den Schafen dabei zuschauen, wie sie über die Poller Wiesen grasen. Drüben auf der Schäl Sick.
Friederike Zoe-Grasshoff

Scheue Krokodile im Süßwassermeer
Der erste Europäer, der den Amazonas beschrieb, war der spanische Kaplan Gaspar de Carvajal. Sein Bericht aus dem Jahr 1542 galt damals als Hirngespinst - unter anderem wegen der Behauptung, die Expedition sei von barbusigen Frauen angegriffen worden, den Amazonen; so kam der Fluss wohl zu seinem Namen. Der Amazonas ist weltweit so etwas wie der Über-Fluss: er ist anders als die anderen Flüsse, und das gilt wohl auch für das Verhältnis der Menschen dort zu ihm. Für einen Amazonas-Anwohner wirken die Europäer ja wahrscheinlich irgendwie niedlich: Donau? Tiber? Rhein? Alles so klein, so beschaulich. Beim Amazonas dagegen stellt sich die Frage: Ist er überhaupt ein Fluss? Oder nicht eher eine Flusslandschaft, ein Feuchtgebiet, das größte Biotop der Erde? Die Spanier sprachen zunächst vom "Mar Dulce", vom Süßwassermeer. Zahlreiche Nebenflüsse wären in anderen Teilen der Welt eigenständige Berühmtheiten. Der Hauptstrom ist in Brasilien oft mehrere Kilometer breit und von der Mündung aus 3700 Kilometer bis hinauf ins peruanische Iquitos mit Hochseeschiffen befahrbar.
Für einen Großteil der heutigen Anwohner bietet der Fluss die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Denn es gibt dort kaum parallel verlaufende Straßen und so gut wie keine Brücken. Grundsätzlich ist er zwar auch beschwimmbar. Man teilt sich das Vergnügen aber mit Anakondas, Krokodilen und Piranhas. Erfahrene Amazonasschwimmer wissen jedoch: All diese Tiere sind gemessen an ihrem schrecklichen Ruf relativ scheu.
Boris Herrmann
Mr. Ok und der heilige Schlamm
Sogar im Sommer, wenn Rom benommen in seiner staubig trockenen Hitze liegt, käme es niemandem in den Sinn, mal schnell in den Tiber zu springen. Und niemand ist hier durchaus genau so zu verstehen, im Zahlensinn: null. Es braucht dafür kein Verbot irgendeiner Behörde, da kommt man selber drauf. Mag der Tiber auch den schönen Namen "Fiume sacro", Heiliger Fluss, mit sich herumtragen, weil er der Stadt als Geburtshelfer gedient hat - in seiner Heiligkeit schwimmt die trübe, schlammige Sorglosigkeit der Römer im Umgang mit ihrer Stadt mit, dazu grober Müll und fette Ratten, rostige Bootsrelikte. Nicht, dass das niemand ändern wollen würde: Vor jeder Gemeindewahl verspricht mindestens einer der Kandidaten, dass er den Fluss, wenn er Bürgermeister sei, "balneabile" machen würde, badbar also. Schwätzer!
Maurizio Palmulli springt dennoch, einmal im Jahr und seit drei Jahrzehnten schon, immer an Silvester. Palmulli stellt sich zur besorgten Belustigung vieler Beisteher auf den Ponte Cavour, die Brücke bei der Engelsburg, und wirft sich in den Tiber, formvollendet, mit durchgestrecktem Rücken. Er nennt sich "Mr. Ok", und wahrscheinlich überzeugt er damit vor allem sich selber.
Oliver Meiler

Romantik für den Kopf
Manchmal fragen sich die Menschen in New Orleans, was genau den Franzosen Sieur de Bienville 1718 wohl geritten hat, hier am Ufer des Mississippi eine Stadt zu gründen: errichtet im Sumpf, umgeben von Wasser. Natürlich ist der Mississippi der beste Freund der Stadt, die Lebensader, die tief hinein führt ins Herz des Kontinents. Ein Handelsweg, für Weizen, Mais und Soja, er hat der Stadt Wohlstand gebracht und Bedeutung. Der Fluss ist aber auch ihr ärgster Feind. Dem Mississippi, hat Mark Twain geschrieben, könne man nicht befehlen: Fließ dahin, fließ dorthin! Die New Orleaner versuchen trotzdem seit Generationen, ihn zu lenken. Es ist ein Kampf zwischen Mensch und Fluss, und wenn der Mensch verliert, wird die Stadt untergehen. So wie 2005, als nach dem Hurrikan Katrina die Dämme brachen. Man hat die Dämme wieder aufgebaut, höher und besser, sie schützen die Stadt, aber sie sperren sie auch ein. An vielen Orten in New Orleans kann man den mächtigen Fluss nur erahnen, er ist hinter einem Damm verborgen. Selbst dort, wo man an ihn herankommt, im Woldenberg Park etwa am French Quarter, ist er keine makellose Schönheit.
Twains Huckleberry-Finn-Romantik liegt nicht im Auge, sondern im Kopf des Betrachters. Ja, da ist ein Schaufelraddampfer für die Touristen. Aber sonst: nur Frachtschiffe, die den Fabriken des Deltas entgegen gleiten. Und doch kann man sich der mythischen Kraft dieses Stroms nicht entziehen. Die New Orleaner sprechen und singen mit Liebe und Respekt vom "Ol' Man River", vom "Moon River". Er biegt sich hinein in ihre Stadt, und er biegt sich hinaus. Wenn man auf einen Damm steigt, vielleicht im Abendlicht nach einem Football-Spiel der Saints, das man in der Sports-Bar "Cooter Brown's" gesehen hat, dann ist der Mississippi das, was so viele Flüsse sind: das schimmernde Versprechen, dass hinter der nächsten Biegung das Glück auf einen wartet.
Roman Deininger