Münzen mit den kleinen Werten sind für die meisten Menschen eher lästiger Ballast, als dass sie den runden Metallstücken im Geldbeutel eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimessen. Jedoch nur so lange, wie sie in den Taschen klimpern. Sobald das Hartgeld knapp wird, es keine Groschen mehr gibt, Einzelhändlern die kleinen Münzen fehlen und sie über kein Kleingeld mehr verfügen, das als Wechselgeld herausgegeben werden kann, können die Folgen verheerend sein. In kürzester Zeit kommt jede Art von Handel zum Erliegen. Haben Bürger Angst, die Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr kaufen zu können, dann dauert es nicht sehr lange, bis soziale Unruhen ausbrechen.

So hat gerade das kleine Geld großen Einfluss auf unser Wirtschaftssystem und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs hatte der Staat den Kleingeldmangel sogar selbst ausgelöst. Die damalige Regierung sammelte in den Frontgebieten Elsass und Ostpreußen, aber auch in Oberschlesien und im Ruhrgebiet, die dort vorhandenen Münzen als wertvolles kriegswichtiges Metall ein und ließ sie schmelzen, weil die Rüstungsindustrie das Metall brauchte.
Folglich war es der Reichsbank nicht mehr möglich, die Bevölkerung flächendeckend mit Zahlungsmitteln zu versorgen. Die Inflation wuchs, ebenso die Unsicherheit der Bürger - denn dort, wo die kleinen Münzen in den Geldbörsen fehlten, wurde aus Angst nur noch wenig gekauft. Um Unruhe in der Bürgerschaft zu vermeiden, druckten Städte eigenes Notgeld und brachten es als Ersatzgeld in Umlauf. Die Notmünzen und Notscheine - das Kriegsgeld - hatten allerdings nur eine begrenzte Gültigkeit für den Zahlungsverkehr vor Ort.
Dies war keine deutsche Erfindung. Solches Notgeld gab es auch schon früher in anderen Ländern. Immer wenn Geld knapp wurde und die Bevölkerung nicht mehr mit Zahlungsmitteln versorgt werden konnte, brachte die jeweilige Staatsmacht Ersatzgeld in Umlauf. Ein Selbsterhaltungstrieb, denn die Regierungen hatten Angst, andernfalls gestürzt zu werden. Das war im frühen England der Fall und ebenso während der Französischen Revolution. Mit den billets de confiance versuchte die Regierung, die Bevölkerung zu besänftigen, so wie es auch während des Amerikanischen Bürgerkriegs geschehen war.
Wie schnell ein Staat die Kontrolle über sein Geld verlieren kann, offenbarte in Deutschland besonders eindrucksvoll die Zeit zwischen 1914 und 1923. Die Reichsregierung musste hilflos zusehen, wie die Kriegsfinanzierung zu einem rapiden Wertverlust des Geldes führte. Neben gedruckten Scheinen wurden Porzellan, Pappe, Leder, Presskohle, Seide oder Leinen ausgegeben. In einigen Fällen wurden sogar Spielkarten zu Notgeld umfunktioniert.
Rasch entwickelten sich die billigen Scheine zu beliebten Sammlerobjekten. Geschäftstüchtige Kommunen und Unternehmen begannen, das Notgeld als variantenreich gestaltete Geldscheine direkt für den Sammlermarkt zu produzieren. Aus der Not wurde eine Tugend, aus Serienscheinen "Sammlergeld", reine Finanzierungsinstrumente für Emittenten. Für Hotels, Restaurants und Firmen stellte das Notgeld mit viel Lokalkolorit ein einfaches und vor allem billiges Werbemittel dar. Es wurde nicht mehr für den Umlauf, sondern gleich direkt für Sammler gedruckt und ausgegeben.
Das Konzept funktionierte - die grafisch teilweise sehr aufwendig gestalteten Serien brachten beträchtliche Gewinne. Davon profitierte auch die Druckbranche. Vielen Grafikern und Designern, die in dieser Zeit ohnehin am Hungertuch nagten, verhalfen diese Aufträge zu Lohn und Brot, sie machten das Notgeld zu begehrten Kleinkunstwerken. Unter den Abbildungen finden sich darüber hinaus viele rührend naive Illustrationen von Hobbykünstlern.
Die Motive sind zahllos: Gebäude und Wappen, Märchenserien,Volksweisheiten zum Schmunzeln, aber auch politische Propaganda. Anfangs waren die Scheine betont nüchtern, später wurden zeitkritische Bezüge bei den bildlichen Darstellungen immer häufiger. Manches Notgeld wurde mit politisch fragwürdigen regionalen Besonderheiten gedruckt. Die Kleinstadt Sternberg im heutigen Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel druckte nach dem Ersten Weltkrieg Geldscheine, auf denen eine Hostienschändung durch Juden zu sehen war, die sich dort im Jahre 1492 ereignet haben soll.
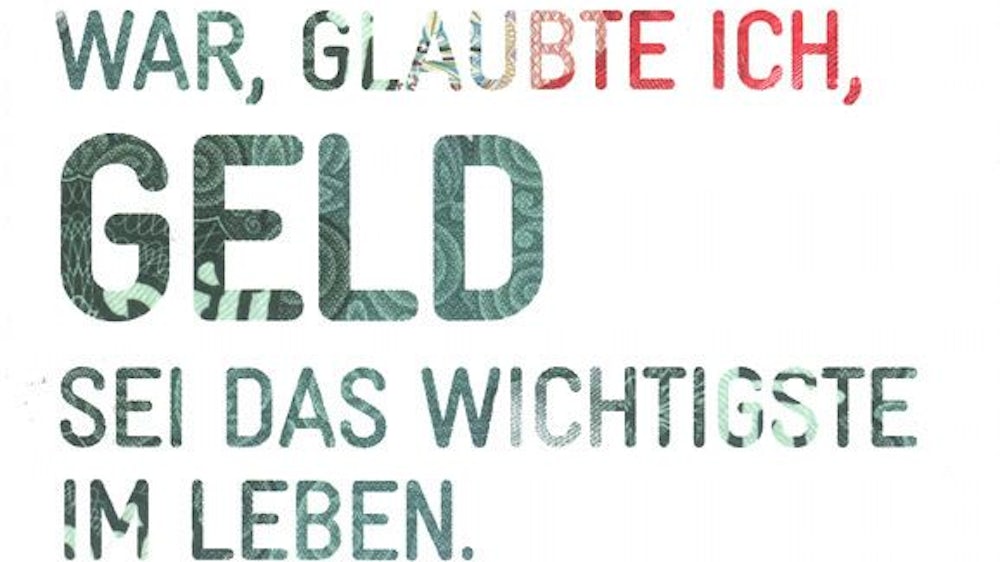
Die Reichsbank betrachtete die massenweise Verbreitung dieses Geldes, das in Wirklichkeit keines war, mit wachsendem Unbehagen, zumal sich mehr und mehr zwielichtige Spekulanten in diesem nahezu risikolosen Geschäft tummelten und Profit machten. Die Reichsbank kapitulierte und musste tatenlos zusehen, wie neben dem offiziellen Geld das "Nebengeld" die Inflation immer weiter anheizte. Im Juli 1922 war dann Schluss mit dem Notgeldunwesen. Der Reichstag verabschiedete ein Gesetz, das empfindliche Strafen für all diejenigen vorsah, die weiterhin privates Geld in Umlauf brachten.
In der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg kursierten bis zum Sommer 1923 mehr als 80.000 unterschiedliche Notgeldscheine. Das in der Hochinflation 1922/23 von Reichsbank, Firmen, Kammern und Verbänden ausgegebene Papiergeld konnte gegen den dramatischen Wertverfall der Mark nichts ausrichten. All dies war allerdings nur eine Zwischenstation auf dem Siegeszug des Phantasiegelds. Der Notgeld-Boom blühte im Zuge der nachfolgenden Inflation erst richtig auf, als Geldscheine im Wettlauf mit den außer Rand und Band geratenen Nullen für Millionen, Milliarden und Billionen Deuschland und seine Währung ins Chaos stürzten.
Es dauerte nicht lange, bis diese noch gültigen, aber völlig entwerteten Banknoten als Werbeträger für politische Tagespropaganda benutzt wurden. Die geniale Idee: Jeder bückt sich nach dem Geld, das auf der Straße liegt. Die Banknoten mit der täglich wachsenden Zahl von Nullen waren das billige Druckpapier, auf dem politische Parteien und Gruppierungen ihre Propaganda druckten. Prägnant, satirisch, zumeist aber den politischen Gegner perfide diffamierend. Besonders häufig nutzten antisemitische Parteien das neue Propagandamedium. Für sie stand fest, wer die Bevölkerung ins Elend gestürzt, um Haus, Hof und sämtliche Spareinlagen gebracht hatte - Schieber und Spekulanten, Juden und Bolschewisten.
Im September 1923 tauchten in Stuttgart erstmals alte 1000-Mark-Scheine mit Spottaufdrucken auf. Bald schon wurden die Texte deutlich aggressiver: "Der Jude nahm uns Silber, Gold und Speck / Und gab dafür uns den papiernen Dreck!" Wahlen standen vor der Tür, und die nationalsozialistische Propagandamaschinerie lief auf Hochtouren. Nun wurde zum Mittel der Judenkarikatur gegriffen. Die Abbildungen auf den Geldscheinen sollten die Angst der Wähler schüren. Mit den Propagandageldscheinen wurde dazu aufgefordert, bei anstehenden Wahlen "völkisch" zu wählen, Adolf Hitler und seine NSDAP.
Der Text ist dem "Großen Buch vom Geld" von Uli Röhm entnommen. Der Band ist bei Edition Braus erschienen.