Und dann träumt der Sänger, träumt davon, wie die Welt wohl wär ohne Krieg, ohne Eigentum und, ja, sogar ohne Himmel. "Stell dir vor", sagt er, singt er mit heller Chorbubenstimme, und das Klavier pumpert einen schleppenden Takt hinterher, "stell dir bloß vor, es würden alle Menschen in Frieden leben." Undenkbar, kindisch, lächerlich, da könnte er ja gleich für die Zeugen Jehovas am U-Bahn-Eingang stehen und den Wachturm feilbieten.
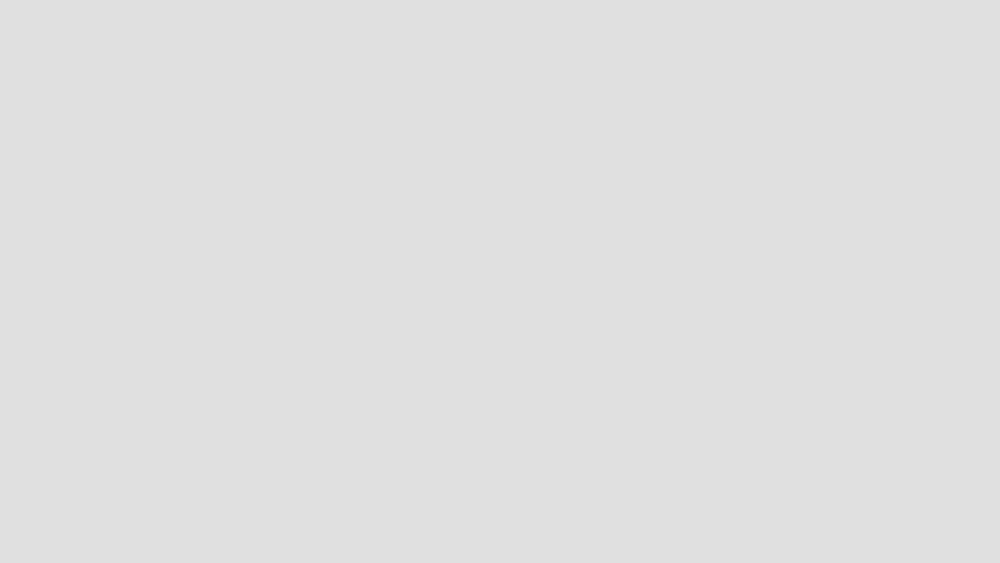
John Lennon war es trotzdem recht ernst mit seiner Träumerei am Klavier und er fand deshalb auch nichts dabei, sich zum Narren seiner Frau und der gemeinsamen Ideen zu machen. "Wir sind bereit, vor der Welt als Clowns dazustehen, wenn das zur Verbreitung des Friedens beiträgt", erklärte er der unverständigen Welt und legte sich mit seiner Frau im März 1969 sieben Tage lang für die Kameras im weißen Schlafanzug im Amsterdam Hilton ins Bett. Seinen königlich-britischen Orden schickte er zurück, weil er die Regierung für das Elend in Biafra verantwortlich machte, pflanzte Eicheln und plakatierte in vielen Sprachen und elf Städten, was nur ein Träumer sich ausdenken konnte: "War is over / If you want it!"
Was für ein Hochmut: Du musst es nur wollen, dann wird das schon. Der Krieg in Vietnam fand Ende 1969 ein so breites Missfallen, dass John Lennon & Yoko Ono mit ihrer Protestaktion nur deshalb auffielen, weil jetzt auch einer der berühmtesten Menschen der ganzen Welt sagte, was nicht mehr erträglich war.
Obwohl die Beatles wie die Rolling Stones die Straßenschlachten in Berlin und Paris herbeigesungen hatten, traten sie vollkommen unpolitisch auf. Noch wenige Jahre zuvor hatte ihr Manager den Beatles jede Äußerung zu Vietnam untersagt. Der US-amerikanische Markt war zu wichtig, als dass man ihn durch eine Parteinahme hätte gefährden dürfen. Scheindesperat fragte Mick Jagger sein Publikum unter der Überschrift "Street Fighting Man", ob sie wirklich musique engagée von ihm erwarteten, wenn er doch bereits wusste, wie es um die Machtverhältnisse stand: "What can a poor boy do / 'cept to sing for a rock'n'roll band"?
Damit unterschätzten sich die Musiker womöglich und verkauften sich in jedem Fall zu billig. Noch 1967 wurde das Eurovisionsfernsehen mit dem selten dämlichen "All you Need is Love" der Beatles eingeläutet. Das wollte allen wohl und bloß niemandem weh tun, das war der amtlich anerkannte Privathedonismus der Musiker. Drogengeschichten, die üblichen Skandale mit minderjährigen Groupies, Gewalttaten bis zum Mord -- das alles war erlaubt und wurde von niemandem besser verkörpert als von britischen Rowdys, die öffentlich ihre Jugend verschwendeten und das Evangelium des ungehemmten Konsums predigten.
Dass jemand von ihnen seinen Kopf, gar sein Geld für etwas anderes einzusetzen wüsste als für noch mehr Drogen, noch mehr Frauen und einen noch größeren Landsitz in der Grafschaft Buckinghamshire, war im Plan nicht vorgesehen.
John Lennon kam zum Glück eine Frau zu Hilfe, die Konzeptkünstlerin Yoko Ono, die vor ihrem ersten Rendezvouz mäßig erfolgreich in der Fluxus-Bewegung mitgewirkt hatte. Kunst, diese Botschaft brachte sie aus New York mit, musste nicht unbedingt pour l'art sein, sie konnte auch etwas bewirken, vor allem ließ sich die notwendig flüchtige Musik ummünzen in öffentliches Aufsehen.
Elvis wäre es selbstverständlich nie in den Sinn gekommen, für notleidende Rednecks zu singen oder auch nur für die Drogenbehörde, bei der er zuzeiten als passives Mitglied Dienst tat. Politik und das so genannte Schaugeschäft fanden erst seit der konsequenten Verjugendlichung der Gesellschaft unter John F. Kennedy zusammen. Der Präsident ließ sich von Marilyn Monroe ein Geburtstagsständchen singen und lud Dichter und Schriftsteller zum Dinner ins Weiße Haus. Die Welt wurde jung, und die Politik lernte bald, sich um diese Tugend zu bemühen. Folkmusiker aus New York traten in der Bürgerrechtsbewegung für die Schwarzen auf, die in den Südstaaten noch bis Ende der sechziger Jahre in einer heute unfassbaren Apartheid leben mussten. Auf den Festivals in Monterey und erst recht in Woodstock wurde die Jugend der Welt vorübergehend ihrer Konsumentenmacht inne.
Dennoch bedurfte es einer besonderen politisch-musikalischen Konjunktion: 1971 hörte George Harrison von dem indischen Musiker Ravi Shankar Berichte über das Elend in Ostbengalen, das sich von Pakistan löste und seine Unabhängigkeit unter dem Namen Bangladesh anstrebte. Wäre Harrison kein Staatsangehöriger der ehemaligen Kolonialmacht gewesen, hätte Ravi Shankar nicht die Sitar in die Popmusik gebracht -- es hätte die Benefizanstrengung des "Konzerts für Bangladesh" in New York nicht gegeben. Die Beatles waren seit eineinhalb Jahren offiziell getrennt, aber schon seit 1966 nicht mehr zusammen aufgetreten. Der friedens- und religionsbewegte Harrison war inzwischen der erfolgreichste im ehemaligen Quartett und konnte mit der Aussicht hausieren gehen, die alten Freunde würden sich für dieses Ereignis doch noch einmal zusammenfinden. John Lennon vermocht's dann ebenso wenig wie sein inzwischen leidenschaftlich gehasster Freund Paul McCartney. Nur Ringo kam und sang "It don't come easy". Es kamen auch Eric Clapton, Leon Russell, Klaus Voormann, Billy Preston und die heute leider völlig vergessene Gruppe Badfinger, und es wurde vor allem ein musikalisches Fest.
Mittendrin konnte Harrison "einen Freund von uns allen" ankündigen, "Mr. Bob Dylan!" Der Jubel im Madison Square Garden war unbeschreiblich, denn auch Bob Dylan hatte sich 1966 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, galt als verschollen, wenn nicht sogar debilisiert. Plötzlich stand er auf der Bühne und sang, sekundiert von Eric Clapton und George Harrison, "Blowin' in the Wind" und "Lay Lady Lay". Bangladesh, das im Dezember 1971 seine Unabhängigkeit erlangte, erhielt mehrere Millionen aus dem Verkauf der Platten.
An Anlässen für weitere Benefiz-Veranstaltungen hat es seither nicht gemangelt, wohl aber an einem Organisator, an einem halbwegs glaubhaften Musiker. Bis der irische Musiker Bob Geldof, mäßig erfolgreich gewesen mit seinen Boomtown Rats, im Fernsehen einen Bericht über das Elend in Afrika sah und beschloss zu handeln. In kürzester Zeit organisierte er ein bi-kontinentales Konzert und sorgte für die weltweite Übertragung.
Man hat ihm sein Geltungsbedürfnis vorgeworfen und ihm deshalb eigennützige Motive unterstellt. Immerhin hat er seinen Ruhm sinnvoll genutzt. Popmusiker sind, wenn sie einmal den Ruhm erlebt haben, ebenso wenig resozialisierbar wie Schauspieler. Der Musiker, den der Erfolg verlässt, der, schlimmer fast: altert, muss dieses restliche Leben und seinen Niedergang womöglich außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zubringen. Geldof gelang es, die nicht sonderlich variantenreiche Popmusik zum öffentlichen Wohl hin zu transzendieren.
Sein Eifer, sein Enthusiasmus kommt aus den Sechzigern, die so ungenutzt versunken waren. Die Demonstranten bei den großen Friedensmärschen glaubten mit ausschließlich mentaler Kraft, mit viel gemeinsamem Ommen und wilhelmreichistischem Schwachsinn sogar das kriegführende Pentagon lüpfen zu können, der Krieg ging dennoch weiter, aber er war nicht mehr zu rechtfertigen.
Pop, das wusste man seit diesen Sechzigern, ist eine Großmacht und sie treibt die Politik. Benefiziantentum ist populär, das weiß auch Tony Blair. Für die Entschuldung der ärmsten Länder mag es höchste Zeit sein, sie war auch längst geplant, doch mit der Verkündung dieses Gnadenakts können Politiker etwas zeigen, was sonst den geregelten Geschäftsgang stören würde: Herz. Afrika, das zuletzt nur noch als Boxring für Muhammed Ali und George Foreman diente, war durch "Live Aid" in England und in den USA zum Thema geworden und ist es jetzt, nach 20 weiteren Jahren Aids und Hunger und Krieg, wieder.
In Bangladesh hat sich bis heute wenig geändert: Das Land leidet wie 1971 unter Überbevölkerung, Überschwemmungen, Hungersnöten, Seuchen und religiös-fundamentalistischen Heimsuchungen. Ob die 144 Millionen Dollar, die seit Juli 1985, seit dem "Live Aid"-Doppelkonzert in London und Philadelphia, gegen den Hunger in Afrika aufgebracht wurden, die Not dort wirklich lindern konnten, kann auf der Nordhalbkugel jeder Kollegstufenschüler mit Hilfe seines Taschenrechners bestreiten. Doch wäre dieses arme, geschundene Afrika mit seinen mordgierigen Söldnern und seinen ausbeuterischen Kleptokraten für die Großmächte weiter nur von strategischem Interesse, wenn nicht Bob Geldof und Bono (und unser Karlheinz Böhm) unermüdlich drauf hingewiesen hätten. Zwar ist es Aufgabe der Kulturkritik, sich über den den Ego-Trip von "Saint Bob" und den Größenwahn von Bono lustig zu machen, aber schließlich haben sie etwas bewirkt, wo die anderen bis dahin nur mehr oder weniger zierlich die Hände zu ringen wussten.
Kann sein, dass die Lastwagen, die Brunnenbohranlagen, die Flugzeuge voller Saatgetreide Afrika nicht retten werden, es ist aber dort mehr geschehen als in den Jahrzehnten davor, als sich die Haile Selassis und Robert Mugabes und Bokassas mit Unterstützung der Großmächte durch die Entwicklungshilfe bereicherten. Weil U2 und ihre Freunde 1985 vor einer Milliarde Fernsehzuschauern aufgetreten sind und es in diesem Juli zum zwanzigjährigen Jubiläum wieder tun und dabei den üblichen Rummel zu veranstalten verstehen, lassen sich die Wirtschaftsmächte zum Schuldenerlass drängen. Sogar Auslandsflüge sollen endlich besteuert werden, um mit dem Geld Afrika weiterzuhelfen.
Die rhetorische Frage Mick Jaggers, was ein armer Bub denn anderes tun könne, als in einer Rock'n'Roll-Band zu spielen, bestätigt sich bei "Live Aid' und der Fortsetzung "Live8' aufs Glanzvollste: Wenn der arme Bub spielt und auch wenn er nicht spielt, hört die Welt zu. Politiker müssen dem Klang der Musik und den Worten der Musikanten nachgeben, und das Elend in der Welt ist für einen Augenblick wenigstens überglänzt vom Vorschein einer bessern. Das ist die Botschaft der Kunst, das ist die Botschaft von John Lennon und Yoko Ono.
Ja, ja, Lennons "Imagine" -- das ist übelster Kitsch und in der Wolle auch noch tief gefärbt vom Menschheitspathos der "Internationale", aber so einprägsam und realitätsbewusst hat es keiner gesagt wie der manchmal so verträumte John Lennon: "I hope someday you'll join us / And the world will live as one." Er selber hat's bloß nicht mehr erlebt.