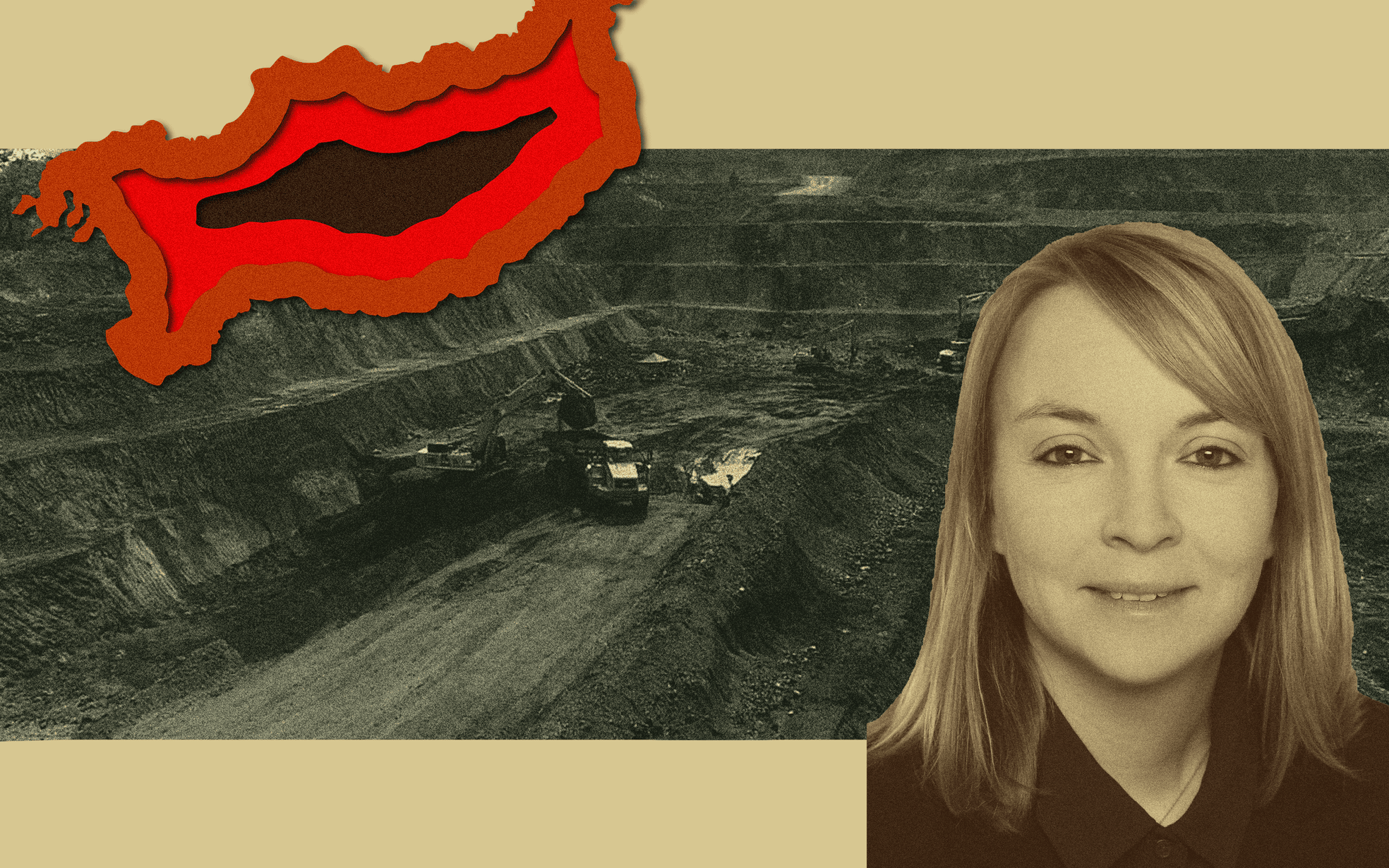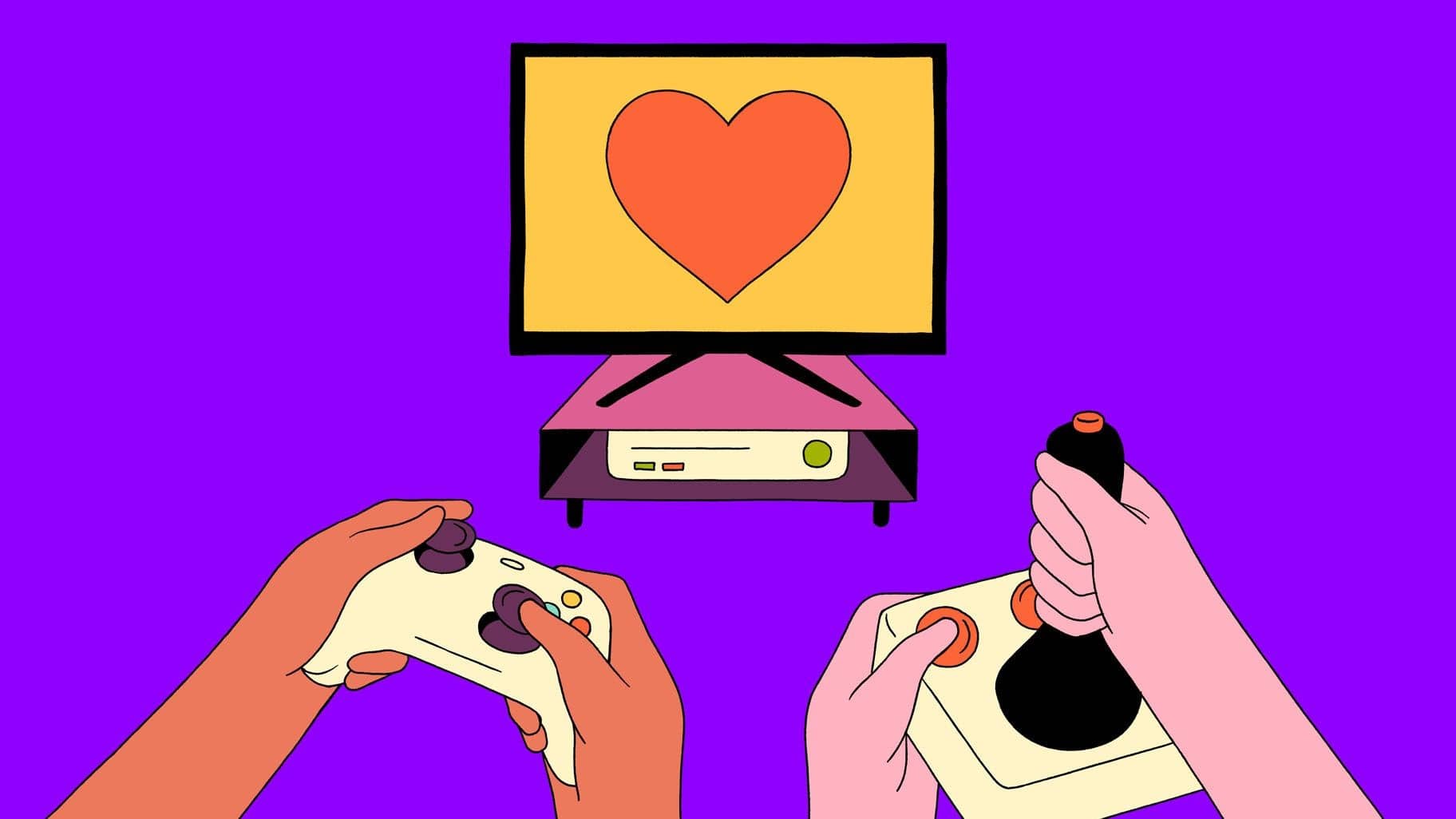Mining Secrets
„Bergbau ist ein extrem intransparenter Sektor“
6. März 2022
-
5 Min. Lesezeit
SZ: Welche Verantwortung tragen deutsche Unternehmen, wenn sie Geschäfte im Ausland machen?
Melanie Müller: Sie müssen sich zunächst einmal an die Gesetzgebung vor Ort halten, also an die dort geltenden Arbeitsstandards, Emissionswerte, Gewässerschutz und so weiter.