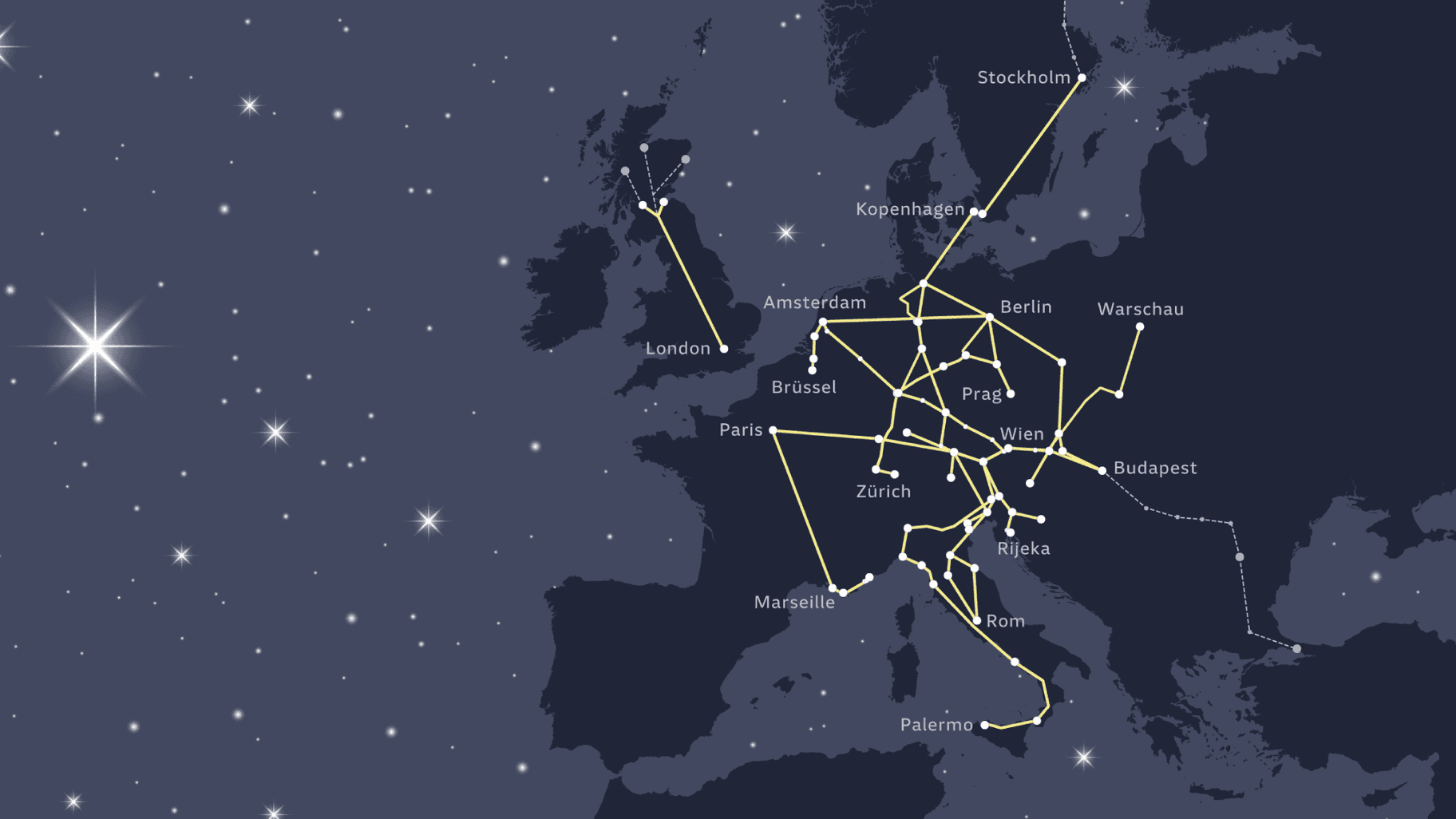Einmal im Leben
Die Schönheit des Taj Mahal genießen
Taj Mahal

Es gibt Sehenswürdigkeiten, die lassen sich nicht durch Overtourism zerstören. Das Taj Mahal ist einer dieser Orte, er liegt etwa 180 Kilometer von Delhi entfernt. Ein Tagesausflug dahin dauert also wirklich einen ganzen Tag, bei den Verkehrsverhältnissen in Indien. Man sollte zwei Übernachtungen einplanen. Vor dem Taj Mahal werden Busladungen entleert, umweltfreundliche Elektro-Zubringer fahren die täglich etwa 40 000 Besucher durch den üppig verzierten Empfangsbereich.
Es folgt eine Art Hütchenlauf vorbei an Selfie-Sticks und Instagram-Paaren. Frisch Verheiratete lassen sich gerne vor der Kulisse des Taj Mahals fotografieren, es ist schließlich nicht nur Unesco-Welterbe, sondern auch ein Monument der Liebe. Der Großmogul Shah Jahan ließ die Grabstätte um 1630 für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen. Tonnenweise wurde Marmor auf Elefanten herbeigeschafft. Jahan fand später neben Mumtaz seine letzte Ruhe.
Dann geht es durch den Park, durch den helle Eichhörnchen jagen, und zum eigentlichen Gebäude hoch, das man nur mit Überschuhen betreten darf.
Der weiße Marmor, der die Schönheit des Ortes ausmacht, soll nicht abgetragen werden. In der Grabstätte umhüllt einen dann eine wohltuende Stille. So wie sich das gehört an so einem Ort. Das Licht ist gedämpft und durch die alten, kalten Steine meint man tatsächlich so etwas wie unendliche Liebe zu spüren. Allerdings ist der Ort selbst leider bedroht. Nicht die vielen Besucher, sondern Umweltschäden setzen dem Taj Mahal seit Jahren zu. Ein Grund mehr, bald hinzufahren.
David Pfeifer
Mit Bullenhaien tauchen auf Fidschi

22 Meter tief auf dem sandigen Meeresboden ist die Wasseroberfläche gerade noch so erkennbar. Die elegant durchs Wasser gleitenden Bullenhaie halten hingegen kaum eine Körperlänge Abstand zu uns Tauchern. Zwischen Raubfisch und Mensch ist hier in den Gewässern der Yasawas in Fidschi kein Käfig. Ist auch viel besser so. Ohne die Barriere lässt sich die Anmut der 14 anwesenden Haie ungestört genießen. Wenn man den ersten Adrenalinschub hinter sich hat.
Die tauchenden Touristen werden von lokalen Guides bestens umsorgt. Sie lenken allzu neugierige Haie mit langen Metallstangen sanft um. Obwohl die Tiere bemerkenswert schlecht sehen, spüren sie die Nähe des Metalls und ändern im letzten Moment ihre Richtung.
Damit auch die Haie etwas vom menschlichen Besuch in der Tiefe haben, stupst ein besonders geschützter Fidschianer mit einem langen Speer Thunfischköpfe in die Höhe. Für die über zwei Meter langen Bullenhaie ist das eher ein Appetithappen. Das Füttern der Haie ist nicht unumstritten, diene aber auch einem wissenschaftlichen Zweck, heißt es. Bei jedem Tauchgang geht ein Wissenschaftler mit hinunter, um die individuellen Persönlichkeitsmuster der Haie zu erforschen.
Nach 40 Minuten ist es Zeit, sich von den majestätischen Tieren zu verabschieden. Jetzt nimmt man auch die bunt leuchtenden Korallenriffe wahr. Auch wenn der Anblick der Haie faszinierend ist, freut man sich doch, die Südseesonne wieder im Gesicht zu spüren. Die Taucher setzen sich an den surreal weißen Sandstrand zwischen die Palmen der Yasawas und stoßen mit einer Kokosnuss auf die beeindruckende Haibegegnung an.
Jonathan Ponstingl
Cable Car fahren in San Francisco

Im Grunde ist die Technik simpel: ein Stahlkabel, das mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde unter der Straße verläuft. Ein Waggon auf Schienen. Und eine Art Klaue, die der „Gripman“, der Fahrer des Wagens, per Handhebel am Drahtseil unter der Straße festklammert – damit sich der Waggon in Bewegung setzt. Mehr braucht es nicht, um die Besucher zu verzücken. Und vielleicht ist es gerade diese Einfachheit, die so fasziniert. In einer Zeit, in der die meisten zwar ihren Flug nach San Francisco über ein kleines Gerät in ihrer Hosentasche buchen, aber nur die wenigsten die komplexe Technik, die dies im Hintergrund ermöglicht, auch wirklich verstehen.
Am 1. September 1873 fuhren die ersten Cable Cars durch die hügelige Stadt am Pazifik. Ihr Erfinder Andrew Smith Hallidie konnte es nicht mehr mitansehen, wie sich die Pferde schinden mussten, um die Waggons die steilen Straßen hinaufzuziehen. So erzählt es zumindest eine Legende.
Tatsächlich war Hallidie wohl vor allem ein findiger Tüftler, der eine für seine Zeit wegweisende Idee hatte und über Geschäftssinn verfügte. Seine einfache, aber verlässliche Kabelbahn kam jedenfalls gut an bei den Menschen – bis im April 1906 zunächst ein Erdbeben und später das Automobil dem einst modernen Verkehrsmittel mehr und mehr zusetzten.
Heute gibt es noch drei Linien, beliebt hauptsächlich bei Touristen. Beim Warten an der Haltestelle hört man mitunter, wie sich das Kabel unter der Straße bewegt. Mit einem Bimmeln nähert sich die Bahn. Bitte Platz nehmen auf den Holzbänken im halb offenen Wagen. Der Gripman legt den Hebel um, los geht’s. So einfach, so simpel.
Marco Völklein
Buckelwale beobachten in der Dominikanischen Republik

Schnorcheln mit Buckelwalen ist ein exklusives Vergnügen, das nur an wenigen Orten weltweit erlaubt ist. Der abgelegenste ist die Silver Bank, ein Riff 90 Kilometer vor der Nordküste der Dominikanischen Republik. Im seichten Meer versammeln sich dort jeden Winter Tausende Wale, um sich zu paaren und ihre Kälber aufzuziehen. Und nur ein paar Boote haben die Lizenz, zu ihnen hinauszufahren.
Für das Schnorcheln gelten strenge Regeln, die wichtigste heißt „passive Begegnung“. Reglos liegen wir also in einer Reihe, starren hinab ins Blau und warten – bis ein Koloss aus der Tiefe auftaucht. Wir sehen den geriffelten, weißen Bauch, die Knubbel ums Maul, die winzigen Augen. Immer näher kommt er, der Magen wird flau, aber im letzten Moment dreht der Wal ab.
Keine Sorge, sagt die Marinebiologin abends beim Gin Tonic auf dem Sonnendeck: Buckelwale würden nie Menschen rammen. Gefährlich seien nur die tollpatschigen Kälber. Aber sie sind eben auch die Stars der folgenden Tage. Die Riesenbabys kuscheln sich an die Flanke der Mutter, tauchen in Pirouetten auf, drehen neugierig eine Runde.
Selbst das Warten auf dem Beiboot ist aufregend: Mal klatschen Bullen mit den Brustflossen aufs Wasser, mal katapultieren sie sich aus dem Meer. Und mit Glück hört man sie singen – so laut, dass unter Wasser die Basstöne im Bauch zu spüren sind. Erhaben ist der Minnegesang nicht: Es gurrt und quietscht, schnarrt und brummt, grunzt und zirpt. Und so bleibt der gefährlichste Moment: als ich vor Lachen Wasser schlucke.
Florian Sanktjohanser
Death Valley

Es hat natürlich schon was, wenn man beim Versuch, den Teenager-Sohn und seine Freunde zur Computerspiel-Pause zu bewegen, sagen kann: „Lass uns doch mal rüber ins Tal des Todes fahren!“ Von Los Angeles sind es in etwa zweieinhalb Autostunden, das Death Valley ist im Dreieck L. A./Las Vegas/San Francisco gelegen und deshalb freilich auch beliebtes Ziel für Westküsten-Touristen. Man fährt hin für ein Foto in Badwater Basin, mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefstgelegene Ort in Nordamerika.
Und natürlich zum Thermometer vor dem Furnace Creek Visitor Center. Dort wurde im Juni 1913 eine Luft-Temperatur von 134 Grad Fahrenheit (57 Grad Celsius) gemessen, die höchste der Geschichte. Beim Besuch im vergangenen Sommer mit dem Sohn und Freunden zeigte das Thermometer 120 Grad Fahrenheit (49 Grad Celsius) an, immerhin – und alle waren begeistert, als sie bemerkten, dass man für ein Spiegelei nur die Pfanne auf die Straße legen muss.
Seinen wahren Zauber entfaltet das Tal jedoch nachts; es gibt Orte, an denen es im Umkreis von zehn Kilometern kein elektrisches Licht gibt. Der Sternenhimmel ist ohne Lichtverschmutzung unvergesslich, man sieht wirklich alle paar Minuten eine Sternschnuppe. Plötzlich fragen die Teenager, ob man ein paar Tage bleiben könne, sie hätten da noch ein paar Ideen für grandiose Fotos beim Wandern – gerade bei Sonnenaufgang sei das Farbenspektakel der Berge geradezu perfekt für coole Bilder. Man akzeptiert – und sieht ein, dass nicht Verbote die Kinder vom Zocken abhalten, sondern bessere Angebote. Eine Fahrt ins Tal des Todes zum Beispiel.
Jürgen Schmieder
Ko Phi Phi

Dass Ko Phi Phi bis heute als Synonym für eine Trauminsel schlechthin gilt, hat maßgeblich mit dem Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio zu tun. Fast 25 Jahre ist er nun alt, aber Maya Bay, der Strand aus dem Film, wird immer noch als „DiCaprio-Beach“ bezeichnet – vor allem, wenn über Overtourism und Umweltschäden berichtet wird.
Man darf Maya Bay nach einer dreijährigen Rekonvaleszenz-Phase wieder betreten, aber nur kurz und gegen Einritt. Runter vom Boot, rauf auf den Strand, Selfie machen, fertig. Die meisten Besucher kommen mit den Speedbooten aus Phuket oder Krabi angerast. Tatsächlich ist Maya Beach ein Teil von Ko Phi Phi Leh, dem „kleinen“ Ko Phi Phi, und da durfte man nie übernachten. Wohingegen das etwas größere Ko Phi Phi Don bis heute über sehr viel Strand verfügt, an dem man sich auch sonnen darf.
So unberührt wie im Traveller-Klischee aus „The Beach“ ist es auch hier nicht mehr, aber doch noch ziemlich so, wie man es sich wünscht, wenn man in München oder Berlin durch den Schneematsch stapft und sich fragt, wo es denn jetzt wohl gerade schöner wäre. Beispielsweise im sogenannten Barefoot-Hotel „Zeavola“, das so etwas wie Luxus mit gutem Gewissen anbietet, wie einige Hotels in der Region. Die Essensreste werden kompostiert, das Wasser recycelt, wer hier übernachtet, leistet schon beim Urlaub Abbitte für die dafür verflogenen Flugkilometer. Das gehört heute ja dringend zur Entspannung. Man kann sich von dort auch nach Maya Bay bringen lassen. Um die Daheimgebliebenen per Instagram neidisch zu machen.
David Pfeifer
Karneval in Venedig

Noch mehr Körperkontakt in den Gassen als sonst, dazu ein Aufpreis fürs Hotelzimmer: Es gibt deutlich bessere Gelegenheiten, Venedig kennenzulernen. Trotzdem ist der Carnevale etwas Besonderes, vor allem jenseits des Rummels zwischen Rialto und Markusplatz. Am schönsten, wie ohnehin in Venedig, wird es abends – wenn die Tagestouristen weg sind und nur vereinzelt elegant gekleidete Paare in Reifrock und mit Dreispitz zu einem der Bälle huschen.
Einmal mitfeiern, davon träumen viele – das kostet allerdings. Das bekannteste Fest ist der üppig inszenierte „Ballo del Doge“, Tickets bis 5000 Euro, dazu kommt der Mietpreis für das historische Kostüm.
Für den Straßenkarneval reicht eine bauta, die typisch venezianische Maske. Die sollte man unbedingt bei einem Handwerksbetrieb kaufen, etwa bei Cá del Sol oder Blue Moon, und nicht in einem Souvenirladen, dort kommen sie nämlich gewiss aus einer Fabrik in China.
Jeder Karneval steht unter einem Motto, diesmal wird des Weltenbummlers Marco Polo gedacht, der vor 700 Jahren gestorben ist. Weltfremd hingegen wirkt die „Festa delle Marie“ am 3. Februar. Da werden zwölf auserwählte junge Schönheiten per Gondel auf den Markusplatz geschifft und dort der Öffentlichkeit präsentiert. Der „Engelsflug“ hingegen vom Campanile, dem Glockenturm, mit einem Seil bis auf die Piazza ist in diesem Jahr nicht geplant.
Ein echtes Stück Venedig bekommt man während des Karnevals in den Konditoreien: die frittelle, oft etwas unförmige, mit Vanillecreme gefüllte Hefekrapfen mit Rosinen, kandierten Früchten und Pinienkernen.
Julia Rothhaas
Die Blaue Lagune

Dass ihre Insel ein Hotspot ist, wissen die Isländer hinlänglich. Die Welt weiß es spätestens seit dem Ausbruch des Eyjafjallajökull, und gerade macht ein anderer Lavastrom den evakuierten Fischerort Grindavík unbewohnbar. Einige Kilometer nördlich des Dorfes liegt die Blaue Lagune, ein touristischer Hotspot. Wochenlang war sie geschlossen. In der ersten Januarwoche wurde sie wieder geöffnet. Kein so gutes Timing, muss man wohl sagen. Inzwischen ist sie wieder zu.
Dabei ist das Eingebettetsein in die – erkaltete – Lava eines der Dinge, die so faszinierend sind an dem Geothermalbad, das in praktischer Nähe zum Flughafen wie auch zum Hauptort Reykjavík liegt. Bei der Anfahrt durch das zerklüftete Gestein wähnt man sich in einem Fantasyfilm. Illahraun, Lava des Schreckens, nennen die Isländer diese Gegend. Am Parkplatz dann: noch mal meterhohe Lava. Dahinter tut sich ein milchig blaugrüner, dampfender See auf; der krasse Gegensatz allein ist schon beeindruckend.
Entstanden ist die Bláa Lónið im Zuge des Baus des 1976 in Betrieb genommenen Geothermalkraftwerks Svartsengi. Das Thermalfreibad speist sich aus heißem Tiefenwasser, das an die Oberfläche geholt wird, um Frischwasser zu erhitzen. Hat es diese Aufgabe erfüllt, darf es im Lavafeld Badegäste erfreuen.
Die reiben sich den Schlick, der sich am Boden des Bads ablagert, gern ins Gesicht – man kennt es halt so von Instagram. Soll auch gut sein für die Haut, wie überhaupt ein Bad im mineralstoffhaltigen Wasser. Muss man nicht machen. Pflicht indes ist es, nackt zu duschen, bevor man ins Wasser steigt. Das dann aber in Badekleidung und gern auch im Winter – mit Ausblick auf einen nordlichternden Himmel.
Monika Maier-Albang
Ksar Draa

Egal, in welche Himmelsrichtung man blickt – nichts als Weite. Und dann, inmitten der Dünen im algerischen Teil der Sahara, erhebt sich auf einmal über einem kleinen Hügel eine runde Burg aus lehmverputzten Steinen: Ksar Draa. Die imposante Festung hat eine Außen- und eine Innenmauer. Und eine Geschichte, die sich im Wüstensand verloren hat.
Im Inneren der Burg befinden sich die Ruinen von Gebäuden, Reste einer kleinen Stadt, die allerdings nicht so gut erhalten ist wie die Außenmauern. Historische Belege gibt es kaum; weder ist bekannt, wer Ksar Draa erbaut hat, noch, wozu genau die geheimnisvolle Festung benutzt wurde. Ksar bedeutet auf Arabisch Burg oder im Maghreb auch wehrhaftes, dauerhaft bewohntes Dorf. Eine Theorie besagt, dass sich hier ein Marktplatz für den Handel mit Gold und Edelmetallen befand. Eine andere, dass Ksar Draa ein Gefängnis war. Wieder eine andere, dass es sich um eine Karawanserei handelte. Die gängigste Version der Algerier ist die, dass einheimische jüdische Kaufleute die Burg vor etwa 1000 Jahren erbauen ließen.
Da es weder eine Straße noch einen Weg nach Ksar Draa gibt, kann man nur mit Kamelen oder zu Fuß dorthin gelangen, was kaum ein Tourist auf sich nimmt. Wie es überhaupt wenig Gäste hierherzieht in die Gegend um die Oasenstadt Timimoun. Algerien hat zwar gerade erst die Einreisebestimmungen und die Visavergabe für die Sahararegion gelockert, doch die Sicherheitslage ist nach wie vor fragil. Der lokale Guide bringt die Kundschaft im sehr gut ausgestatteten Geländewagen zur Burg. Wer möchte, kann im Zelt neben Ksar Draa übernachten. Sternenhimmel, so weit das Auge reicht.
Matthis Kattnig
Big Sur

Es gibt ja kaum ein ausgelutschteres Sprichwort als jenes, dass auf Reisen der Weg das Ziel sein solle und unterwegs spannendere Abenteuer warten würden als am Zielort. Auf die ursprüngliche Bedeutung reduziert ist Big Sur der Ort gewordene Kern dieser Weisheit: Man fährt nicht hierhin, man kommt hier vorbei, zum Beispiel auf einer Fahrt von San Francisco nach Los Angeles.
Man fährt gemütlich auf dem Pacific Coast Highway – rechts der Pazifik, links die Berge und Wälder Kaliforniens; und wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt vielleicht mal anhalten und ein wenig die Natur genießen sollte, dann sollte man genau das tun – kann durchaus passieren, dass man vergisst, dass man eigentlich wohin wollte und ein paar Tage hier bleibt.
Man sitzt am Ozean, man wandert durch die Wälder und umarmt einen Küstenmammutbaum, man paddelt oder planscht im Big Sur River – und dann bemerkt man nach dem Klettern auf einen Hügel, dass Kalifornien der jahreszeitigste Bundesstaat der Welt sein muss – gerade jetzt, von Januar bis April, weil man in Big Sur innerhalb von eineinhalb Autostunden alles erlebt. Im Norden von Big Sur an der Küste: Nordsee-Herbst. Im Osten: Schnee zum Skifahren. Im Wald: Frühling. Und wenn man dann doch einmal weiterfährt auf einer der schönsten – einige nennen sie wegen der Küstenklippen die dramatischste – Autostrecken der Welt, erlebt man, wofür Kalifornien so berühmt ist: Sommer, Sonne, Strand.
Man vergisst in Big Sur, woher man gekommen ist und wohin man wollte – und damit das so bleibt, geben sie einem bei der Ankunft noch eine Weisheit mit auf den Weg; die man versucht, auch an anderen Orten so zu leben: Lasse nichts zurück – außer ein paar Fußabdrücke.
Jürgen Schmieder
Silvester in Rio

Die erste Warnung, die Touristen in Rio de Janeiro zu hören bekommen, ist: Geh bloß nicht nachts an den Strand. In der Dunkelheit und Einsamkeit sind naive Urlauber leichte Beute für Diebe. Diese Regel gilt an 364 Tagen im Jahr, aber nicht am 31. Dezember. Denn an diesem Tag ist nichts mit Einsamkeit.
Dann stehen ungefähr zwei Millionen Menschen am Saum des Meeres an der Copacabana oder in Ipanema. Und in die Dunkelheit strahlen Scheinwerfer von mehreren Bühnen, auf denen Bands spielen oder DJs auflegen. Die meisten Cariocas tragen Weiß, auch viele Touristen halten sich an den Brauch, mit heller Kleidung einen neuen, reinen Anfang zu symbolisieren.
Außerdem ist es in der Silvesternacht üblich, ins Wasser zu waten und Blumen in die Wellen zu werfen. Dabei wünscht man sich was. Adressatin ist die Göttin Iemanjá. Sie ist in den in Afrika wurzelnden, in Brasilien lebhaft praktizierten Naturreligionen zuständig für Meer und Mutterschaft. Ist das erledigt, geht man tanzen oder setzt sich und steckt seine Zehen in den warmen Sand. Selbst nachts hat es in Rio jetzt Temperaturen um die 30 Grad. Dezember ist Sommer in Brasilien.
Abkühlung verschaffen die fliegenden Händler, die Caipirinha anbieten – im Gegensatz zur europäischen Variante mit ganzen Eiswürfeln statt zerstoßenen (schmelzen langsamer) und mit weißem Industriezucker statt braunem Rohrzucker (wie kann man bloß schmutzigen Süßstoff nehmen, wenn es auch sauberen gibt?).
Das gigantische Feuerwerk wird auf dem Wasser von Schiffen und Flößen aus gezündet. Die Party dauert bis Sonnenaufgang. Das Jahr fängt schon mal gut an.
Jochen Temsch
Polarlichter in Lappland

Der Himmel über Nordskandinavien ist immer noch der beste Ort, um Aurora borealis zu sehen. Das sei an dieser Stelle gleich erwähnt, nachdem sich das Polar- oder Nordlicht zuletzt in nicht mehr allzu polare Regionen vorwagte und sogar über den Schweizer Bergen aufleuchtete – natürlich nur als Schatten seiner selbst, sofern sich das in diesem Fall so sagen lässt.
Ursache dafür ist eine ungewöhnlich starke Sonnenaktivität, deren Höhepunkt für 2025 erwartet wird. Eine solche Sonnenaktivität ist wichtig, weil dabei Teilchen ins All geschleudert werden, die in der Erdatmosphäre gewisse Atome zum Leuchten bringen. Dies bedeutet auch, dass weit im Norden in diesem Winter wohl die Post in Sachen Aurora borealis ab- beziehungsweise das Licht angeht. Damit ist auch ein Maximum an touristischen Aktivitäten zu erwarten. Ist doch das Polarlicht seit einigen Jahren ein gewaltiger Publikumsmagnet; einer fast repräsentativen SZ-Umfrage zufolge gibt es keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht einmal gerne Polarlichter sehen würde.
Folglich gibt es Nordlicht-Kreuzfahrten, Nordlicht-Safaris, Nordlicht-Dinner, Nordlicht-Fotokurse oder Polarlicht-Prognose-Apps wie Hello Aurora. In Abisko, dem wegen der – selbst nach Polarnacht-Maßstäben – besonders dunklen Lage hinter den Bergen im Nirgendwo Nordschwedens mitunter besten Ort fürs Polarlicht-Watchen, gibt es eine Aurora Sky Station auf 900 Metern. Und wenn sogar dort Aurora borealis mal wieder hinter Wolken verhüllt bleibt, zeigt es sich womöglich am nächsten Abend vor dem Hotel – zauberhaft grün, wundersam schleiernd. Und ob man will oder nicht: Da steht man dann und staunt den Himmel an.
Dominik Prantl
Eisbären im Eis anschauen

Im Dezember stellt sich allmählich richtiges Eisbärenwetter ein in der Hudson Bay: tagsüber leichter Schneefall bei minus 16 Grad, nachts bis zu minus 26 Grad. Und je kälter es wird, desto besser für den Ursus maritimus, der im polaren Winter auf dem Eis Jagd auf Robben macht.
In der Region um die Hafenstadt Churchill in der kanadischen Provinz Manitoba lebt die südlichste Eisbären-Population der Erde. Der Ort mit gerade mal 870 Einwohnern weiß das für sich zu nutzen, bewirbt sich selbst als „Polar Bear Capital of the World“, Eisbärenhauptstadt der Welt.
Alljährlich reisten zuletzt mehr als eine halbe Million Besucher an, um die gefährlichen Landraubtiere relativ gefahrlos aus hochgelegten Tundra-Buggys – schneeweiße, hohe Allradfahrzeuge – zu beobachten. Ein kostspieliges Vergnügen, das noch jedoch mit vielen Eisbär-Sichtungen belohnt wird. Denn Churchill liegt auf der Wanderroute der Tiere, die sich im Spätherbst vom Hinterland auf den Weg an die Küste machen und dort auf das Zufrieren der Bucht warten.
Wenn sich ein neugieriges Tier einem der hochrädrigen Busse nähert, sich auf die Hinterbeine stellt und dann beinahe auf Augenhöhe mit den Menschen ist, herrscht Stille, die nur vom Klicken der Kameras gestört wird.
Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Bucht immer später zufriert. Das Eis erreicht oft nicht mehr die Dicke, um die bis 450 Kilogramm schweren Tiere tragen zu können. In Churchill sieht man deshalb immer öfter hungrige Bären, die in Mülltonnen nach Nahrung suchen. In Zeiten des Klimawandels schmilzt den Eisbären ihre Lebensgrundlage, das Eis, buchstäblich unter den Tatzen weg.
Ingrid Brunner
Die Riesenwelle von Nazaré

Stanley Kubrick war mit seiner Kamera bereits 1948 in Nazaré. Lange bevor er als Regisseur berühmt wurde, fotografierte der junge US-Amerikaner in Schwarz-Weiß die einsamen portugiesischen Fischer des Küstendorfs, das heute aus ganz anderen Gründen berühmt ist.
Vor dem roten Leuchtturm auf der gemauerten Festung brechen im Winter die größten Wellen, die jemals gesurft wurden.
Und Hunderte Objektive und Smartphones entlang der Steilküste richten sich auf Frauen und Männer, die sich hinter Jetskis in diese Wasserberge ziehen lassen. Neben Hawaii ist Nazaré vor etwas mehr als zehn Jahren zur wichtigsten Haltestelle der sogenannten Big-Wave-Tour geworden.
Nun kann man sich berechtigterweise fragen, warum um Himmels willen ein Mensch auf einem Brett eine 26 Meter hohe Welle hinabrasen sollte. Egal, ob mit Mensch oder ohne: Diese Wellen, die sich kilometerlang aus dem offenen Meer entlang eines Grabens im Meeresboden aufbauen und kurz vor der Küste brechen, verdienen sich eindrücklich das an anderen Orten viel zu leichtfertig gebrauchte Etikett Naturschauspiel.
Der Wind bläst einem an solch einem Wintertag an der Küste den Kopf frei. Die ärgerliche Mail aus dem Arbeitsalltag, die einen am ersten Urlaubstag noch beschäftigt hat, löst sich in der Gischt auf. Empfehlung: dem Drang widerstehen, sofort mit dem Smartphone zu fotografieren und das Bild auf Instagram zu posten.
Stattdessen einfach nur aufs Meer schauen. Das ist, das würden die stillen Fischer von Nazaré gewiss bestätigen, für ein paar Momente einfach mal genug.
Fabian Heckenberger
Die Iguazú-Wasserfälle

Ein Besuch der Iguazú-Wasserfälle will geplant sein. Um die 20 großen und 255 kleinen Katarakte, die sich über knapp drei Kilometer an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien erstrecken, möglichst nah zu erleben. Aber auch, um den Menschenmassen zu entgehen, die täglich über die flächenmäßig größten Wasserfälle der Welt herfallen. Um acht Uhr morgens öffnet der Nationalpark – die beste Zeit, sich zur Garganta del Diablo aufzumachen, einer u-förmigen Schlucht, 700 Meter tief, auf einem Holzsteg über dem Río Iguazú, bis zu einer Plattform über der Wasserkante. Unten donnert und brodelt es, Gischt steigt auf, darin ein Regenbogen. Überirdisch schön und Furcht einflößend. Garganta del Diablo heißt Teufelsschlund – ein passender Name.
Rundwege führen durch dichten Regenwald zu anderen Wasserfällen. Bunte Schmetterlinge flattern durch die frische Morgenluft, Papageien und Sittiche, Kolibris und Tukane. An einem Baum hängt ein Faultier, ein Ameisenbär stolziert über den Weg. Die Zwillingsfälle Adan y Eva, Adam und Eva, stürzen senkrecht in die Tiefe, der Mbiguá-Wasserfall ergießt sich über Felsstufen.
Weil die meisten Wasserfälle am argentinischen Flussufer liegen, hat man von der brasilianischen Seite die beste Aussicht. Am schönsten ist es bei Sonnenuntergang. Aber dann ist der Nationalpark schon geschlossen. Die Lösung: eine Nacht im Belmond Cataratas, einem Luxushotel.
Der Spaß kostet 800 Euro für das Doppelzimmer. Mindestens. Dafür muss man die Trilha das Cataratas nur mit den anderen Hotelgästen teilen. Der Wanderweg endet mitten im Inferno. Es zischt und dampft und donnert von oben, unten, von rechts und von links. Dazu der Farbrausch der untergehenden Sonne. Welch ein Spektakel.
Tom Noga
Mit einer Dschunke in der Halong-Bucht

Feuerspeiende Wesen mit schuppigen Rücken sind ein großes Ding in Asien, natürlich auch in Vietnam, und erst recht an einem der berühmtesten Touristenziele des Landes: der Halong-Bucht. Der Name bedeutet „herabsteigender Drache“. Gleich mehrere Ungeheuer sollen es der Legende nach gewesen sein, die hier Feinde des Jadekaisers vernichteten, dabei Zähne verloren, die zu Inseln wurden. Genau 1969 Felsen sind es offiziell, eine Zahl, die zufällig dem Todesjahr des nordvietnamesischen Revolutionärs Ho Chi Minh entspricht.
Bizarr ragen die labyrinthisch angeordneten Kalksteinformationen aus dem türkisfarbenen Wasser – ein surrealer Anblick, der durch die tiefroten oder gelben Segel vorbeigleitender (aber in Wahrheit dieselgetriebener) Dschunken noch reizvoller wird. Am besten genießt man das zum Welterbe der Unesco zählende Meeresgebirge auf einem mehrtägigen Törn mittendurch. Ein meditatives Erlebnis. Ein komfortables auch. Die guten Schiffe sind geschmackvoll in dunklem Holz gehalten, ausgestattet mit klimatisierten Doppelkabinen, eigenem Bad und tollen Köchen. Die schlechten Schiffe, die Seelenverkäufer, erkennt man am niedrigen Preis.
Auf den geräumigen Sonnendecks vergehen die Stunden mit Schauen, gelegentlich legt man an Grotten oder Felsen mit Aussichtspagoden an. Manchmal verlangsamt der Kapitän die Fahrt, um Seenomaden vorbeizulassen, die mit ihren Familien, Wachhunden und Fernsehern auf Flößen leben und Fisch züchten, den sie nach China verkaufen. Aber das Genialste sind die geschnitzten Drachenköpfe zur Abwehr böser Geister am Bug der Dschunken. Wenn man sich bei sanfter Dünung auf einen setzt, ist es wie im Fantasy-Film: ein Ritt auf einem Drachen.
Jochen Temsch
Spitzkoppe

Natürlich hat auch Hollywood diesen Platz mal wieder entdeckt, wie immer, wenn etwas außerirdisch schön wirkt oder prähistorisch urtümlich anmutet. Der hier gedrehte Film wird in seiner ganzen Hirnrissigkeit der einzigartigen Spitzkoppe allerdings so wenig gerecht, dass sein Name an dieser Stelle verschwiegen werden soll.
Typisch auch, dass die Große Spitzkoppe – so der präzise Name des 1728 Meter hohen Gipfels – als klassische Bergschönheit mit dem üblichen Reisestereotyp „Matterhorn Namibias“ abgehandelt wird, obwohl sie wenig von einem Matterhorn hat, kein Eis, keinen Schnee, kaum Gipfelaspiranten, dafür einen rötlichen Teint, der seine Farbe im Tagesverlauf ändert.
Sie steht auch nicht in einem Gebirge, sondern ragt als Inselberg zusammen mit ein paar anderen, teils bienenkorbförmigen Granitriesen namens Pontoks bis zu 700 Meter aus der wüsten Ebene West-Namibias heraus, eine zweistündige Fahrt von der deutschkolonial geprägten Küstenstadt Swakopmund entfernt. Auf einem Campingplatz, weitläufig genug, um sich einsam zu fühlen, stellt man den Wagen samt Dachzelt im Schatten gewaltiger Felskugeln ab, um dann je nach Gusto glücklich zu werden, ob Grillfanatiker, Vogelgucker, Wüstenbotaniker, Felsmalereien-Forscher oder Sportkletterer (die 1946 erstmals bestiegene Große Spitzkoppe selbst ist nur was für Könner).
Am Frühstück bedienen sich Borstenhörnchen, auf den Felsen sitzen kleine Drachen mit roten Köpfen, Siedleragamen. Und nachts, wenn vor lauter Dunkelheit auch die Sterne am Ende des Universums leuchten, krabbelt ein Skorpion vorbei. Bis zum nächsten Krankenhaus ist es ein Stück.
Dominik Prantl
Diskobucht in Ilulissat

Bevor sie uns am Hafen von Ilulissat ins Boot lassen, bekommt jeder eine dieser Jacken: windabweisend nach außen, kuschelig warm im Inneren, weil mit Robbenfell gefüttert. Die Tierschützerin in mir schaudert’s, aber dann, kaum sind wir eine halbe Stunde draußen bei zweistelligen Minusgraden, erkenne ich den Wert der Jacke. Sie ermöglicht es, an Deck zu bleiben, zu sehen, zu staunen.
Riesige Eisberge treiben hier, in der Diskobucht im Westen Grönlands, auf dem Wasser. Es müssen Hunderte sein. Das Sonnenlicht ist beißend klar, das Meer unwirklich türkis-blau-durchscheinend. Unter der Oberfläche: noch mehr Eis, viel mehr Eis. Die Berge ragen in die Tiefe, ein Kosmos wie aus einem Computerspiel, als würde man einen fremden Planeten erkunden. Eine Stunde fahren wir durch den Irrgarten, und ich kann mich nicht sattsehen, weiß gar nicht, woher dieses Glücksgefühl kommt, es ist doch nur Eis und Kälte und – Leben!
Robben, Fische, Krill, wer Glück hat, sieht Wale. Das Wasser in der Bucht ist extrem nährstoffreich. Vor mehr als 4000 Jahren siedelten hier schon Jäger. Die Saqqaq-Kultur verschwand, vermutlich infolge einer Klimaabkühlung. Jetzt wird es immer wärmer, die Gletscher kalben ihr letztes Eis hinaus in die Welt. Selbst ein Riese wie der Sermeq Kujalleq, der als einer der aktivsten Gletscher der Erde gilt und bislang den Ilulissat-Eisfjord speist, zerfließt vor unseren Augen. Es wird keine Eisriesen mehr geben, nur noch Eisköniginnen in Fantasy-Filmen. Vielleicht setzen die dann rote Segel im weißen Eis, auch das wird wunderbar aussehen, es ist halt nur nicht real life.
Monika Maier-Albang
Nabayotum-Krater am Turkana-See

Ein riesiger Trichter, die Wände steil, an seinen Flanken verläuft schwarze Lava im Sand der Wüste, vermischt mit smaragdgrünem Wasser. Wenn es Gott gäbe – das wäre ein Blick in seine Werkstatt: wild modelliert und verdammt viel Farbe verschüttet bei einem der ersten Versuche, die Welt zu erschaffen in diesem Glutofen im Großen Afrikanischen Grabenbruch.
Das mit der Anfängen des Lebens ist nicht übertrieben. Metaphysisch, mindestens surreal fühlt es sich an, hier auf einem Felsbrocken zu sitzen und sich an etwas zu erinnern, das man doch gar nicht erlebt haben kann. Aber der Ort ist real, es gibt ihn auf Erden: den Nabayotum-Krater am Turkana-See im Norden Kenias, der zum Teil in Äthiopien liegt. Es ist der größte Wüstensee der Welt, zwölfmal größer als der Bodensee. In seinem alkalischen Wasser schwimmen Krokodile, seine Ufer sind ein Forschungsfeld prähistorischen Lebens.
Einer der bedeutendsten Funde war das komplette Skelett eines Jungen, der vor 1,5 Millionen Jahren an einem entzündeten Milchzahn starb – Beleg für die These, dass die Wiege der Menschheit in Afrika lag, und zwar auch genau hier. Nabayotum-Krater, Nabel der Welt.
Diesen isolierten Ort aufzusuchen, hat seinen Preis und ist gefährlich. Es gibt keine Infrastruktur, keine Straßen, nichts. Von Nairobi aus sind es drei Tage mit dem Jeep durch die Wüste an den See, sicherer ist es mit einem Helikopter von einem der sehr wenigen Camps der Umgebung aus. So weit weg – aber näher am Anfang von allem geht es nicht.
Jochen Temsch
Torres del Paine

Argentinier und Chilenen können lange darüber streiten, welcher Teil Patagoniens schöner ist. Über das größte Naturwunder aber sind sich zumindest ihre Gäste einig. Die Torres del Paine sind eine globale Ikone, 2013 wurde der chilenische Nationalpark mit seinen Granitnadeln und türkisen Gletscherseen online zum achten Weltwunder gewählt.
Die Massen kamen schon vorher und kommen nach wie vor. Auf dem sogenannten W-Trek wandern sie in vier Tagen um die berühmtesten Berge oder machen die ganze Runde, den O-Trek – beide sind nach ihrer Form benannt. 300 000 Besucher wurden vor der Pandemie gezählt, dieses Jahr dürften es wieder ähnlich viele sein. Wer im Valle del Silencio nicht bitter über den Namen lachen und sich die patagonischen Drei Zinnen nicht mit Horden von Selfie-Süchtigen teilen will, kommt dann, wenn auf der Südhalbkugel Frühling ist. Oder steigt ins Kajak.
Bei der Anfahrt am frühen Morgen zeigen sich Herden von Guanakos, eine einheimische Kamel-Art. Kondore zerfleddern einen Kadaver. In den Seen staksen Flamingos, dahinter spiegeln sich schneebedeckte Flanken und glühende Felszacken. Eingepackt in Trockenanzüge, paddelt man auf den Lago Grey hinaus, in einen Skulpturenpark blau leuchtender Eisberge.
Noch einsamer wird es im Sattel. Über bleiches Tussockgras führt ein Ritt zur Laguna Azul und durch den Fluss Las Chinas zu einem Wasserfall. Alles wunderbar – bis die beiden Gauchos an der Spitze Lust auf Trab bekommen. Und dann auf Galopp. Gnadenlos staucht es den Reitdilettanten in den Sattel, am Abend schmerzen Hintern, Rücken und Knie. Was nun hilft? Nur Rotwein und gegrilltes Asado-Lamm, beste Gaucho-Medizin.
Florian Sanktjohanser
Die Oper von Sydney

Natürlich kann man im Opernhaus von Sydney eine Oper erleben. Muss man aber nicht. Wer solche Pläne hat, sollte sich der Gefahr bewusst sein, dass man ein Ehepaar aus Köln als Sitznachbarn hat, das ausführlich berichtet, zu Hause in der Philharmonie sei die Akustik besser. Das Schöne ist: Selbst dann ist die Magie dieses Ortes unerschütterlich. In der Pause, auf einer der Terrassen mit Blick auf den schimmernden Pazifik, wird selbst der redseligste Rheinländer ganz still.
Die Oper von Sydney ist kein Gebäude, das man im gewöhnlichen Sinn besichtigt, obwohl auch das lohnenswert ist (die Concert Hall, der größte von sechs Sälen, ist eine moderne Kathedrale aus Holz). Es ist ein Ort, dem man sich nähert, vom Land, vom Wasser – an der Reling einer Hafenfähre – oder auch aus der Luft, wenn man nebenan die Harbour Bridge erklimmt. Fast gleich aus welchem Winkel: Es ist ein Ort, an dessen Kühnheit und Optimismus man sich kaum sattsehen kann.
Die Oper steht auf dem Bennelong Point, einer winzigen Halbinsel, die nach einem Aborigine benannt ist. Wer hier ein wenig verweilt, und sei es auch nur in der Freiluft-Bar unten am Hafenbecken, der spürt, dass an diesem Ort zugleich das Herz eines jungen Staates und das einer alten Zivilisation schlägt. Die Silhouette des Operndachs ist zum globalen Bildzeichen dieses Landes geworden.
Touristen kommen eigentlich nicht nach Australien, um Dinge zu sehen, die der Mensch geschaffen hat. Das Sydney Opera House ist die eine Ausnahme. Einmal leibhaftig vor diesen ebenso mächtigen wie eleganten Segeln zu stehen, die ein gütiger Wind aufzublasen scheint: Das ist ein Privileg, und zwar eines, das jeder Tourist dem Architekten voraushat. Der Däne Jørn Utzon verließ Sydney während des Baus 1966 im Streit und kehrte niemals zurück.
Von Roman Deininger
Die Altstadt von Quito

Der Himmel ist hier nah. Das ist in Quito wörtlich zu verstehen: Schließlich liegt Ecuadors Hauptstadt auf fast 3000 Metern inmitten der Anden. Dass der Himmel in metaphysischer Hinsicht allerdings nicht so leicht zu erreichen ist, auch das weiß man in dieser Stadt. Unzählige Kirchen und Klöster in der Altstadt erinnern daran: Weicht der Mensch vom rechten Wege ab, so drohe die Hölle.
Wie entsetzlich die aussehen könnte, zeigt ein Horror-Gemälde in der Jesuitenkirche La Compañía de Jesús, die ansonsten über und über mit Blattgold geschmückt ist. Auf überwältigende Weise demonstriert sie Glanz und Elend, Reichtum und Ausbeutung der Kolonialzeit, die bis heute nachwirken. Hier leuchtet wirklich jedem ein, warum Quitos Altstadt, 1534 von den Spaniern gegründet, wegen ihrer opulenten Kolonialarchitektur und Kunstschätze 1978 als erste Stadt überhaupt zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde.
Gleißende Äquatorsonne lässt die weiß getünchten Gebäude des weitläufigen und belebten Centro Histórico tagsüber strahlen. Naht der Abend, empfiehlt es sich, den Abstand zum Himmel noch etwas zu verringern und den Sonnenuntergang über den Dächern zu erleben, am besten auf der Terrasse des „Vista Hermosa“. Dort hat man sie direkt vor sich, die einstigen und heutigen Zentren der Macht, die Kathedrale und den Regierungspalast, für manche ein Symbol für die politischen Höllenkreise des Landes. Immerhin wacht über allem, auf dem Panecillo-Hügel, eine riesengroße Madonnenstatue. Und angesichts des spektakulären Blicks über die Stadt- und Berglandschaft bleibt vor allem dieser Gedanke haften: Dem Himmel sei Dank.
Antje Weber
In die Alhambra

Oh ja, es wird heiß in Granada im Hochsommer. Selbst unter der Markise im „Cafe 4 Gatos“ steht die Luft, dafür ist der Blick auf Hügel und Burg vielversprechend. Und ebenso die Aussicht, nach der Siesta dort oben zu sein, in der „roten Festung“, „Qal’at al-hamra“, der Alhambra
Denn sie wussten hier schon zu leben, die Reichen im ausgehenden Mittelalter: kühlendes Geplätscher in den Innenhöfen, bunte Fliesen, geometrisch angeordnet, überall Säulen, verziert mit prachtvollen Kalligrafien, Koranfragmenten und Stuckatur. Die Wände schimmern je nach Lichteinfall mal feiner, mal kräftiger rot aufgrund des eisenhaltigen Tons, aus dem die Ziegel gefertigt wurden. Eine Burg, die einem Sakralbau ähnelt, ein Traum aus Tausendundeiner Nacht, und das so nah – man muss nicht mal übers Mittelmeer fliegen, um sich dieses Meisterstück arabischer Kunstfertigkeit anzusehen.
Die Nasridenherrscher ließen die Anlage im 13. und 14. Jahrhundert erbauen. Sie besteht aus mehreren Palästen. Man schlendert durch den Myrten- und Löwenhof, nimmt die späten Bauphasen mit Anleihen aus der italienischen Renaissance in Kauf, die der katholische Eroberer Karl V. von 1526 an in Auftrag gab, nachdem das Emirat von Granada aufgehört hatte zu existieren.
Immerhin: Er ließ die islamische Kunst stehen. Heute ist die Alhambra nicht nur Unesco-Weltkulturerbe, sie gilt auch als Symbol der Mittelmeerkultur, aus der Europa entstanden ist – und die eben nicht nur durch christliche, sondern neben jüdischen auch durch muslimische Einflüsse geprägt ist.
Und wem das zu bedeutungsschwer ist, der kann auch einfach nur die kühlen Räume genießen. Oder besser noch im Frühling kommen, wenn die Temperaturen noch niedriger sind und die Zitronenbäume blühen.
Monika Maier-Albang
Auf der Brücke von Avignon

Die Brücke von Avignon kennt jedes Kind. Das Lied vom Tanz auf dem rudimentären Bauwerk kommt schon in Kitas zum Einsatz: Die Herren machen so, die Damen so, die Wäscherinnen und Soldaten so, so, so. In der Realität wäre so ein Tanz problematisch. Der Pont Saint-Bénézet, so der offizielle Name der Brücke, ist so schmal, dass kaum drei Menschen nebeneinander stehen können.
Ihr Geländer ist zudem so niedrig, dass man bei einem allzu ausladenden Hüftschwung fürchten müsste, aus Versehen jemanden in die Rhône zu schubsen. Kinder sollen, so steht es auf Warnschildern, zur Sicherheit ständig an der Hand gehalten werden.
Und es gibt noch mehr Missverständnisse. In der ursprünglichen Fassung des Lied-Textes hieß es „sous le pont“, unter der Brücke, statt „sur“ (auf) – gemeint war eine Fluss-Insel, auf der die mittelalterlichen Jahrmärkte stattfanden und die über den steinernen Steg zu erreichen war. Kriege und die Kräfte der mächtigen Rhône machten den Pfeilern zu schaffen. Für den Warenverkehr mit Fuhrwerken war die Brücke sowieso zu schmal, dazu nahm man Boote, also ließ man sie im 17. Jahrhundert verfallen.
Und: Weder sous noch sur ist die Brücke am schönsten, sondern von einer anderen Brücke aus. Der Pont Édouard Daladier bietet eine Postkartenaussicht auf die Brücke mit Altstadt und Papstpalast, er ist allerdings intakt – also für sich genommen unspektakulär.
Jochen Temsch
Crystal River
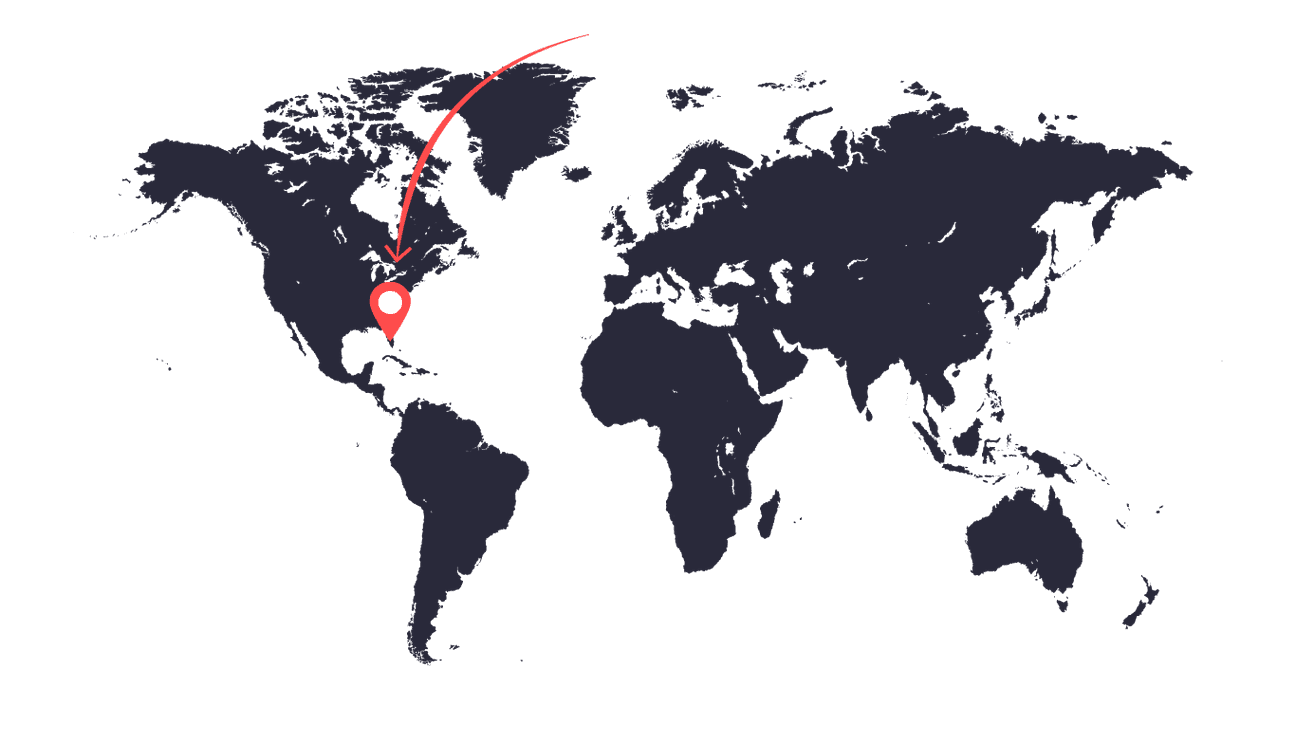
Fragt man Taucher nach ihren Träumen, bekommt man viel Erhabenes zu hören. Die einen wollen Walhaie sehen, die anderen Mantas. Meine Sehnsuchtstiere sehen aus wie graue Würste, mit Stummelarmen, Knopfaugen und Borsten um die runzlige Schnauze. Aber was Seekühen in puncto Eleganz fehlt, gleichen sie durch Charakter aus. Tiefenentspannt sollen sie sein, manchmal umarmen sie angeblich Menschen.
15 Jahre lang bin ich ihnen nachgetaucht, in Indonesien und Ägypten, Mexiko und Mosambik. Vergeblich. Und nun, in einem Kaff im Nordwesten Floridas, stecke ich beim Schnorcheln den Kopf unter Wasser – und sehe sofort meine erste Seekuh.
„Welthauptstadt der Manatis“ nennt sich Crystal River, die knuffigen Dickhäuter liegen als Plüschtiere in Souvenirläden, zieren Nummernschilder und Wappen der Stadt. Von Mitte November an, wenn der Golf von Mexiko kälter als 20 Grad wird, schwimmen sie die Flüsse herauf. Hunderte Rundschwanzseekühe drängen sich dann in den warmen Quellen, wo sie seit 1983 geschützt sind.
Am schönsten ist es dort früh am Morgen, wenn noch Nebel zwischen Palmen und Virginia-Eichen hängt. In den Three Sisters Springs sehe ich die Seekühe im extrem klaren Wasser hinter einer Bojenleine dösen. Alle paar Minuten hebt sich ihr Oberkörper, bis die Nasenlöcher aus dem Wasser spitzen. Tief atmen, dann sinken sie wieder auf den Grund.
In der Kings Spring dagegen wollen sie spielen. Neugierig schwimmt ein Manati heran, stupst mich an, gleitet unter mir hindurch und rollt sich auf den Rücken wie ein Welpe, der gekrault werden möchte. Ich muss lachen, schlucke Wasser. Und bin endlich ein seliger Taucher.
Florian Sanktjohanser
Auf die Drei Zinnen klettern

Zugegeben, ein Geheimtipp sind die Drei Zinnen ungefähr seit der Erstbesteigung der Großen Zinne im Jahr 1869 nicht mehr. Aber welcher Berg mit einem derartigen Profil, mit einem derartigen Bekanntheitsgrad ist das noch? Der Watzmann? Wird trotz seines Rufs als grausamer, längst petrifizierter Tyrann überrannt von den Massen, und das im Wortsinne. Das Matterhorn? Hat eine derartige Strahlkraft, dass selbst weit entfernte Seen bevölkert werden, in denen sich die Bergpyramide nur spiegelt.
Und natürlich ist auch eine Touristenfütterungsstelle wie die Dreizinnenhütte (2405 Meter) zu Füßen des Dreigestirns der reinste Spießrutenlauf für Misanthropen. Laut Hütten-Website gehen dort schon im Februar mehr als tausend Übernachtungsanfragen für die Hochsaison ein. Im Sommer ist dann meist die Hölle los vor lauter Halbschuh-Alpinisten, die ihre Fotobibliothek mit dem Trio aus Felszähnen bereichern wollen.
Und doch gibt es auch dort noch Ruhe. An einem sonnigen Donnerstag Anfang Juni etwa sah ich beim Aufstieg zur Großen Zinne über den Kletterei abverlangenden Normalweg genau einen Menschen: meinen Seilpartner. Am Gipfel ging der Blick 600 Höhenmeter hinab zur noch geschlossenen Dreizinnenhütte, davor die abfallenden Schotterfelder und nur sehr wenige Ameisenmenschen. Denn merke: Mag ein Einmal-im-Leben-Platz auch noch so beliebt sein, so gibt es doch meistens eine Zeit, den Massen aus dem Weg zu gehen. Schon Ende September geht die Dreizinnenhütte wieder in den Winterschlaf.
Dominik Prantl

Einmal im Leben
Die Schönheit des Taj Mahal genießen


Taj Mahal

Es gibt Sehenswürdigkeiten, die lassen sich nicht durch Overtourism zerstören. Das Taj Mahal ist einer dieser Orte, er liegt etwa 180 Kilometer von Delhi entfernt. Ein Tagesausflug dahin dauert also wirklich einen ganzen Tag, bei den Verkehrsverhältnissen in Indien. Man sollte zwei Übernachtungen einplanen. Vor dem Taj Mahal werden Busladungen entleert, umweltfreundliche Elektro-Zubringer fahren die täglich etwa 40 000 Besucher durch den üppig verzierten Empfangsbereich.

Es folgt eine Art Hütchenlauf vorbei an Selfie-Sticks und Instagram-Paaren. Frisch Verheiratete lassen sich gerne vor der Kulisse des Taj Mahals fotografieren, es ist schließlich nicht nur Unesco-Welterbe, sondern auch ein Monument der Liebe. Der Großmogul Shah Jahan ließ die Grabstätte um 1630 für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen. Tonnenweise wurde Marmor auf Elefanten herbeigeschafft. Jahan fand später neben Mumtaz seine letzte Ruhe.

Dann geht es durch den Park, durch den helle Eichhörnchen jagen, und zum eigentlichen Gebäude hoch, das man nur mit Überschuhen betreten darf.

Der weiße Marmor, der die Schönheit des Ortes ausmacht, soll nicht abgetragen werden. In der Grabstätte umhüllt einen dann eine wohltuende Stille. So wie sich das gehört an so einem Ort. Das Licht ist gedämpft und durch die alten, kalten Steine meint man tatsächlich so etwas wie unendliche Liebe zu spüren. Allerdings ist der Ort selbst leider bedroht. Nicht die vielen Besucher, sondern Umweltschäden setzen dem Taj Mahal seit Jahren zu. Ein Grund mehr, bald hinzufahren.
David Pfeifer

Mit Bullenhaien tauchen auf Fidschi

22 Meter tief auf dem sandigen Meeresboden ist die Wasseroberfläche gerade noch so erkennbar. Die elegant durchs Wasser gleitenden Bullenhaie halten hingegen kaum eine Körperlänge Abstand zu uns Tauchern. Zwischen Raubfisch und Mensch ist hier in den Gewässern der Yasawas in Fidschi kein Käfig. Ist auch viel besser so. Ohne die Barriere lässt sich die Anmut der 14 anwesenden Haie ungestört genießen. Wenn man den ersten Adrenalinschub hinter sich hat.

Die tauchenden Touristen werden von lokalen Guides bestens umsorgt. Sie lenken allzu neugierige Haie mit langen Metallstangen sanft um. Obwohl die Tiere bemerkenswert schlecht sehen, spüren sie die Nähe des Metalls und ändern im letzten Moment ihre Richtung.
Damit auch die Haie etwas vom menschlichen Besuch in der Tiefe haben, stupst ein besonders geschützter Fidschianer mit einem langen Speer Thunfischköpfe in die Höhe. Für die über zwei Meter langen Bullenhaie ist das eher ein Appetithappen. Das Füttern der Haie ist nicht unumstritten, diene aber auch einem wissenschaftlichen Zweck, heißt es. Bei jedem Tauchgang geht ein Wissenschaftler mit hinunter, um die individuellen Persönlichkeitsmuster der Haie zu erforschen.

Nach 40 Minuten ist es Zeit, sich von den majestätischen Tieren zu verabschieden. Jetzt nimmt man auch die bunt leuchtenden Korallenriffe wahr. Auch wenn der Anblick der Haie faszinierend ist, freut man sich doch, die Südseesonne wieder im Gesicht zu spüren. Die Taucher setzen sich an den surreal weißen Sandstrand zwischen die Palmen der Yasawas und stoßen mit einer Kokosnuss auf die beeindruckende Haibegegnung an.
Jonathan Ponstingl

Cable Car fahren in San Francisco

Im Grunde ist die Technik simpel: ein Stahlkabel, das mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde unter der Straße verläuft. Ein Waggon auf Schienen. Und eine Art Klaue, die der „Gripman“, der Fahrer des Wagens, per Handhebel am Drahtseil unter der Straße festklammert – damit sich der Waggon in Bewegung setzt. Mehr braucht es nicht, um die Besucher zu verzücken. Und vielleicht ist es gerade diese Einfachheit, die so fasziniert. In einer Zeit, in der die meisten zwar ihren Flug nach San Francisco über ein kleines Gerät in ihrer Hosentasche buchen, aber nur die wenigsten die komplexe Technik, die dies im Hintergrund ermöglicht, auch wirklich verstehen.

Am 1. September 1873 fuhren die ersten Cable Cars durch die hügelige Stadt am Pazifik. Ihr Erfinder Andrew Smith Hallidie konnte es nicht mehr mitansehen, wie sich die Pferde schinden mussten, um die Waggons die steilen Straßen hinaufzuziehen. So erzählt es zumindest eine Legende.

Tatsächlich war Hallidie wohl vor allem ein findiger Tüftler, der eine für seine Zeit wegweisende Idee hatte und über Geschäftssinn verfügte. Seine einfache, aber verlässliche Kabelbahn kam jedenfalls gut an bei den Menschen – bis im April 1906 zunächst ein Erdbeben und später das Automobil dem einst modernen Verkehrsmittel mehr und mehr zusetzten.

Heute gibt es noch drei Linien, beliebt hauptsächlich bei Touristen. Beim Warten an der Haltestelle hört man mitunter, wie sich das Kabel unter der Straße bewegt. Mit einem Bimmeln nähert sich die Bahn. Bitte Platz nehmen auf den Holzbänken im halb offenen Wagen. Der Gripman legt den Hebel um, los geht’s. So einfach, so simpel.
Marco Völklein

Buckelwale beobachten in der Dominikanischen Republik

Schnorcheln mit Buckelwalen ist ein exklusives Vergnügen, das nur an wenigen Orten weltweit erlaubt ist. Der abgelegenste ist die Silver Bank, ein Riff 90 Kilometer vor der Nordküste der Dominikanischen Republik. Im seichten Meer versammeln sich dort jeden Winter Tausende Wale, um sich zu paaren und ihre Kälber aufzuziehen. Und nur ein paar Boote haben die Lizenz, zu ihnen hinauszufahren.
Für das Schnorcheln gelten strenge Regeln, die wichtigste heißt „passive Begegnung“. Reglos liegen wir also in einer Reihe, starren hinab ins Blau und warten – bis ein Koloss aus der Tiefe auftaucht. Wir sehen den geriffelten, weißen Bauch, die Knubbel ums Maul, die winzigen Augen. Immer näher kommt er, der Magen wird flau, aber im letzten Moment dreht der Wal ab.

Keine Sorge, sagt die Marinebiologin abends beim Gin Tonic auf dem Sonnendeck: Buckelwale würden nie Menschen rammen. Gefährlich seien nur die tollpatschigen Kälber. Aber sie sind eben auch die Stars der folgenden Tage. Die Riesenbabys kuscheln sich an die Flanke der Mutter, tauchen in Pirouetten auf, drehen neugierig eine Runde.
Selbst das Warten auf dem Beiboot ist aufregend: Mal klatschen Bullen mit den Brustflossen aufs Wasser, mal katapultieren sie sich aus dem Meer. Und mit Glück hört man sie singen – so laut, dass unter Wasser die Basstöne im Bauch zu spüren sind. Erhaben ist der Minnegesang nicht: Es gurrt und quietscht, schnarrt und brummt, grunzt und zirpt. Und so bleibt der gefährlichste Moment: als ich vor Lachen Wasser schlucke.
Florian Sanktjohanser

Death Valley

Es hat natürlich schon was, wenn man beim Versuch, den Teenager-Sohn und seine Freunde zur Computerspiel-Pause zu bewegen, sagen kann: „Lass uns doch mal rüber ins Tal des Todes fahren!“ Von Los Angeles sind es in etwa zweieinhalb Autostunden, das Death Valley ist im Dreieck L. A./Las Vegas/San Francisco gelegen und deshalb freilich auch beliebtes Ziel für Westküsten-Touristen. Man fährt hin für ein Foto in Badwater Basin, mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefstgelegene Ort in Nordamerika.

Und natürlich zum Thermometer vor dem Furnace Creek Visitor Center. Dort wurde im Juni 1913 eine Luft-Temperatur von 134 Grad Fahrenheit (57 Grad Celsius) gemessen, die höchste der Geschichte. Beim Besuch im vergangenen Sommer mit dem Sohn und Freunden zeigte das Thermometer 120 Grad Fahrenheit (49 Grad Celsius) an, immerhin – und alle waren begeistert, als sie bemerkten, dass man für ein Spiegelei nur die Pfanne auf die Straße legen muss.

Seinen wahren Zauber entfaltet das Tal jedoch nachts; es gibt Orte, an denen es im Umkreis von zehn Kilometern kein elektrisches Licht gibt. Der Sternenhimmel ist ohne Lichtverschmutzung unvergesslich, man sieht wirklich alle paar Minuten eine Sternschnuppe. Plötzlich fragen die Teenager, ob man ein paar Tage bleiben könne, sie hätten da noch ein paar Ideen für grandiose Fotos beim Wandern – gerade bei Sonnenaufgang sei das Farbenspektakel der Berge geradezu perfekt für coole Bilder. Man akzeptiert – und sieht ein, dass nicht Verbote die Kinder vom Zocken abhalten, sondern bessere Angebote. Eine Fahrt ins Tal des Todes zum Beispiel.
Jürgen Schmieder

Ko Phi Phi

Dass Ko Phi Phi bis heute als Synonym für eine Trauminsel schlechthin gilt, hat maßgeblich mit dem Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio zu tun. Fast 25 Jahre ist er nun alt, aber Maya Bay, der Strand aus dem Film, wird immer noch als „DiCaprio-Beach“ bezeichnet – vor allem, wenn über Overtourism und Umweltschäden berichtet wird.

Man darf Maya Bay nach einer dreijährigen Rekonvaleszenz-Phase wieder betreten, aber nur kurz und gegen Einritt. Runter vom Boot, rauf auf den Strand, Selfie machen, fertig. Die meisten Besucher kommen mit den Speedbooten aus Phuket oder Krabi angerast. Tatsächlich ist Maya Beach ein Teil von Ko Phi Phi Leh, dem „kleinen“ Ko Phi Phi, und da durfte man nie übernachten. Wohingegen das etwas größere Ko Phi Phi Don bis heute über sehr viel Strand verfügt, an dem man sich auch sonnen darf.

So unberührt wie im Traveller-Klischee aus „The Beach“ ist es auch hier nicht mehr, aber doch noch ziemlich so, wie man es sich wünscht, wenn man in München oder Berlin durch den Schneematsch stapft und sich fragt, wo es denn jetzt wohl gerade schöner wäre. Beispielsweise im sogenannten Barefoot-Hotel „Zeavola“, das so etwas wie Luxus mit gutem Gewissen anbietet, wie einige Hotels in der Region. Die Essensreste werden kompostiert, das Wasser recycelt, wer hier übernachtet, leistet schon beim Urlaub Abbitte für die dafür verflogenen Flugkilometer. Das gehört heute ja dringend zur Entspannung. Man kann sich von dort auch nach Maya Bay bringen lassen. Um die Daheimgebliebenen per Instagram neidisch zu machen.
David Pfeifer

Karneval in Venedig

Noch mehr Körperkontakt in den Gassen als sonst, dazu ein Aufpreis fürs Hotelzimmer: Es gibt deutlich bessere Gelegenheiten, Venedig kennenzulernen. Trotzdem ist der Carnevale etwas Besonderes, vor allem jenseits des Rummels zwischen Rialto und Markusplatz. Am schönsten, wie ohnehin in Venedig, wird es abends – wenn die Tagestouristen weg sind und nur vereinzelt elegant gekleidete Paare in Reifrock und mit Dreispitz zu einem der Bälle huschen.

Einmal mitfeiern, davon träumen viele – das kostet allerdings. Das bekannteste Fest ist der üppig inszenierte „Ballo del Doge“, Tickets bis 5000 Euro, dazu kommt der Mietpreis für das historische Kostüm.

Für den Straßenkarneval reicht eine bauta, die typisch venezianische Maske. Die sollte man unbedingt bei einem Handwerksbetrieb kaufen, etwa bei Cá del Sol oder Blue Moon, und nicht in einem Souvenirladen, dort kommen sie nämlich gewiss aus einer Fabrik in China.

Jeder Karneval steht unter einem Motto, diesmal wird des Weltenbummlers Marco Polo gedacht, der vor 700 Jahren gestorben ist. Weltfremd hingegen wirkt die „Festa delle Marie“ am 3. Februar. Da werden zwölf auserwählte junge Schönheiten per Gondel auf den Markusplatz geschifft und dort der Öffentlichkeit präsentiert. Der „Engelsflug“ hingegen vom Campanile, dem Glockenturm, mit einem Seil bis auf die Piazza ist in diesem Jahr nicht geplant.

Ein echtes Stück Venedig bekommt man während des Karnevals in den Konditoreien: die frittelle, oft etwas unförmige, mit Vanillecreme gefüllte Hefekrapfen mit Rosinen, kandierten Früchten und Pinienkernen.
Julia Rothhaas

Die Blaue Lagune

Dass ihre Insel ein Hotspot ist, wissen die Isländer hinlänglich. Die Welt weiß es spätestens seit dem Ausbruch des Eyjafjallajökull, und gerade macht ein anderer Lavastrom den evakuierten Fischerort Grindavík unbewohnbar. Einige Kilometer nördlich des Dorfes liegt die Blaue Lagune, ein touristischer Hotspot. Wochenlang war sie geschlossen. In der ersten Januarwoche wurde sie wieder geöffnet. Kein so gutes Timing, muss man wohl sagen. Inzwischen ist sie wieder zu.

Dabei ist das Eingebettetsein in die – erkaltete – Lava eines der Dinge, die so faszinierend sind an dem Geothermalbad, das in praktischer Nähe zum Flughafen wie auch zum Hauptort Reykjavík liegt. Bei der Anfahrt durch das zerklüftete Gestein wähnt man sich in einem Fantasyfilm. Illahraun, Lava des Schreckens, nennen die Isländer diese Gegend. Am Parkplatz dann: noch mal meterhohe Lava. Dahinter tut sich ein milchig blaugrüner, dampfender See auf; der krasse Gegensatz allein ist schon beeindruckend.

Entstanden ist die Bláa Lónið im Zuge des Baus des 1976 in Betrieb genommenen Geothermalkraftwerks Svartsengi. Das Thermalfreibad speist sich aus heißem Tiefenwasser, das an die Oberfläche geholt wird, um Frischwasser zu erhitzen. Hat es diese Aufgabe erfüllt, darf es im Lavafeld Badegäste erfreuen.

Die reiben sich den Schlick, der sich am Boden des Bads ablagert, gern ins Gesicht – man kennt es halt so von Instagram. Soll auch gut sein für die Haut, wie überhaupt ein Bad im mineralstoffhaltigen Wasser. Muss man nicht machen. Pflicht indes ist es, nackt zu duschen, bevor man ins Wasser steigt. Das dann aber in Badekleidung und gern auch im Winter – mit Ausblick auf einen nordlichternden Himmel.
Monika Maier-Albang

Ksar Draa

Egal, in welche Himmelsrichtung man blickt – nichts als Weite. Und dann, inmitten der Dünen im algerischen Teil der Sahara, erhebt sich auf einmal über einem kleinen Hügel eine runde Burg aus lehmverputzten Steinen: Ksar Draa. Die imposante Festung hat eine Außen- und eine Innenmauer. Und eine Geschichte, die sich im Wüstensand verloren hat.

Im Inneren der Burg befinden sich die Ruinen von Gebäuden, Reste einer kleinen Stadt, die allerdings nicht so gut erhalten ist wie die Außenmauern. Historische Belege gibt es kaum; weder ist bekannt, wer Ksar Draa erbaut hat, noch, wozu genau die geheimnisvolle Festung benutzt wurde. Ksar bedeutet auf Arabisch Burg oder im Maghreb auch wehrhaftes, dauerhaft bewohntes Dorf. Eine Theorie besagt, dass sich hier ein Marktplatz für den Handel mit Gold und Edelmetallen befand. Eine andere, dass Ksar Draa ein Gefängnis war. Wieder eine andere, dass es sich um eine Karawanserei handelte. Die gängigste Version der Algerier ist die, dass einheimische jüdische Kaufleute die Burg vor etwa 1000 Jahren erbauen ließen.

Da es weder eine Straße noch einen Weg nach Ksar Draa gibt, kann man nur mit Kamelen oder zu Fuß dorthin gelangen, was kaum ein Tourist auf sich nimmt. Wie es überhaupt wenig Gäste hierherzieht in die Gegend um die Oasenstadt Timimoun. Algerien hat zwar gerade erst die Einreisebestimmungen und die Visavergabe für die Sahararegion gelockert, doch die Sicherheitslage ist nach wie vor fragil. Der lokale Guide bringt die Kundschaft im sehr gut ausgestatteten Geländewagen zur Burg. Wer möchte, kann im Zelt neben Ksar Draa übernachten. Sternenhimmel, so weit das Auge reicht.
Matthis Kattnig

Big Sur

Es gibt ja kaum ein ausgelutschteres Sprichwort als jenes, dass auf Reisen der Weg das Ziel sein solle und unterwegs spannendere Abenteuer warten würden als am Zielort. Auf die ursprüngliche Bedeutung reduziert ist Big Sur der Ort gewordene Kern dieser Weisheit: Man fährt nicht hierhin, man kommt hier vorbei, zum Beispiel auf einer Fahrt von San Francisco nach Los Angeles.

Man fährt gemütlich auf dem Pacific Coast Highway – rechts der Pazifik, links die Berge und Wälder Kaliforniens; und wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt vielleicht mal anhalten und ein wenig die Natur genießen sollte, dann sollte man genau das tun – kann durchaus passieren, dass man vergisst, dass man eigentlich wohin wollte und ein paar Tage hier bleibt.

Man sitzt am Ozean, man wandert durch die Wälder und umarmt einen Küstenmammutbaum, man paddelt oder planscht im Big Sur River – und dann bemerkt man nach dem Klettern auf einen Hügel, dass Kalifornien der jahreszeitigste Bundesstaat der Welt sein muss – gerade jetzt, von Januar bis April, weil man in Big Sur innerhalb von eineinhalb Autostunden alles erlebt. Im Norden von Big Sur an der Küste: Nordsee-Herbst. Im Osten: Schnee zum Skifahren. Im Wald: Frühling. Und wenn man dann doch einmal weiterfährt auf einer der schönsten – einige nennen sie wegen der Küstenklippen die dramatischste – Autostrecken der Welt, erlebt man, wofür Kalifornien so berühmt ist: Sommer, Sonne, Strand.

Man vergisst in Big Sur, woher man gekommen ist und wohin man wollte – und damit das so bleibt, geben sie einem bei der Ankunft noch eine Weisheit mit auf den Weg; die man versucht, auch an anderen Orten so zu leben: Lasse nichts zurück – außer ein paar Fußabdrücke.
Jürgen Schmieder

Silvester in Rio

Die erste Warnung, die Touristen in Rio de Janeiro zu hören bekommen, ist: Geh bloß nicht nachts an den Strand. In der Dunkelheit und Einsamkeit sind naive Urlauber leichte Beute für Diebe. Diese Regel gilt an 364 Tagen im Jahr, aber nicht am 31. Dezember. Denn an diesem Tag ist nichts mit Einsamkeit.

Dann stehen ungefähr zwei Millionen Menschen am Saum des Meeres an der Copacabana oder in Ipanema. Und in die Dunkelheit strahlen Scheinwerfer von mehreren Bühnen, auf denen Bands spielen oder DJs auflegen. Die meisten Cariocas tragen Weiß, auch viele Touristen halten sich an den Brauch, mit heller Kleidung einen neuen, reinen Anfang zu symbolisieren.

Außerdem ist es in der Silvesternacht üblich, ins Wasser zu waten und Blumen in die Wellen zu werfen. Dabei wünscht man sich was. Adressatin ist die Göttin Iemanjá. Sie ist in den in Afrika wurzelnden, in Brasilien lebhaft praktizierten Naturreligionen zuständig für Meer und Mutterschaft. Ist das erledigt, geht man tanzen oder setzt sich und steckt seine Zehen in den warmen Sand. Selbst nachts hat es in Rio jetzt Temperaturen um die 30 Grad. Dezember ist Sommer in Brasilien.

Abkühlung verschaffen die fliegenden Händler, die Caipirinha anbieten – im Gegensatz zur europäischen Variante mit ganzen Eiswürfeln statt zerstoßenen (schmelzen langsamer) und mit weißem Industriezucker statt braunem Rohrzucker (wie kann man bloß schmutzigen Süßstoff nehmen, wenn es auch sauberen gibt?).

Das gigantische Feuerwerk wird auf dem Wasser von Schiffen und Flößen aus gezündet. Die Party dauert bis Sonnenaufgang. Das Jahr fängt schon mal gut an.
Jochen Temsch

Polarlichter in Lappland

Der Himmel über Nordskandinavien ist immer noch der beste Ort, um Aurora borealis zu sehen. Das sei an dieser Stelle gleich erwähnt, nachdem sich das Polar- oder Nordlicht zuletzt in nicht mehr allzu polare Regionen vorwagte und sogar über den Schweizer Bergen aufleuchtete – natürlich nur als Schatten seiner selbst, sofern sich das in diesem Fall so sagen lässt.

Ursache dafür ist eine ungewöhnlich starke Sonnenaktivität, deren Höhepunkt für 2025 erwartet wird. Eine solche Sonnenaktivität ist wichtig, weil dabei Teilchen ins All geschleudert werden, die in der Erdatmosphäre gewisse Atome zum Leuchten bringen. Dies bedeutet auch, dass weit im Norden in diesem Winter wohl die Post in Sachen Aurora borealis ab- beziehungsweise das Licht angeht. Damit ist auch ein Maximum an touristischen Aktivitäten zu erwarten. Ist doch das Polarlicht seit einigen Jahren ein gewaltiger Publikumsmagnet; einer fast repräsentativen SZ-Umfrage zufolge gibt es keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht einmal gerne Polarlichter sehen würde.

Folglich gibt es Nordlicht-Kreuzfahrten, Nordlicht-Safaris, Nordlicht-Dinner, Nordlicht-Fotokurse oder Polarlicht-Prognose-Apps wie Hello Aurora. In Abisko, dem wegen der – selbst nach Polarnacht-Maßstäben – besonders dunklen Lage hinter den Bergen im Nirgendwo Nordschwedens mitunter besten Ort fürs Polarlicht-Watchen, gibt es eine Aurora Sky Station auf 900 Metern. Und wenn sogar dort Aurora borealis mal wieder hinter Wolken verhüllt bleibt, zeigt es sich womöglich am nächsten Abend vor dem Hotel – zauberhaft grün, wundersam schleiernd. Und ob man will oder nicht: Da steht man dann und staunt den Himmel an.
Dominik Prantl

Eisbären im Eis anschauen

Im Dezember stellt sich allmählich richtiges Eisbärenwetter ein in der Hudson Bay: tagsüber leichter Schneefall bei minus 16 Grad, nachts bis zu minus 26 Grad. Und je kälter es wird, desto besser für den Ursus maritimus, der im polaren Winter auf dem Eis Jagd auf Robben macht.

In der Region um die Hafenstadt Churchill in der kanadischen Provinz Manitoba lebt die südlichste Eisbären-Population der Erde. Der Ort mit gerade mal 870 Einwohnern weiß das für sich zu nutzen, bewirbt sich selbst als „Polar Bear Capital of the World“, Eisbärenhauptstadt der Welt.

Alljährlich reisten zuletzt mehr als eine halbe Million Besucher an, um die gefährlichen Landraubtiere relativ gefahrlos aus hochgelegten Tundra-Buggys – schneeweiße, hohe Allradfahrzeuge – zu beobachten. Ein kostspieliges Vergnügen, das noch jedoch mit vielen Eisbär-Sichtungen belohnt wird. Denn Churchill liegt auf der Wanderroute der Tiere, die sich im Spätherbst vom Hinterland auf den Weg an die Küste machen und dort auf das Zufrieren der Bucht warten.

Wenn sich ein neugieriges Tier einem der hochrädrigen Busse nähert, sich auf die Hinterbeine stellt und dann beinahe auf Augenhöhe mit den Menschen ist, herrscht Stille, die nur vom Klicken der Kameras gestört wird.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Bucht immer später zufriert. Das Eis erreicht oft nicht mehr die Dicke, um die bis 450 Kilogramm schweren Tiere tragen zu können. In Churchill sieht man deshalb immer öfter hungrige Bären, die in Mülltonnen nach Nahrung suchen. In Zeiten des Klimawandels schmilzt den Eisbären ihre Lebensgrundlage, das Eis, buchstäblich unter den Tatzen weg.
Ingrid Brunner

Die Riesenwelle von Nazaré

Stanley Kubrick war mit seiner Kamera bereits 1948 in Nazaré. Lange bevor er als Regisseur berühmt wurde, fotografierte der junge US-Amerikaner in Schwarz-Weiß die einsamen portugiesischen Fischer des Küstendorfs, das heute aus ganz anderen Gründen berühmt ist.

Vor dem roten Leuchtturm auf der gemauerten Festung brechen im Winter die größten Wellen, die jemals gesurft wurden.

Und Hunderte Objektive und Smartphones entlang der Steilküste richten sich auf Frauen und Männer, die sich hinter Jetskis in diese Wasserberge ziehen lassen. Neben Hawaii ist Nazaré vor etwas mehr als zehn Jahren zur wichtigsten Haltestelle der sogenannten Big-Wave-Tour geworden.

Nun kann man sich berechtigterweise fragen, warum um Himmels willen ein Mensch auf einem Brett eine 26 Meter hohe Welle hinabrasen sollte. Egal, ob mit Mensch oder ohne: Diese Wellen, die sich kilometerlang aus dem offenen Meer entlang eines Grabens im Meeresboden aufbauen und kurz vor der Küste brechen, verdienen sich eindrücklich das an anderen Orten viel zu leichtfertig gebrauchte Etikett Naturschauspiel.

Der Wind bläst einem an solch einem Wintertag an der Küste den Kopf frei. Die ärgerliche Mail aus dem Arbeitsalltag, die einen am ersten Urlaubstag noch beschäftigt hat, löst sich in der Gischt auf. Empfehlung: dem Drang widerstehen, sofort mit dem Smartphone zu fotografieren und das Bild auf Instagram zu posten.

Stattdessen einfach nur aufs Meer schauen. Das ist, das würden die stillen Fischer von Nazaré gewiss bestätigen, für ein paar Momente einfach mal genug.
Fabian Heckenberger

Die Iguazú-Wasserfälle

Ein Besuch der Iguazú-Wasserfälle will geplant sein. Um die 20 großen und 255 kleinen Katarakte, die sich über knapp drei Kilometer an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien erstrecken, möglichst nah zu erleben. Aber auch, um den Menschenmassen zu entgehen, die täglich über die flächenmäßig größten Wasserfälle der Welt herfallen. Um acht Uhr morgens öffnet der Nationalpark – die beste Zeit, sich zur Garganta del Diablo aufzumachen, einer u-förmigen Schlucht, 700 Meter tief, auf einem Holzsteg über dem Río Iguazú, bis zu einer Plattform über der Wasserkante. Unten donnert und brodelt es, Gischt steigt auf, darin ein Regenbogen. Überirdisch schön und Furcht einflößend. Garganta del Diablo heißt Teufelsschlund – ein passender Name.

Rundwege führen durch dichten Regenwald zu anderen Wasserfällen. Bunte Schmetterlinge flattern durch die frische Morgenluft, Papageien und Sittiche, Kolibris und Tukane. An einem Baum hängt ein Faultier, ein Ameisenbär stolziert über den Weg. Die Zwillingsfälle Adan y Eva, Adam und Eva, stürzen senkrecht in die Tiefe, der Mbiguá-Wasserfall ergießt sich über Felsstufen.

Weil die meisten Wasserfälle am argentinischen Flussufer liegen, hat man von der brasilianischen Seite die beste Aussicht. Am schönsten ist es bei Sonnenuntergang. Aber dann ist der Nationalpark schon geschlossen. Die Lösung: eine Nacht im Belmond Cataratas, einem Luxushotel.

Der Spaß kostet 800 Euro für das Doppelzimmer. Mindestens. Dafür muss man die Trilha das Cataratas nur mit den anderen Hotelgästen teilen. Der Wanderweg endet mitten im Inferno. Es zischt und dampft und donnert von oben, unten, von rechts und von links. Dazu der Farbrausch der untergehenden Sonne. Welch ein Spektakel.
Tom Noga

Mit einer Dschunke in der Halong-Bucht

Feuerspeiende Wesen mit schuppigen Rücken sind ein großes Ding in Asien, natürlich auch in Vietnam, und erst recht an einem der berühmtesten Touristenziele des Landes: der Halong-Bucht. Der Name bedeutet „herabsteigender Drache“. Gleich mehrere Ungeheuer sollen es der Legende nach gewesen sein, die hier Feinde des Jadekaisers vernichteten, dabei Zähne verloren, die zu Inseln wurden. Genau 1969 Felsen sind es offiziell, eine Zahl, die zufällig dem Todesjahr des nordvietnamesischen Revolutionärs Ho Chi Minh entspricht.

Bizarr ragen die labyrinthisch angeordneten Kalksteinformationen aus dem türkisfarbenen Wasser – ein surrealer Anblick, der durch die tiefroten oder gelben Segel vorbeigleitender (aber in Wahrheit dieselgetriebener) Dschunken noch reizvoller wird. Am besten genießt man das zum Welterbe der Unesco zählende Meeresgebirge auf einem mehrtägigen Törn mittendurch. Ein meditatives Erlebnis. Ein komfortables auch. Die guten Schiffe sind geschmackvoll in dunklem Holz gehalten, ausgestattet mit klimatisierten Doppelkabinen, eigenem Bad und tollen Köchen. Die schlechten Schiffe, die Seelenverkäufer, erkennt man am niedrigen Preis.

Auf den geräumigen Sonnendecks vergehen die Stunden mit Schauen, gelegentlich legt man an Grotten oder Felsen mit Aussichtspagoden an. Manchmal verlangsamt der Kapitän die Fahrt, um Seenomaden vorbeizulassen, die mit ihren Familien, Wachhunden und Fernsehern auf Flößen leben und Fisch züchten, den sie nach China verkaufen. Aber das Genialste sind die geschnitzten Drachenköpfe zur Abwehr böser Geister am Bug der Dschunken. Wenn man sich bei sanfter Dünung auf einen setzt, ist es wie im Fantasy-Film: ein Ritt auf einem Drachen.
Jochen Temsch

Spitzkoppe

Natürlich hat auch Hollywood diesen Platz mal wieder entdeckt, wie immer, wenn etwas außerirdisch schön wirkt oder prähistorisch urtümlich anmutet. Der hier gedrehte Film wird in seiner ganzen Hirnrissigkeit der einzigartigen Spitzkoppe allerdings so wenig gerecht, dass sein Name an dieser Stelle verschwiegen werden soll.

Typisch auch, dass die Große Spitzkoppe – so der präzise Name des 1728 Meter hohen Gipfels – als klassische Bergschönheit mit dem üblichen Reisestereotyp „Matterhorn Namibias“ abgehandelt wird, obwohl sie wenig von einem Matterhorn hat, kein Eis, keinen Schnee, kaum Gipfelaspiranten, dafür einen rötlichen Teint, der seine Farbe im Tagesverlauf ändert.

Sie steht auch nicht in einem Gebirge, sondern ragt als Inselberg zusammen mit ein paar anderen, teils bienenkorbförmigen Granitriesen namens Pontoks bis zu 700 Meter aus der wüsten Ebene West-Namibias heraus, eine zweistündige Fahrt von der deutschkolonial geprägten Küstenstadt Swakopmund entfernt. Auf einem Campingplatz, weitläufig genug, um sich einsam zu fühlen, stellt man den Wagen samt Dachzelt im Schatten gewaltiger Felskugeln ab, um dann je nach Gusto glücklich zu werden, ob Grillfanatiker, Vogelgucker, Wüstenbotaniker, Felsmalereien-Forscher oder Sportkletterer (die 1946 erstmals bestiegene Große Spitzkoppe selbst ist nur was für Könner).

Am Frühstück bedienen sich Borstenhörnchen, auf den Felsen sitzen kleine Drachen mit roten Köpfen, Siedleragamen. Und nachts, wenn vor lauter Dunkelheit auch die Sterne am Ende des Universums leuchten, krabbelt ein Skorpion vorbei. Bis zum nächsten Krankenhaus ist es ein Stück.
Dominik Prantl

Diskobucht in Ilulissat

Bevor sie uns am Hafen von Ilulissat ins Boot lassen, bekommt jeder eine dieser Jacken: windabweisend nach außen, kuschelig warm im Inneren, weil mit Robbenfell gefüttert. Die Tierschützerin in mir schaudert’s, aber dann, kaum sind wir eine halbe Stunde draußen bei zweistelligen Minusgraden, erkenne ich den Wert der Jacke. Sie ermöglicht es, an Deck zu bleiben, zu sehen, zu staunen.

Riesige Eisberge treiben hier, in der Diskobucht im Westen Grönlands, auf dem Wasser. Es müssen Hunderte sein. Das Sonnenlicht ist beißend klar, das Meer unwirklich türkis-blau-durchscheinend. Unter der Oberfläche: noch mehr Eis, viel mehr Eis. Die Berge ragen in die Tiefe, ein Kosmos wie aus einem Computerspiel, als würde man einen fremden Planeten erkunden. Eine Stunde fahren wir durch den Irrgarten, und ich kann mich nicht sattsehen, weiß gar nicht, woher dieses Glücksgefühl kommt, es ist doch nur Eis und Kälte und – Leben!

Robben, Fische, Krill, wer Glück hat, sieht Wale. Das Wasser in der Bucht ist extrem nährstoffreich. Vor mehr als 4000 Jahren siedelten hier schon Jäger. Die Saqqaq-Kultur verschwand, vermutlich infolge einer Klimaabkühlung. Jetzt wird es immer wärmer, die Gletscher kalben ihr letztes Eis hinaus in die Welt. Selbst ein Riese wie der Sermeq Kujalleq, der als einer der aktivsten Gletscher der Erde gilt und bislang den Ilulissat-Eisfjord speist, zerfließt vor unseren Augen. Es wird keine Eisriesen mehr geben, nur noch Eisköniginnen in Fantasy-Filmen. Vielleicht setzen die dann rote Segel im weißen Eis, auch das wird wunderbar aussehen, es ist halt nur nicht real life.
Monika Maier-Albang

Nabayotum-Krater am Turkana-See

Ein riesiger Trichter, die Wände steil, an seinen Flanken verläuft schwarze Lava im Sand der Wüste, vermischt mit smaragdgrünem Wasser. Wenn es Gott gäbe – das wäre ein Blick in seine Werkstatt: wild modelliert und verdammt viel Farbe verschüttet bei einem der ersten Versuche, die Welt zu erschaffen in diesem Glutofen im Großen Afrikanischen Grabenbruch.

Das mit der Anfängen des Lebens ist nicht übertrieben. Metaphysisch, mindestens surreal fühlt es sich an, hier auf einem Felsbrocken zu sitzen und sich an etwas zu erinnern, das man doch gar nicht erlebt haben kann. Aber der Ort ist real, es gibt ihn auf Erden: den Nabayotum-Krater am Turkana-See im Norden Kenias, der zum Teil in Äthiopien liegt. Es ist der größte Wüstensee der Welt, zwölfmal größer als der Bodensee. In seinem alkalischen Wasser schwimmen Krokodile, seine Ufer sind ein Forschungsfeld prähistorischen Lebens.

Einer der bedeutendsten Funde war das komplette Skelett eines Jungen, der vor 1,5 Millionen Jahren an einem entzündeten Milchzahn starb – Beleg für die These, dass die Wiege der Menschheit in Afrika lag, und zwar auch genau hier. Nabayotum-Krater, Nabel der Welt.

Diesen isolierten Ort aufzusuchen, hat seinen Preis und ist gefährlich. Es gibt keine Infrastruktur, keine Straßen, nichts. Von Nairobi aus sind es drei Tage mit dem Jeep durch die Wüste an den See, sicherer ist es mit einem Helikopter von einem der sehr wenigen Camps der Umgebung aus. So weit weg – aber näher am Anfang von allem geht es nicht.
Jochen Temsch

Torres del Paine

Argentinier und Chilenen können lange darüber streiten, welcher Teil Patagoniens schöner ist. Über das größte Naturwunder aber sind sich zumindest ihre Gäste einig. Die Torres del Paine sind eine globale Ikone, 2013 wurde der chilenische Nationalpark mit seinen Granitnadeln und türkisen Gletscherseen online zum achten Weltwunder gewählt.

Die Massen kamen schon vorher und kommen nach wie vor. Auf dem sogenannten W-Trek wandern sie in vier Tagen um die berühmtesten Berge oder machen die ganze Runde, den O-Trek – beide sind nach ihrer Form benannt. 300 000 Besucher wurden vor der Pandemie gezählt, dieses Jahr dürften es wieder ähnlich viele sein. Wer im Valle del Silencio nicht bitter über den Namen lachen und sich die patagonischen Drei Zinnen nicht mit Horden von Selfie-Süchtigen teilen will, kommt dann, wenn auf der Südhalbkugel Frühling ist. Oder steigt ins Kajak.

Bei der Anfahrt am frühen Morgen zeigen sich Herden von Guanakos, eine einheimische Kamel-Art. Kondore zerfleddern einen Kadaver. In den Seen staksen Flamingos, dahinter spiegeln sich schneebedeckte Flanken und glühende Felszacken. Eingepackt in Trockenanzüge, paddelt man auf den Lago Grey hinaus, in einen Skulpturenpark blau leuchtender Eisberge.

Noch einsamer wird es im Sattel. Über bleiches Tussockgras führt ein Ritt zur Laguna Azul und durch den Fluss Las Chinas zu einem Wasserfall. Alles wunderbar – bis die beiden Gauchos an der Spitze Lust auf Trab bekommen. Und dann auf Galopp. Gnadenlos staucht es den Reitdilettanten in den Sattel, am Abend schmerzen Hintern, Rücken und Knie. Was nun hilft? Nur Rotwein und gegrilltes Asado-Lamm, beste Gaucho-Medizin.
Florian Sanktjohanser

Die Oper von Sydney

Natürlich kann man im Opernhaus von Sydney eine Oper erleben. Muss man aber nicht. Wer solche Pläne hat, sollte sich der Gefahr bewusst sein, dass man ein Ehepaar aus Köln als Sitznachbarn hat, das ausführlich berichtet, zu Hause in der Philharmonie sei die Akustik besser. Das Schöne ist: Selbst dann ist die Magie dieses Ortes unerschütterlich. In der Pause, auf einer der Terrassen mit Blick auf den schimmernden Pazifik, wird selbst der redseligste Rheinländer ganz still.

Die Oper von Sydney ist kein Gebäude, das man im gewöhnlichen Sinn besichtigt, obwohl auch das lohnenswert ist (die Concert Hall, der größte von sechs Sälen, ist eine moderne Kathedrale aus Holz). Es ist ein Ort, dem man sich nähert, vom Land, vom Wasser – an der Reling einer Hafenfähre – oder auch aus der Luft, wenn man nebenan die Harbour Bridge erklimmt. Fast gleich aus welchem Winkel: Es ist ein Ort, an dessen Kühnheit und Optimismus man sich kaum sattsehen kann.

Die Oper steht auf dem Bennelong Point, einer winzigen Halbinsel, die nach einem Aborigine benannt ist. Wer hier ein wenig verweilt, und sei es auch nur in der Freiluft-Bar unten am Hafenbecken, der spürt, dass an diesem Ort zugleich das Herz eines jungen Staates und das einer alten Zivilisation schlägt. Die Silhouette des Operndachs ist zum globalen Bildzeichen dieses Landes geworden.
Touristen kommen eigentlich nicht nach Australien, um Dinge zu sehen, die der Mensch geschaffen hat. Das Sydney Opera House ist die eine Ausnahme. Einmal leibhaftig vor diesen ebenso mächtigen wie eleganten Segeln zu stehen, die ein gütiger Wind aufzublasen scheint: Das ist ein Privileg, und zwar eines, das jeder Tourist dem Architekten voraushat. Der Däne Jørn Utzon verließ Sydney während des Baus 1966 im Streit und kehrte niemals zurück.
Von Roman Deininger

Die Altstadt von Quito

Der Himmel ist hier nah. Das ist in Quito wörtlich zu verstehen: Schließlich liegt Ecuadors Hauptstadt auf fast 3000 Metern inmitten der Anden. Dass der Himmel in metaphysischer Hinsicht allerdings nicht so leicht zu erreichen ist, auch das weiß man in dieser Stadt. Unzählige Kirchen und Klöster in der Altstadt erinnern daran: Weicht der Mensch vom rechten Wege ab, so drohe die Hölle.


Wie entsetzlich die aussehen könnte, zeigt ein Horror-Gemälde in der Jesuitenkirche La Compañía de Jesús, die ansonsten über und über mit Blattgold geschmückt ist. Auf überwältigende Weise demonstriert sie Glanz und Elend, Reichtum und Ausbeutung der Kolonialzeit, die bis heute nachwirken. Hier leuchtet wirklich jedem ein, warum Quitos Altstadt, 1534 von den Spaniern gegründet, wegen ihrer opulenten Kolonialarchitektur und Kunstschätze 1978 als erste Stadt überhaupt zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde.

Gleißende Äquatorsonne lässt die weiß getünchten Gebäude des weitläufigen und belebten Centro Histórico tagsüber strahlen. Naht der Abend, empfiehlt es sich, den Abstand zum Himmel noch etwas zu verringern und den Sonnenuntergang über den Dächern zu erleben, am besten auf der Terrasse des „Vista Hermosa“. Dort hat man sie direkt vor sich, die einstigen und heutigen Zentren der Macht, die Kathedrale und den Regierungspalast, für manche ein Symbol für die politischen Höllenkreise des Landes. Immerhin wacht über allem, auf dem Panecillo-Hügel, eine riesengroße Madonnenstatue. Und angesichts des spektakulären Blicks über die Stadt- und Berglandschaft bleibt vor allem dieser Gedanke haften: Dem Himmel sei Dank.
Antje Weber

In die Alhambra

Oh ja, es wird heiß in Granada im Hochsommer. Selbst unter der Markise im „Cafe 4 Gatos“ steht die Luft, dafür ist der Blick auf Hügel und Burg vielversprechend. Und ebenso die Aussicht, nach der Siesta dort oben zu sein, in der „roten Festung“, „Qal’at al-hamra“, der Alhambra

Denn sie wussten hier schon zu leben, die Reichen im ausgehenden Mittelalter: kühlendes Geplätscher in den Innenhöfen, bunte Fliesen, geometrisch angeordnet, überall Säulen, verziert mit prachtvollen Kalligrafien, Koranfragmenten und Stuckatur. Die Wände schimmern je nach Lichteinfall mal feiner, mal kräftiger rot aufgrund des eisenhaltigen Tons, aus dem die Ziegel gefertigt wurden. Eine Burg, die einem Sakralbau ähnelt, ein Traum aus Tausendundeiner Nacht, und das so nah – man muss nicht mal übers Mittelmeer fliegen, um sich dieses Meisterstück arabischer Kunstfertigkeit anzusehen.
Die Nasridenherrscher ließen die Anlage im 13. und 14. Jahrhundert erbauen. Sie besteht aus mehreren Palästen. Man schlendert durch den Myrten- und Löwenhof, nimmt die späten Bauphasen mit Anleihen aus der italienischen Renaissance in Kauf, die der katholische Eroberer Karl V. von 1526 an in Auftrag gab, nachdem das Emirat von Granada aufgehört hatte zu existieren.

Immerhin: Er ließ die islamische Kunst stehen. Heute ist die Alhambra nicht nur Unesco-Weltkulturerbe, sie gilt auch als Symbol der Mittelmeerkultur, aus der Europa entstanden ist – und die eben nicht nur durch christliche, sondern neben jüdischen auch durch muslimische Einflüsse geprägt ist.
Und wem das zu bedeutungsschwer ist, der kann auch einfach nur die kühlen Räume genießen. Oder besser noch im Frühling kommen, wenn die Temperaturen noch niedriger sind und die Zitronenbäume blühen.
Monika Maier-Albang

Auf der Brücke von Avignon

Die Brücke von Avignon kennt jedes Kind. Das Lied vom Tanz auf dem rudimentären Bauwerk kommt schon in Kitas zum Einsatz: Die Herren machen so, die Damen so, die Wäscherinnen und Soldaten so, so, so. In der Realität wäre so ein Tanz problematisch. Der Pont Saint-Bénézet, so der offizielle Name der Brücke, ist so schmal, dass kaum drei Menschen nebeneinander stehen können.

Ihr Geländer ist zudem so niedrig, dass man bei einem allzu ausladenden Hüftschwung fürchten müsste, aus Versehen jemanden in die Rhône zu schubsen. Kinder sollen, so steht es auf Warnschildern, zur Sicherheit ständig an der Hand gehalten werden.

Und es gibt noch mehr Missverständnisse. In der ursprünglichen Fassung des Lied-Textes hieß es „sous le pont“, unter der Brücke, statt „sur“ (auf) – gemeint war eine Fluss-Insel, auf der die mittelalterlichen Jahrmärkte stattfanden und die über den steinernen Steg zu erreichen war. Kriege und die Kräfte der mächtigen Rhône machten den Pfeilern zu schaffen. Für den Warenverkehr mit Fuhrwerken war die Brücke sowieso zu schmal, dazu nahm man Boote, also ließ man sie im 17. Jahrhundert verfallen.
Und: Weder sous noch sur ist die Brücke am schönsten, sondern von einer anderen Brücke aus. Der Pont Édouard Daladier bietet eine Postkartenaussicht auf die Brücke mit Altstadt und Papstpalast, er ist allerdings intakt – also für sich genommen unspektakulär.
Jochen Temsch

Crystal River
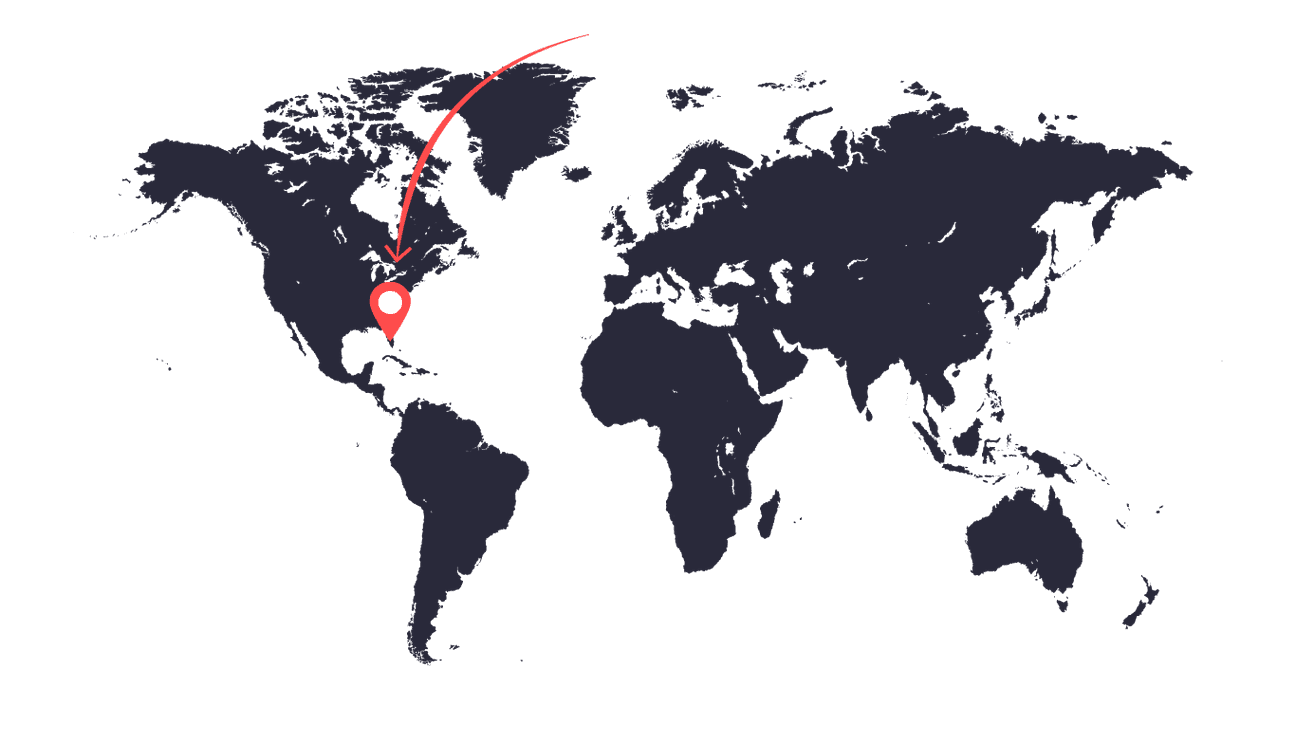
Fragt man Taucher nach ihren Träumen, bekommt man viel Erhabenes zu hören. Die einen wollen Walhaie sehen, die anderen Mantas. Meine Sehnsuchtstiere sehen aus wie graue Würste, mit Stummelarmen, Knopfaugen und Borsten um die runzlige Schnauze. Aber was Seekühen in puncto Eleganz fehlt, gleichen sie durch Charakter aus. Tiefenentspannt sollen sie sein, manchmal umarmen sie angeblich Menschen.

15 Jahre lang bin ich ihnen nachgetaucht, in Indonesien und Ägypten, Mexiko und Mosambik. Vergeblich. Und nun, in einem Kaff im Nordwesten Floridas, stecke ich beim Schnorcheln den Kopf unter Wasser – und sehe sofort meine erste Seekuh.

„Welthauptstadt der Manatis“ nennt sich Crystal River, die knuffigen Dickhäuter liegen als Plüschtiere in Souvenirläden, zieren Nummernschilder und Wappen der Stadt. Von Mitte November an, wenn der Golf von Mexiko kälter als 20 Grad wird, schwimmen sie die Flüsse herauf. Hunderte Rundschwanzseekühe drängen sich dann in den warmen Quellen, wo sie seit 1983 geschützt sind.

Am schönsten ist es dort früh am Morgen, wenn noch Nebel zwischen Palmen und Virginia-Eichen hängt. In den Three Sisters Springs sehe ich die Seekühe im extrem klaren Wasser hinter einer Bojenleine dösen. Alle paar Minuten hebt sich ihr Oberkörper, bis die Nasenlöcher aus dem Wasser spitzen. Tief atmen, dann sinken sie wieder auf den Grund.

In der Kings Spring dagegen wollen sie spielen. Neugierig schwimmt ein Manati heran, stupst mich an, gleitet unter mir hindurch und rollt sich auf den Rücken wie ein Welpe, der gekrault werden möchte. Ich muss lachen, schlucke Wasser. Und bin endlich ein seliger Taucher.
Florian Sanktjohanser

Auf die Drei Zinnen klettern

Zugegeben, ein Geheimtipp sind die Drei Zinnen ungefähr seit der Erstbesteigung der Großen Zinne im Jahr 1869 nicht mehr. Aber welcher Berg mit einem derartigen Profil, mit einem derartigen Bekanntheitsgrad ist das noch? Der Watzmann? Wird trotz seines Rufs als grausamer, längst petrifizierter Tyrann überrannt von den Massen, und das im Wortsinne. Das Matterhorn? Hat eine derartige Strahlkraft, dass selbst weit entfernte Seen bevölkert werden, in denen sich die Bergpyramide nur spiegelt.

Und natürlich ist auch eine Touristenfütterungsstelle wie die Dreizinnenhütte (2405 Meter) zu Füßen des Dreigestirns der reinste Spießrutenlauf für Misanthropen. Laut Hütten-Website gehen dort schon im Februar mehr als tausend Übernachtungsanfragen für die Hochsaison ein. Im Sommer ist dann meist die Hölle los vor lauter Halbschuh-Alpinisten, die ihre Fotobibliothek mit dem Trio aus Felszähnen bereichern wollen.

Und doch gibt es auch dort noch Ruhe. An einem sonnigen Donnerstag Anfang Juni etwa sah ich beim Aufstieg zur Großen Zinne über den Kletterei abverlangenden Normalweg genau einen Menschen: meinen Seilpartner. Am Gipfel ging der Blick 600 Höhenmeter hinab zur noch geschlossenen Dreizinnenhütte, davor die abfallenden Schotterfelder und nur sehr wenige Ameisenmenschen. Denn merke: Mag ein Einmal-im-Leben-Platz auch noch so beliebt sein, so gibt es doch meistens eine Zeit, den Massen aus dem Weg zu gehen. Schon Ende September geht die Dreizinnenhütte wieder in den Winterschlaf.
Dominik Prantl
Teil 1