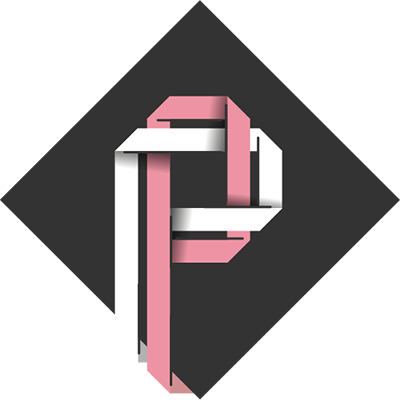Neue Heimat
Post vom Anwalt ist nicht immer das Schönste, aber diese E-Mail trägt schon im Betreff das magische Wort: „Apple“. Die Nachricht kommt von einer der größten Kanzleien der Welt, den US-Anwälten von Baker McKenzie. Das Schreiben riecht nach Geld. Man sei eingeladen, heißt es darin, einen Kostenvoranschlag zu schicken. Im Anhang wären da ein paar Fragen, die „unser Mandant Apple“ habe. „Das ist eine großartige Gelegenheit“, jubelt auf Seiten des Empfängers einer der Manager. Apple stellt in dieser E-Mail keine gewöhnlichen Fragen. Der Anhang hat es in sich. Der Vorgang verrät viel über Praktiken, die Apple gerne geheim hält. Die Kanzlei des Konzerns verschickt die E-Mail in einer stressigen Zeit, im Frühjahr 2014. Irland ändert gerade seine Steuergesetze für Unternehmen. In Irland verbuchen auch Tochterfirmen des iPhone-Erfinders ihre Gewinne aus Europa. Irland – das hat den Charme, dass dort besonders wenig Steuern anfallen.
Die Paradise Papers zeigen, wie zielstrebig – und bisweilen dreist – Konzerne genau das Recht aussuchen wollen, das ihren Geschäften nicht im Wege steht. Und wie leicht Steueroasen es den Unternehmen machen, die wenigen rechtlichen Vorschriften zu erfüllen.
Der Fragebogen in der Apple-Mail liest sich, als hätte der Konzern Angst, dass die Rechnung künftig etwas höher ausfallen könnte. Es geht darum, ob Apple neue Geschäftssitze in Steueroasen gründen soll. Im Gespräch sind gleich mehrere Standorte, die nicht für ihre IT-Fachkräfte berühmt sind, sondern für ihre Steuergesetze: die Britischen Jungferninseln, die Kaimaninseln, die Isle of Man, die Kanalinseln Guernsey und Jersey. Aber bitte nur zu den richtigen Bedingungen, heißt es. Apple will die Sicherheit, dort Geschäfte abwickeln zu können, „ohne besteuert zu werden“. Das soll amtlich bescheinigt werden: „Ist es möglich, eine offizielle Bestätigung der Steuerbefreiung zu bekommen, und kostet das etwas?“ Apple lässt über die Kanzlei Baker McKenzie abklopfen, wie transparent die Arbeit auf den Inseln sein wird: „Müssen Geschäftsberichte veröffentlicht werden“ und „welche Informationen sind öffentlich einsehbar“?
So offen, so ungeniert, so dreist hat man das Geschäftsgebaren und Geschäftsinteresse eines Weltkonzerns selten vor Augen.

Paradise Papers
Apple, so lässt sich den Unterlagen entnehmen, sorgt sich um das politische Klima in einer Steueroase, in der man sich neu niederlassen will. Der Konzern fragt nach der Wahrscheinlichkeit, dass eines Tages eine Opposition an die Regierung kommen könnte. Vielleicht weil diese dann gegen Niedrigsteuern vorgehen würde? Jedenfalls fragt die Kanzlei Baker McKenzie in Apples Namen: „Gibt es eine glaubwürdige Oppositionspartei oder eine Bewegung, die die jetzige Regierung ersetzen könnte?“
Apple, so liest sich das, hat Angst vor einem politischen Frühling in den Steueroasen. Der Konzern scheint sich nach einem Land zu sehnen, in dem nichts das Geschäft stören würde. In dem es keinen Staat gibt, keine Politik, keine Öffentlichkeit.
US-Konzerne bekommen Torschlusspanik
Mit politischem Ärger hat Apple Erfahrungen. Ein Untersuchungsausschuss des US-Senats enthüllte 2013 die Steuerpraktiken von Apple in Irland. Konzernchef Tim Cook musste sich stundenlang von amerikanischen Parlamentariern befragen lassen. Die Regierung in Dublin fühlte sich als Steueroase an den Pranger gestellt, der irische Botschafter schrieb einen Protestbrief. Und um den Ruf eines fiesen Steuerparadieses abzuschütteln, kündigte der irische Finanzminister Reformen an. Apples Steuertrick soll abgeschafft werden, ebenso der berüchtigte „Double Irish“. Ab 2015 gelten neue Regeln. Irland, das ist die Botschaft, will Ernst machen.
Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Wer von den alten Schlupflöchern noch profitieren will, muss 2014 seine Firma gehörig umbauen. Das lohnt sich, denn der irische Finanzminister hat eine großzügige Übergangsfrist gewährt. Wer 2014 noch einen „Double Irish“ aufsetzt, darf ihn bis 2021 nutzen. Jetzt gründen, jahrelang profitieren. US-Konzerne bekommen deswegen Torschlusspanik, wie aus den Paradise Papers hervorgeht. „Ende 2014 schließt sich ein Zeitfenster, ein window of opportunity“, wirbt zum Beispiel eine Anwaltskanzlei. Noch sei Zeit, einen „Double Irish“ aufzusetzen. Die US-Firma könne sich dann auf nur fünf bis sieben Prozent Steuern einstellen, heißt es in dem Papier. Für den „Double Irish“ müssen zwei irische Firmen gegründet werden. Eine darf dann von außerhalb Irlands geführt werden. Kluge Unternehmensberater schlagen dafür ein Land mit null Prozent Körperschaftsteuer vor, beispielsweise die Bermudas. Dann müssen Gewinne nach irischem Recht nicht mehr in Irland versteuert werden. So fließen die Gewinne aus Europa über Irland ins Null-Steuer-Gebiet.
Apples Irland-Struktur führte dazu, dass am Ende gar kein Finanzamt mehr für nach Irland verschobenes Geld zuständig war
Das irische Gesetz verlangt lediglich, dass eine der beiden Firmen tatsächlich in Irland aktiv ist. Wie leicht das für ausländische Konzerne zu erfüllen ist, beschreibt eine Kanzlei in einer Präsentation für ein US-Unternehmen en détail. Es muss Büroraum mieten und einen irischen Mitarbeiter beschäftigen. Außerdem braucht die Firma einen Manager aus den USA, der Geschäftsführer der neuen Irland-Tochter wird. Der Mann oder die Frau muss dann vor dem Jahreswechsel sieben bis zehn Tage in Irland verbringen. Das reiche aus, um als irischer Geschäftsführer zu gelten. Dazu noch ein Tipp: Am besten sei zusätzlich noch ein Geschäftsführer, der „local“ sei, also wirklich in Irland wohne. Dann müsse der amerikanische Mitarbeiter nicht immer für die Vorstandssitzungen einfliegen, lediglich für die erste müsse er ins Land kommen. Mindestens eine Vorstandssitzung müsse vor dem 31. Dezember 2014 stattfinden. Dazu kommen noch einige vertragliche Details.
Apples Irland-Struktur führte dazu, dass am Ende gar kein Finanzamt mehr für nach Irland verschobenes Geld zuständig war. Kein Staat, keine Steuern. Das war illegal, hat die Europäische Kommission 2016 entschieden. Der Konzern wehrt sich dagegen. Apple wirft Brüssel vor, falsch gerechnet zu haben. Es werden wohl Jahre vergehen, bis der Europäische Gerichtshof den Fall abschließt. Die Kommission verlangt, dass das irische Finanzamt bis zu 13 Milliarden Euro plus Zinsen von Apple nachkassiert, weil es sich bei den sogenannten Steuervorbescheiden aus ihrer Sicht um unrechtmäßige staatliche Beihilfen gehandelt habe. Das ist die größte Summe, die die EU-Kommission je einem Unternehmen abverlangt hat. Der Konzern weiß allerdings die irische Regierung an seiner Seite. Dublin kämpft ebenfalls juristisch gegen den EU-Entscheid. Die Regierung hat Angst, am Ende mehr zu verlieren – womöglich die Anziehungskraft für internationale Konzerne –, als sie durch die Nachzahlung gewinnen würde.
Die Behörde hat Apples Geschäfte in den Jahren 2003 bis 2014 untersucht, der 130-seitige Bericht der EU-Kommission erklärt außerdem: Das Jahr 2015 begann für Apple mit einer neuen Unternehmensstruktur in Irland. Darüber hat Apple die Kommission informiert.
Der Steuersatz für ansässige Unternehmen beträgt auf Jersey null Prozent
2014 kam die Kanzlei Appleby, die den langen Fragebogen von Apple bekommen hat, mit dem Konzern ins Geschäft. 2015 führte Appleby laut den Paradise Papers zwei irische Apple-Firmen als ansässig auf Jersey. Die Gesetze dieser Insel erlauben es ausländischen Firmen, dort einen Geschäftssitz zu haben. Die beiden irischen Firmen Apple Sales International und Apple Operations International werden den Unterlagen zufolge betreut von Apple Trust Jersey Limited. Diese Verbindung vom Firmensitz Cupertino auf die Insel zwischen Frankreich und Großbritannien war bislang öffentlich nicht dokumentiert. Der Steuersatz für die Unternehmen beträgt auf Jersey null Prozent.
Unklar ist, wie Apple diese Jersey-Verbindung genau nutzt. Die EU-Kommission hat in ihrem Apple-Bericht die Details des Konzernumbaus vor dem Veröffentlichen geschwärzt. Das ist in solchen Papieren üblich, um Geschäftsgeheimnisse zu bewahren. In Unterlagen, die Apple bei der US-Börsenaufsicht einreichen muss, werden die beiden Firmen als zwei von vier „wesentlichen Tochterunternehmen“ des Konzerns genannt. Eine denkbare Erklärung für die Jersey-Aktivitäten könnte sein, dass Apple rasch die irische Steuerreform umsetzen wollte. Irische Apple-Firmen waren nämlich dank des Tricks steuerrechtlich „staatenlos“, aus Sicht des Finanzamtes also in keinem Land der Welt ansässig. Das ist jetzt auf Betreiben des irischen Finanzministers nicht mehr erlaubt. Apples bislang staatenlose Firmen haben also nun womöglich eine Steuerheimat – auf Jersey, der Null-Prozent-Insel.
Aus Kreisen, die mit den Vorgängen vertraut sind, ist zu hören: Für Apple habe sich durch diese Lösung praktisch nichts geändert. Tatsächlich ist auch in den öffentlich einsehbaren Finanzdaten von Apple praktisch keine Veränderung bei den Steuerzahlungen seit 2015 erkennbar. Gewinne außerhalb der USA hat Apple demnach 2013 und 2014 mit rund vier Prozent versteuert. 2015 waren es rund fünf Prozent, 2016 rund sechs Prozent. Schwankungen in dieser Größenordnung sind bei internationalen Konzernen gewöhnlich.
"Wenn sich das System ändert, werden wir dem nachkommen. Apple hält sich an die Gesetze."Ein Apple-Sprecher
Auf Anfrage von SZ, NDR und WDR macht der Konzern keine Angaben zu Jersey. „Wir haben den steuerlichen Sitz unserer irischen Tochterfirmen geändert“, sagt ein Sprecher. „Die Änderungen haben unsere Steuerzahlungen in keinem Land verringert. Tatsächlich zahlen wir deutlich mehr an Irland: 1,5 Milliarden Dollar in den letzten drei Jahren. Das sind sieben Prozent der gesamten Körperschaftsteuer des Landes.“ Apples Kanzlei, Baker McKenzie, schreibt: „Wir kommentieren grundsätzlich keine vertraulichen Angelegenheiten unserer Kunden.“ Die Kanzlei Appleby betont in einer allgemeinen Stellungnahme, nur auf „legitime und legale“ Weise für ihre Kunden zu arbeiten.
Apple sieht sich zu Unrecht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. „Wir sind der größte Steuerzahler der Welt und haben mehr als 35 Milliarden Dollar Körperschaftsteuer in den vergangenen drei Jahren gezahlt“, betont ein Sprecher. In diesem Zeitraum betrug der Vorsteuergewinn von Apple mehr als 198 Milliarden Dollar – die Steuerquote lag damit insgesamt bei rund 18 Prozent. „Manche Leute wollen das Steuersystem ändern, sodass die Steuern von multinationalen Konzernen anders zwischen den Ländern verteilt werden, in denen sie aktiv sind“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn sich das System ändert, werden wir dem nachkommen. Apple hält sich an die Gesetze.“