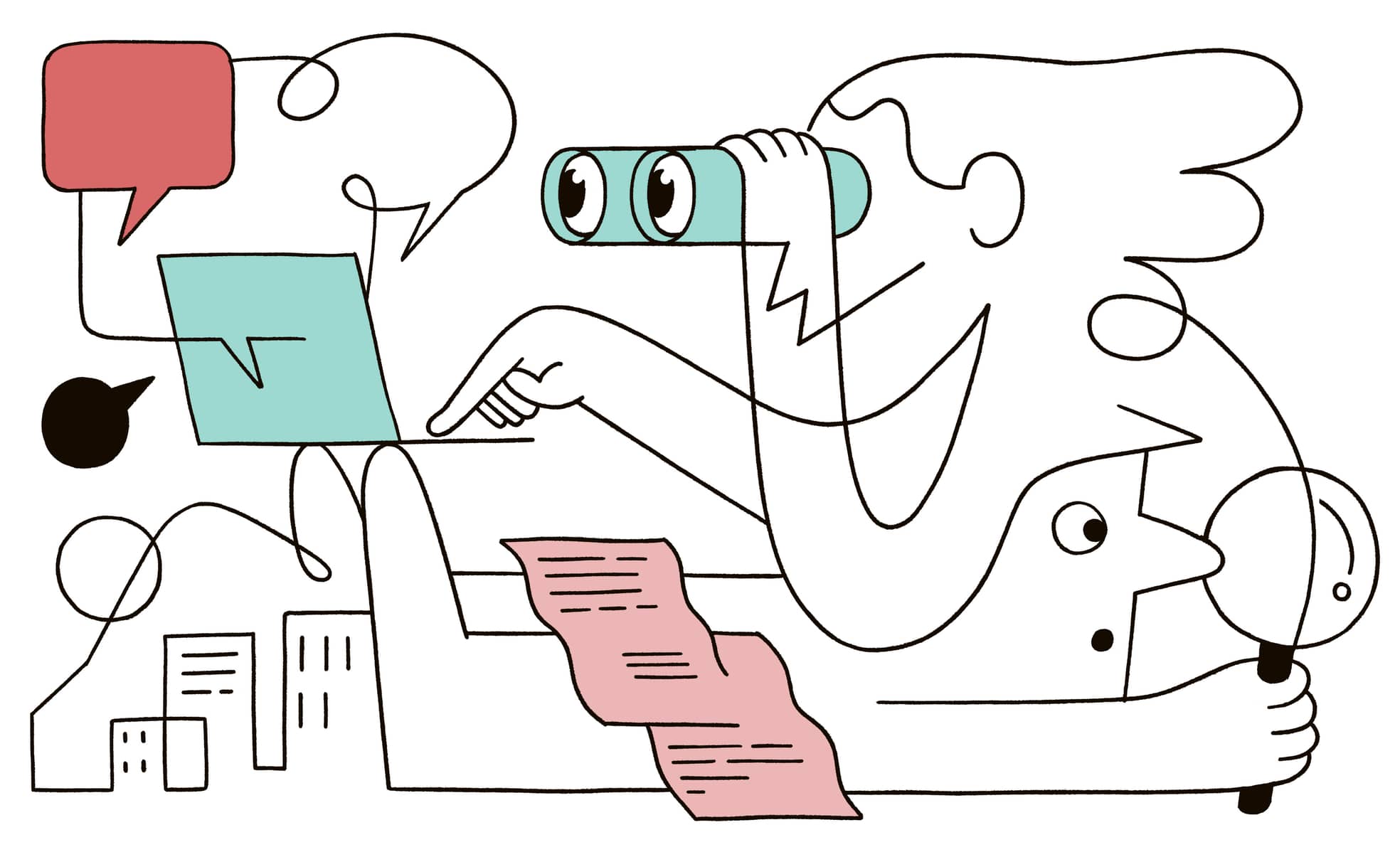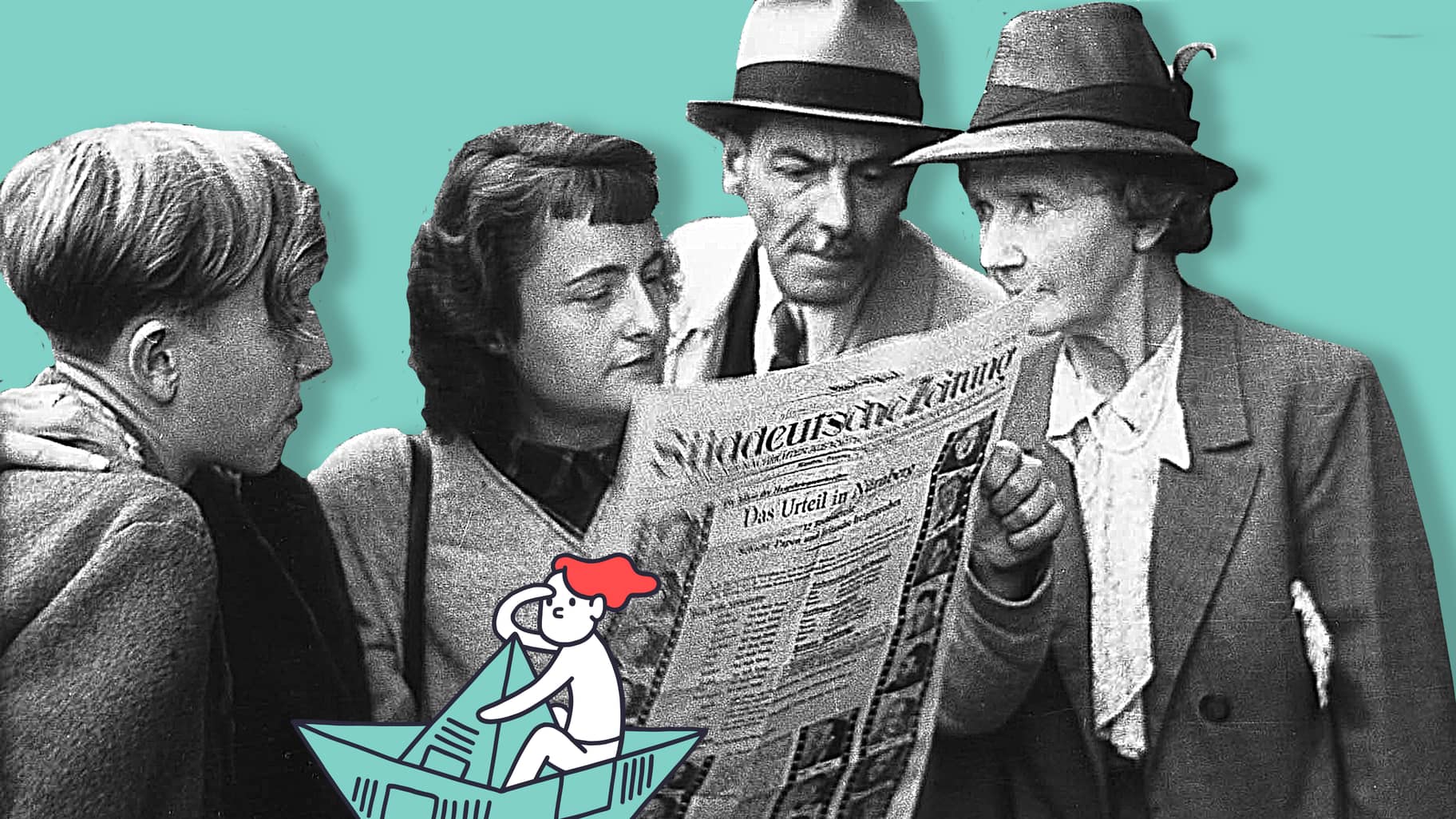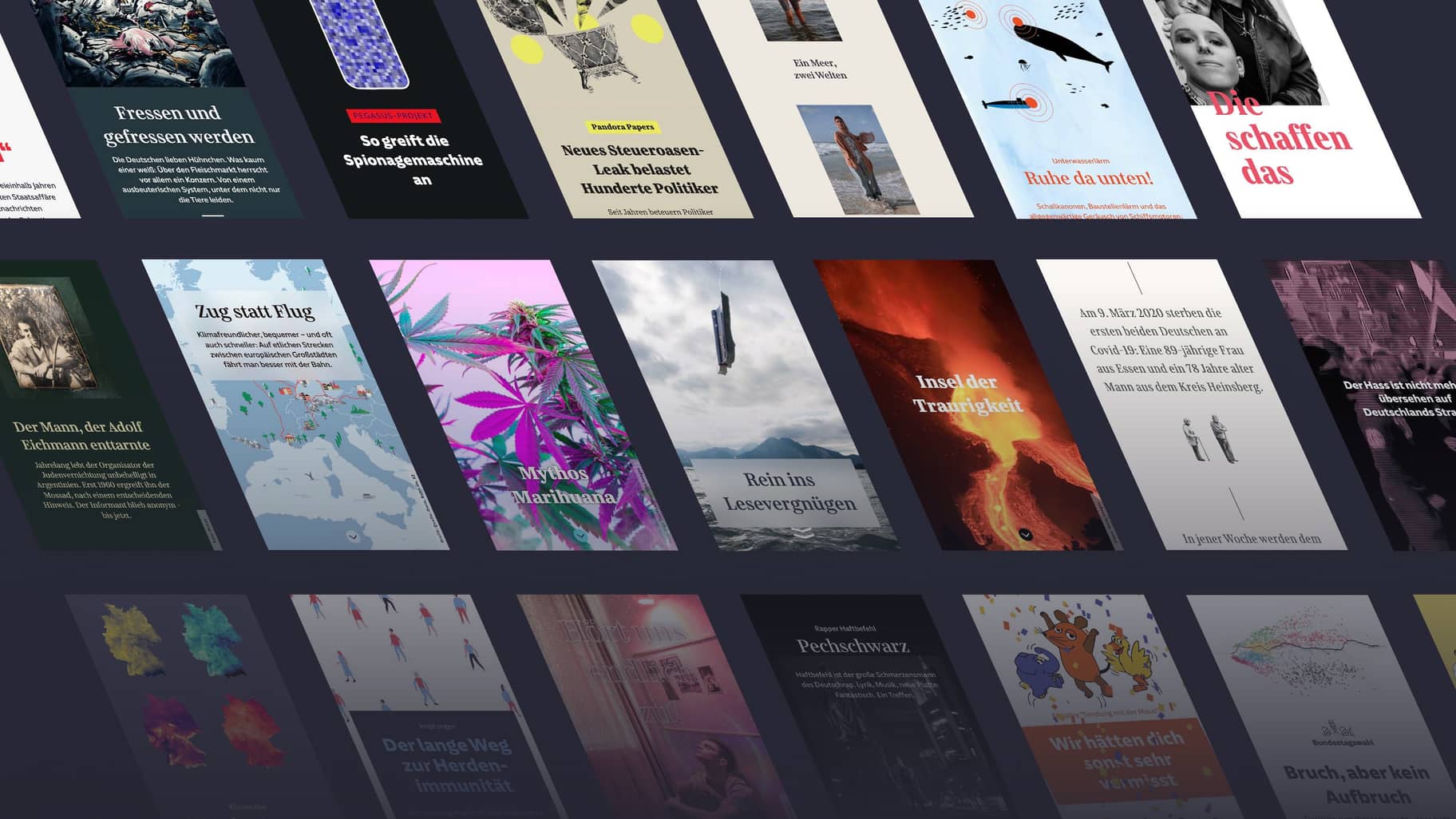Die Seite Drei
Die unendliche Geschichte
Dass man über die geschriebene Reportage überhaupt noch redet, ist schon mal einigermaßen erstaunlich. Eigentlich hätte diese Spielart des Journalismus doch längst tot sein sollen. Oder nicht?
Wer schon länger im Geschäft ist, hat jedenfalls genug Nekrologe auf die Reportage gelesen oder womöglich selbst mal welche verfasst. Das Fernsehen werde wegen der größeren Anschaulichkeit Printreportagen überflüssig machen, hieß es. Das ist Jahrzehnte her und hat schon damals nicht gestimmt. Dann kamen die Vermesser des Journalismus, zählten vor allem Klicks, obwohl man sich in Print doch jahrzehntelang über die Quotenhörigkeit der Öffentlich-Rechtlichen lustig gemacht hatte. Und wieder wurde die Reportage zu Grabe getragen, diesmal von denen, die sich sicher waren, dass keiner mehr so lange Artikel lesen würde im Netz, schon gar nicht am Smartphone. Tatsächlich?
Und mitten in die hämischen Abgesänge platzte dann der Geschichtenerfinder und Reporterdarsteller Claas Relotius, der das Genre noch einmal zusätzlich in Verschiss brachte, weil er sich seine Wahrheiten selbst zusammengeklebt hatte – und dafür von Preisjurys gefeiert wurde. Nach Relotius werde es die Reportage schwer haben, die Glaubwürdigkeit sei dahin, hieß es.
Tatsächlich sind Geschichten Teil des Lebens, Wesens und Seins des Homo narrans
Seitdem werden Reporter in Leserbriefen nicht mehr wie früher oft als „Schmierfink“ beschimpft, sondern auch mal als „Relotius“. Und der Abgesang auf die Reportage mischte sich mit dem Abgesang auf den Journalismus im Allgemeinen. Fake News ist ja eigentlich eine Bezeichnung für bewusst in den sozialen Medien verbreitete Halbwahrheiten, für „in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen“, wie der Duden schreibt. Und doch plärren jetzt Menschen auf der Straße Journalisten und auch Reportern „Fake News“ und „Lügenpresse“ hinterher. Oft sind das genau die, die auch Verschwörungsmythen für wahr halten. Dass ein Fall wie Relotius im Journalismus letztlich ein Einzelfall war, man könnte auch sagen, das Werk eines Einzeltäters, hat viele nie interessiert. Es war wie ein Geschenk für die, die sowieso ein großes Interesse an der Diskreditierung der Medien hatten und haben.
Tatsächlich sind Geschichten Teil des Lebens, Wesens und Seins des Homo narrans. „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben“, hat die Ende 2021 verstorbene Großessayistin Joan Didion geschrieben, und was sie gemeint hat, erlebt man etwa, wenn man kleinen Kindern aus einem Buch vorliest: gespannte Stille. Wer selten Kindern etwas vorliest, kennt das Setting vielleicht aus Marrakesch, auf dem Jemaa el-Fna, dem Platz der Gaukler und Medizinmänner, der Schlangenbeschwörer, Akrobaten und Geschichtenerzähler. Seit Generationen werden hier Erzählungen weitergegeben, über schöne Frauen und eitle Könige, Betrüger und Bettler, und die Geschichtenerzähler wissen sehr genau, wie sie ihr Publikum halten, über Tage, Wochen, wie in einer Fernsehserie. Die Geschichte wird einfach am nächsten Tag weitererzählt. Die Erzähler hocken da, im flackernden Licht der Petroleumlampe, umringt von ihren Zuhörern. Sie wussten schon immer, eine gute Geschichte kann gar nicht zu lang sein, die Leute werden wieder kommen, Abend für Abend.
Die Reportagen, die der erzählende Journalismus hervorbringt und die in der Süddeutschen Zeitung täglich auf der Seite Drei stehen oder oft auch im Buch Zwei, bilden die Welt ab, wie sie ist. Der Reporter, der kein Gaukler sein will, ist eben nicht wie der Mann auf dem Jemaa el-Fna, denn der Reporter erfindet nicht, er berichtet. Er sieht die Welt durch sein Temperament. Aber seit dem Skandal um den Fälscher Relotius schwebt ein Generalverdacht über den Reporterinnen und Reportern, die in der Gegenwart so akribisch kontrolliert werden wie noch nie, bestenfalls von sich selbst, dazu noch von den Faktencheckern in den jeweiligen Ressorts, nicht zuletzt von den Leuten da draußen. Alles Recherchierte muss möglichst auf Bändern zu hören sein, auf Fotos zu sehen, in Büchern, Akten, Briefen zu lesen. Ein Zitat erfinden? Ist ohnehin undenkbar, aber ein falsch Zitierter könnte heute in den sozialen Netzwerken und vor aller Augen Reporter vorführen. Die Zustimmung des Publikums dort wäre ihm wohl sicher.
Viele dieser selbsternannten Kontrollinstanzen hat es früher nicht gegeben. Sie disziplinieren Autoren, auch weiter das zu tun, was sie schon immer in den allermeisten Fällen getan haben: bei der Wahrheit bleiben. Weil sie wissen: Eine erfundene Geschichte ist wertlos.
Wie sagte Spiegel-Gründer Rudolf Augstein in gebotener Kürze: „Sagen, was ist.“ Das ist, was ein Reporter macht, und das gilt in exakt dieser Kürze noch heute. Was sich verändert hat, ist die Konkurrenzsituation, unter der die geschriebene Reportage heutzutage um ihr Leben kämpft. Vor Generationen war die große Reportage auf der Seite Drei der SZ noch etwas sehr Einmaliges und Besonderes im deutschen Journalismus, dann kamen andere dazu, etwa die Reportagen im GEO Magazin, später entdeckten auch die Wochenzeitungen diese Form mehr und mehr für sich und räumten mehr Platz dafür ein als die Tageszeitung, stellten auch mehr Budget zur Verfügung.
Es geht auch darum, sich selbst bei allem nicht zu wichtig zu nehmen
Auch auf der Seite Drei gibt es schon sehr lange und immer noch Reportagen, die mit großem Aufwand und Vorlauf recherchiert und geschrieben werden. Aber es gibt hier ein sehr explizites Bewusstsein dafür, eine Tageszeitung und damit natürlich besonders der Aktualität verpflichtet zu sein. Es geht hier vor allem auch darum, sich selbst bei alldem nicht zu wichtig zu nehmen. Es geht darum, das Weltgeschehen in Geschichten zu erzählen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Reporter suchen Menschen, die einen neuen Blick auf ein Geschehen ermöglichen. Darum geht es in der Reportage: Menschen zu finden, die etwas zu erzählen haben und etwas erzählen wollen. Und deren Geschichten im besten Fall über sie hinausweisen. Das zählte, und das zählt noch heute.
Die Sprache ist in der modernen Reportage weniger elegisch als früher, der Erzähler oder die Erzählerin tritt dafür immer öfter persönlich in den Stücken auf – das ist manchmal ein Gewinn für die Geschichte, aber nicht immer. Und darüber, wie journalistisch es ist, sich selbst zu befragen, lässt sich streiten.
Auf der Seite Drei gilt die Regel: eher den klassischen Weg gehen und statt der Selbstbespiegelung Leute finden, die was sagen, und deren Geschichte für etwas steht. Das Kleine im Großen entdecken. Das Große anhand des Kleinen erklären. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben? Schon richtig, aber natürlich auch, um zu verstehen.
Und so stehen auf der Seite Drei Texte aus Butscha, in denen beschrieben wird, wie die Menschen versuchen, nach den Kriegsverbrechen der Russen weiterzuleben an diesem Ort. Oder Reportagen über ukrainische Männer, die nicht eingezogen werden, und die versuchen zurechtzukommen mit dem Nichtgebrauchtwerden. Generationen von USA-Korrespondenten haben versucht, Weltgeschichte in Geschichten zu verdichten, den Terror von 9/11, den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, Kennedy, Reagan, Clinton, Obama, Trump. Reporterinnen und Reporter sind in das fast schon an die Taliban verlorene Kabul eingeflogen, haben die letzten russischen Touristen in Lettland besucht und waren mit den Demonstranten auf den Straßen Moskaus nach Putins Teilmobilmachung. Oder sie haben Markus Söder dabei beobachtet, wie er sich gerade neu erfindet, um im Amt zu bleiben. Da bleibt kein Bierfass unangezapft und kein Grußwort ungehalten.
Die Reportage wurde so oft totgesagt, aber sie hat sogar die Pandemie überlebt
Und oft spielen diese Geschichten gleich hier, gleich nebenan. Im Landgericht Bad Kreuznach, wo eine Mutter dem Mann gegenübersitzt, der ihren Sohn in einer Tankstelle erschossen hat. Weil der ihn bat, eine Maske aufzusetzen. Oder im Berliner Ensemble, wenn Angela Merkel noch einmal im Ruhestand auftritt und ihre kurze Rückkehr ein mittelschweres Beben auslöst. Bei der Frau aus dem China-Restaurant, die schon ganz am Anfang der Pandemie damit klarkommen muss, dass viele sie, die Chinesin, für schuldig halten an der Verbreitung des neuen Virus. Bei den zwei Frauen, die ihre Freundschaft verlieren in und wegen der Pandemie. Beim Abwassermeister, der weiß, welche Geheimnisse über die Menschen die Kanalisation birgt. Beim Metzgermeister, der nicht mehr kann und wie so viele aufgibt. Beim Apollofalter-Beauftragten, der die Bedeutung eines Flügelschlags kennt. Beim Schlagersänger, der doch eigentlich von seinen Auftritten am Leben gehalten wird, der aber wegen Corona nicht mehr auftreten darf.
Die Reportage wurde so oft totgesagt, aber sie lebt. Selbst die Pandemie hat sie überstanden. Obwohl es ja zum Wesen des Reporters gehört, Menschen zu treffen, mit ihnen zu reden, sie zu begleiten, ihnen im übertragenen Sinn nahezukommen. Nur wie – in Zeiten, in denen man keine Menschen treffen und eben keinem nahekommen soll? So viele Spaziergänge in frischer Luft, so viele Interviews am Balkon, die alte Frau oben, die Reporterin unten, auf der Wiese vor dem Haus. Oder man saß sich gegenüber, ein paar Meter Abstand dazwischen. Und unternahm immer noch mehr Spaziergänge. Aber es war ein Erleben auf Distanz.
Was bleibt, ist der Appell: wieder mehr rausgehen, wieder mehr losschicken. Vor Ort sein, vor Ort versuchen zu verstehen und die Leser und Zuschauer dann verstehen lassen. Nicht mehr, nicht weniger.