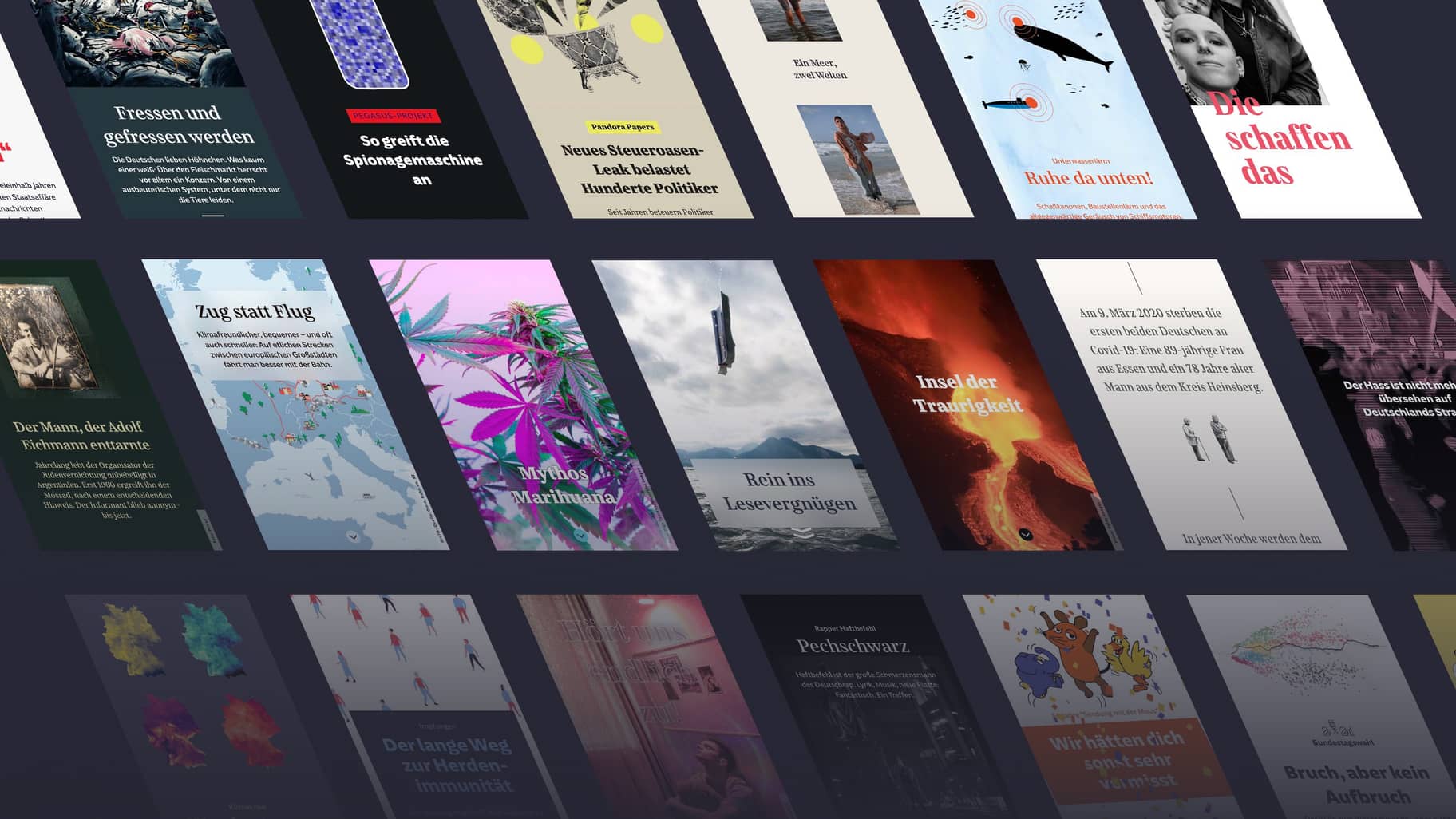Ukraine
Was wir vom Krieg sehen
24. August 2022
-
4 Min. Lesezeit
Es sind die verschwommenen Aufnahmen einer Überwachungskamera am Grenzübergang Amjansk, die den Moment festhalten: russische Militärfahrzeuge überqueren die Grenze zur Ukraine, es ist der 24.