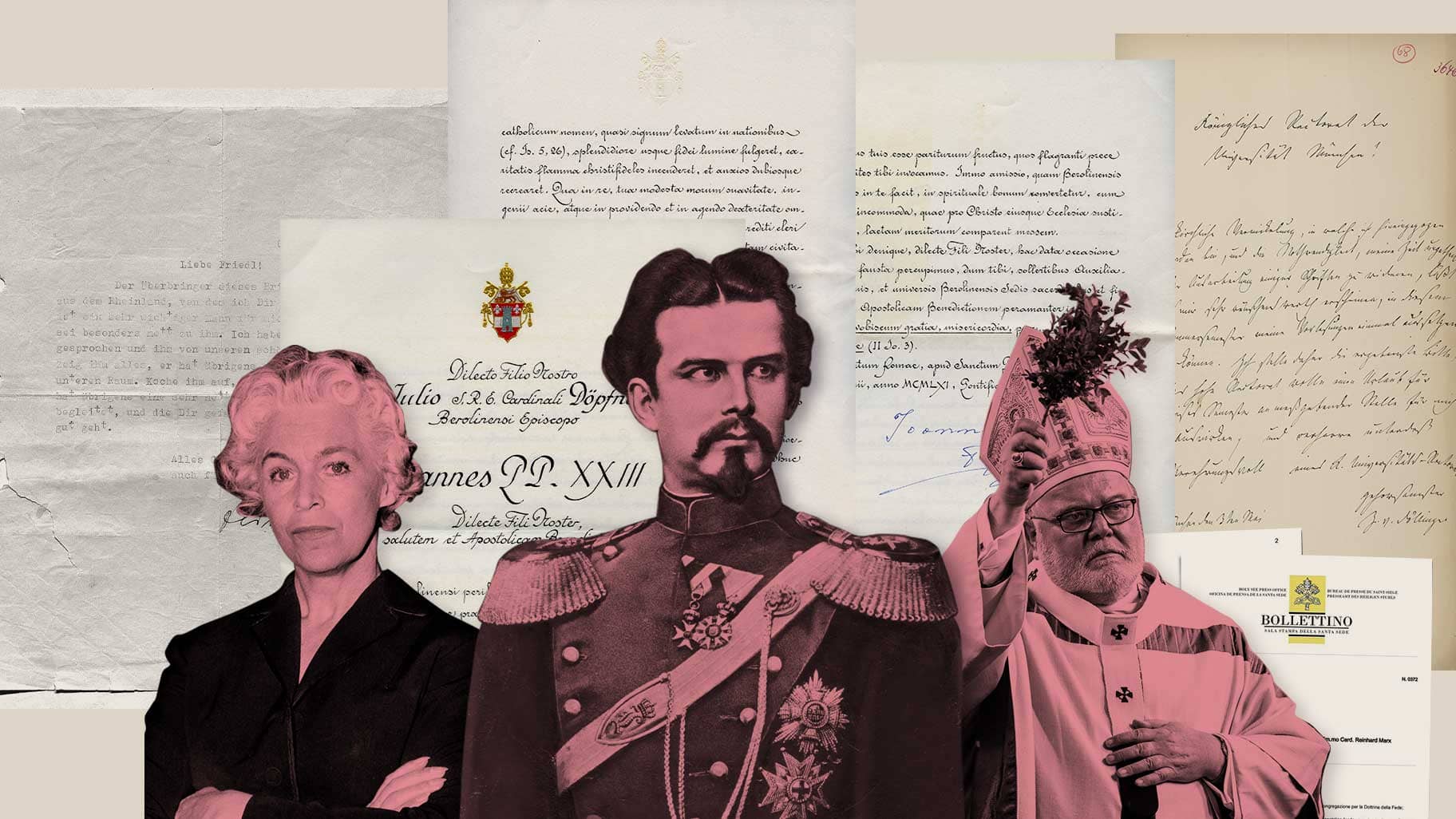Foto: Joe Papeo/imago images/ZUMA Wire
Foto: Joe Papeo/imago images/ZUMA Wire
Foto: NiyixFotex/imago images/TheNews2
Foto: NiyixFotex/imago images/TheNews2
29. April 2022
-
12 Min. Lesezeit
Zwei Mal hat München das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt, nun steht fest: Am 17.