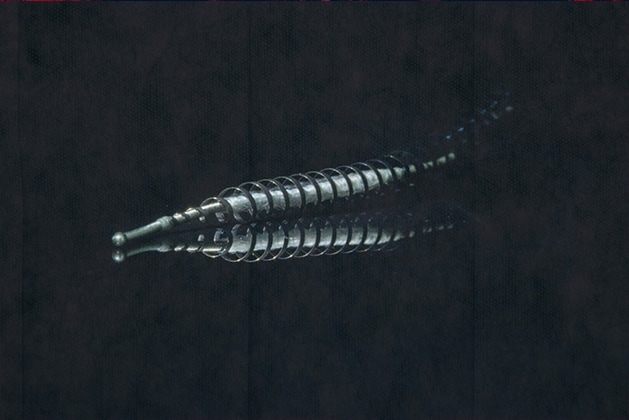Als Notfall gilt, wenn mehr als 15 Prozent der Unter-Fünf-Jährigen akut unterernährt sind. Nur: „Wir haben hier seit vielen Jahren immer um die 15 Prozent unterernährte Kinder“, sagt Philipp Ewoton, Ernährungswissenschaftler bei der Welthungerhilfe. „Der Notstand ist die neue Norm“, ergänzt Kelvin Shingles, der die Programme der Organisation in Kenia leitet.
Hier ist längst klar: Die Menschen müssen sich an das veränderte Klima anpassen.
Neuland
Eine von denen, die es nach Kräften versuchen, ist Nancy Apua, 36 Jahre alt, Alleinversorgerin von vier Kindern. Sie rückt das Kopftuch zurecht und sagt mit fester Stimme: „Mein Garten braucht mich.“

Ihr Garten – das sind etwa zehn mal zehn Meter trockener Boden, aus dem sich winzige Paprika-Pflänzchen kämpfen, ein paar Mais-Blättchen, Spinat, Amaranth-Büsche, ein paar Kürbisse und über allem eine Sonnenblume.
Das ist Neuland im Wortsinn. Nicht nur ist der Garten erst ein knappes halbes Jahr alt und liefert noch nicht genug für ein sorgenfreies Leben. Auch die Idee, Pflanzen anzubauen, ist für die Viehhalter-Gesellschaft neu. Die Welthungerhilfe hat in diese und andere Pflanzungen investiert, weil sie den Frauen eine unabhängige Existenzgrundlage ermöglichen will. Nun kämpft Nancy Apua täglich von sieben bis ein Uhr gegen Trockenheit und Schädlinge: „Nur so kann ich meinen Garten in solch gutem Zustand halten“.

Einige Kilometer weiter ist die Gartenidylle in Gefahr. Die Frauen stehen in ihrer Gemeinschaftsfarm und immer wieder fällt das Wort Ngakipi. Was der Brunnen neben ihren Beeten hergibt, reicht nicht mehr für die so mühsam hochgezogenen Gewächse, zumal auch die Tiere der Umgebung ihre Mäuler in das Rinnsal aus dem Brunnen stecken. Im Konkurrenzkampf um Wasser sind die Pflanzen die ersten Verlierer. Man spürt Frustration unter den Frauen, man ahnt, dass es weitere Verlierer, weitere Fluchten geben wird. Schon länger ziehen die Menschen von hier weg – in die kleineren Städte der Region, die Jungen bis nach Nairobi und Mombasa. Und dort beginnt oft eine andere Geschichte.
Die Menschen werden fett.
Es mag zunächst absurd oder gar zynisch wirken, sich über dicke Bäuche zu sorgen, über Leute, denen es offenbar zu gut geht. Doch genau diese Sichtweise ist Teil des Problems.
Übergewicht ist weder ein Luxus- noch ein Randproblem. Es ist Teil des Phänomens Fehlernährung, das längst der größte Krankmacher auf dem Planeten ist. Jedes fünfte durch Krankheit oder vorzeitigen Tod verlorene Lebensjahr geht auf zuwenig, zuviel oder besonders ungünstige Nahrung zurück, legten Forscher vor kurzem im Fachblatt Lancet dar.
Während der Hunger auch aufgrund der Erderwärmung langsamer abnimmt als erhofft, steigt gleichzeitig das Überangebot an Kohlenhydraten, Fett und Zucker auf den Tellern der meisten Regionen an. Der Ressourcenverbrauch befeuert wiederum den Klimawandel. „Bis jetzt wurden Unterernährung und Fettleibigkeit als Gegensätze gesehen“, sagt der Hauptautor der Lancet-Studie, Boyd Swinburn von der University of Auckland. „Tatsächlich werden sie beide von demselben ungesunden, ungerechten Ernährungssystem angetrieben und von derselben Wirtschaftspolitik unterstützt, die sich allein auf ökonomisches Wachstum fokussiert.“ Für die Wissenschaftler ist das Dreigespann aus Unter- und Überernährung sowie dem Klimawandel schlicht: die größte Bedrohung der Menschheit.
Dass das Leben in einem Elendsquartier häufig mit Übergewicht einhergeht, haben Wissenschaftler 2015 in zwei anderen Slums der kenianischen Hauptstadt bestätigt. 35 Prozent der Bewohnerinnen wiegen zu viel, der nationale Durchschnitt liegt bei 25 Prozent. Neun Prozent der Unter-5-Jährigen sind übergewichtig, auch dieser Anteil ist höher als im gesamten Land.
Die Gründe versteht, wer so eine Hütte betritt. Etwa zwei mal zwei Meter stehen für das ganze Leben, für alle Besitztümer zur Verfügung. Gekocht wird auf offenem Feuer, der Herd in irgendeine Lücke gequetscht. Die Luft ist stickig, die Flammen in der Enge gefährlich. Es gibt täglich Brände in den Slums. Hier kocht nur, wer unbedingt muss.
Die meisten Menschen kaufen fertiges, billiges Essen auf der Straße. Brotfladen, Teigtaschen und Pommes, ausgebacken oft in tierischem Fett. Für einen vielfältigen Speiseplan fehlen das Geld, der Platz, die Einsicht. "Der Alltag der Menschen hier ist ein Überlebenskampf; sie setzen sich nicht ohne weiteres hin und überlegen, wie sie ihre Ernährung umstellen können", sagt Yvonne Flammer.
Eine Milliarde Dollar wären den Lancet-Autoren zufolge nötig, um die Fehlernährung in all ihren Formen überhaupt erstmal prominent auf die Agenda zu heben. Weitere fünf Billionen, mit denen heute Transport und Agrarindustrie subventioniert werden, müssten stattdessen in eine nachhaltigere und gesündere Landwirtschaft fließen. Damit das gelingt, dürften die Vertreter von Big Food nicht mehr länger in den Stuben der politischen Entscheidungsträger sitzen.
Denn während die Politik die komplexen Zusammenhänge der Fehlernährung weitgehend ignoriert, profitiert die Branche längst davon. Selbst in den winzigen Städtchen der abgelegenen Turkana-Region werden Ankommende heute mit dem rot-weißen Schriftzug auf Hauswänden oder Plakaten begrüßt: “Burudika na Coke” - Genieße deine Cola. Der Konzern kennt den Durst der geplagten Entwicklungsländer ganz genau.
Die Recherche für diesen Artikel wurde vom European Journalism Centre/ Global Health Journalism Grant Programm für Deutschland unterstützt.