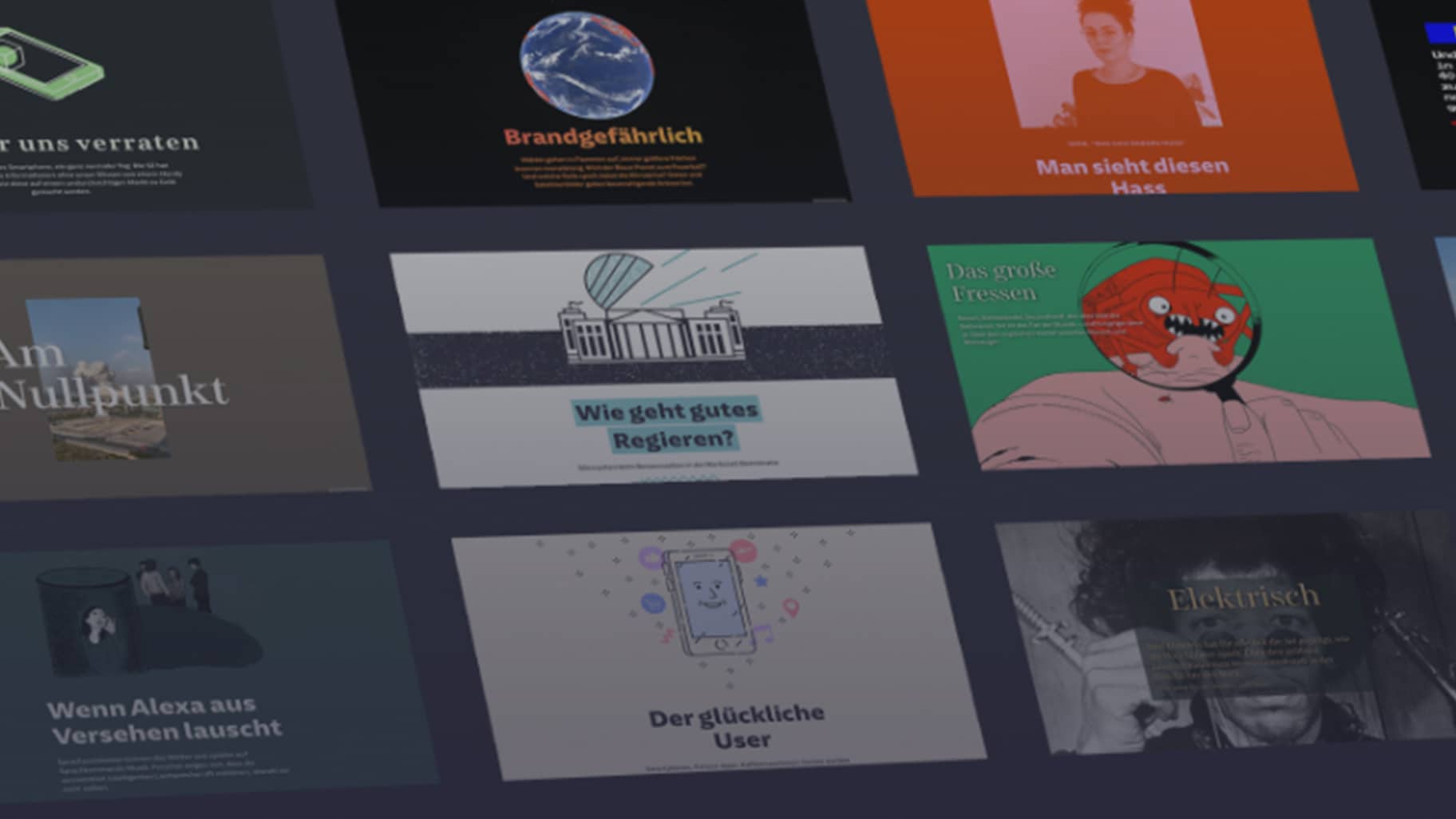War ein seltsames Pop-Jahr. Natürlich auch pandemiebedingt. Mindestens 50 Prozent dessen, was den so wunderbaren Musikzirkus ausmacht, also die Konzerte, Tourneen, Festivals, waren weiterhin weg. Und die wenigen, die es gab, zumindest hierzulande, waren mit Abstand, Korbstühlen, Picknickdecken oder in Autos ein vernünftiger Ersatz (oder von Nena), aber zu echten Konzerten verhielten sie sich doch eher wie eine Ukulele zu einer E-Gitarre: Man kann dazu singen, aber will man wirklich?
Für die Fans war das traurig. Für die Industrie, vor allem die Teile, die ein paar Tonnen Stahl, Holz und Elektronik von einer Stadt in die nächste karrt, aufbaut, aufreißt, abbaut und weiterfährt, war es eine existenzbedrohende (und zum Teil -vernichtende) Katastrophe.
Aber auch was Alben, EPs und Singles betraf, war 2021 eigen. Eher wenige Meisterwerke, auf die sich alle einigen konnte. Zumindest im Westen kein richtig bestimmendes Genre – weder künstlerisch noch in den Verkaufszahlen (K-Pop: wie immer riesig, eh klar). Und auch kaum Künstler, die über alle Maßen kommerziell strahlten. Dafür ein paar Überraschungen: Abba waren plötzlich cool – und spät im Jahr mit ihrem Comeback-Album „Voyage“ dann doch noch bestimmend erfolgreich. Helene Fischer schaffte es deshalb nur auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Ein Jugendmedium namens Tiktok machte Fleetwood Mac, Phil Collins’ Drum-Fill zu „In The Air Tonight“ und Seemannslieder wieder zum Phänomen. Ein inzwischen auch eher altherrenrockhafter Musiker namens Dave Grohl machte eine junge Schlagzeugerin mit einem epischen, über viele Runde gehenden Duell zur Heldin der Gen-Z.
Dazwischen: viel Altes, ein bisschen Neues – und natürlich doch auch Fantastisches. Hier eine kleine, durchaus subjektive Auswahl.