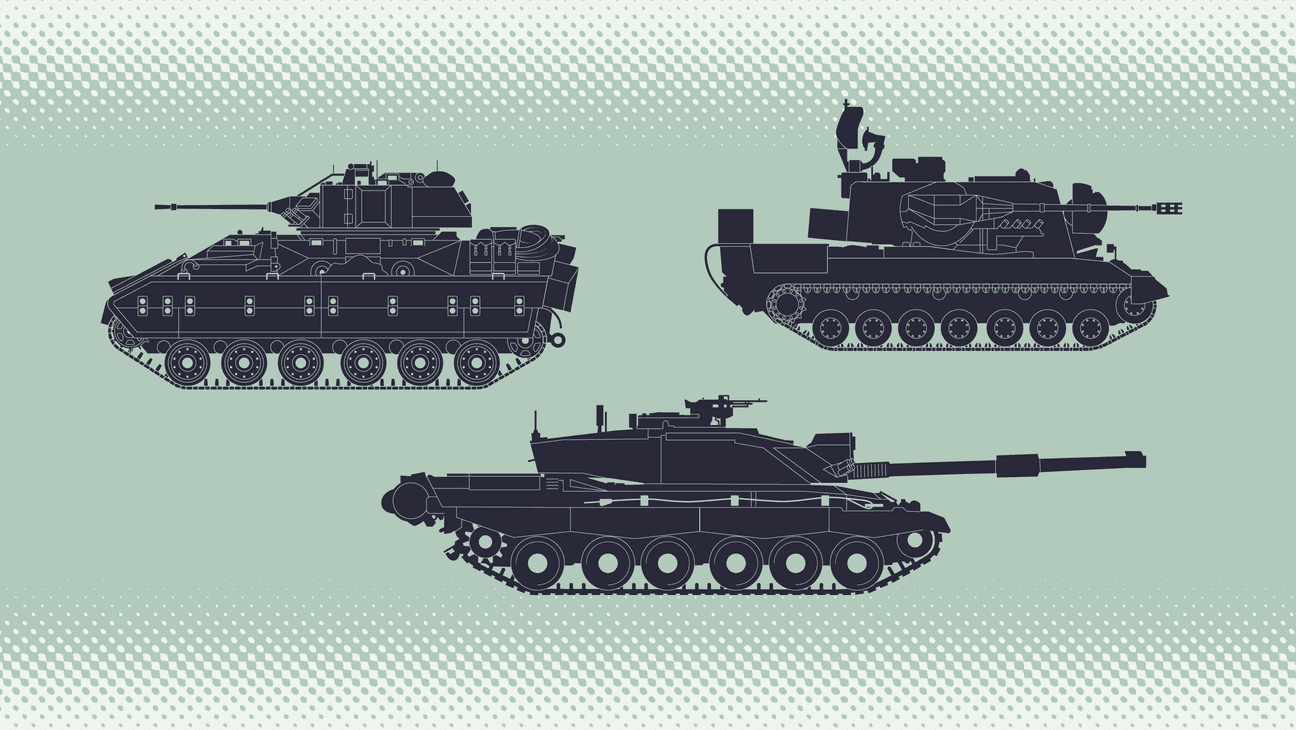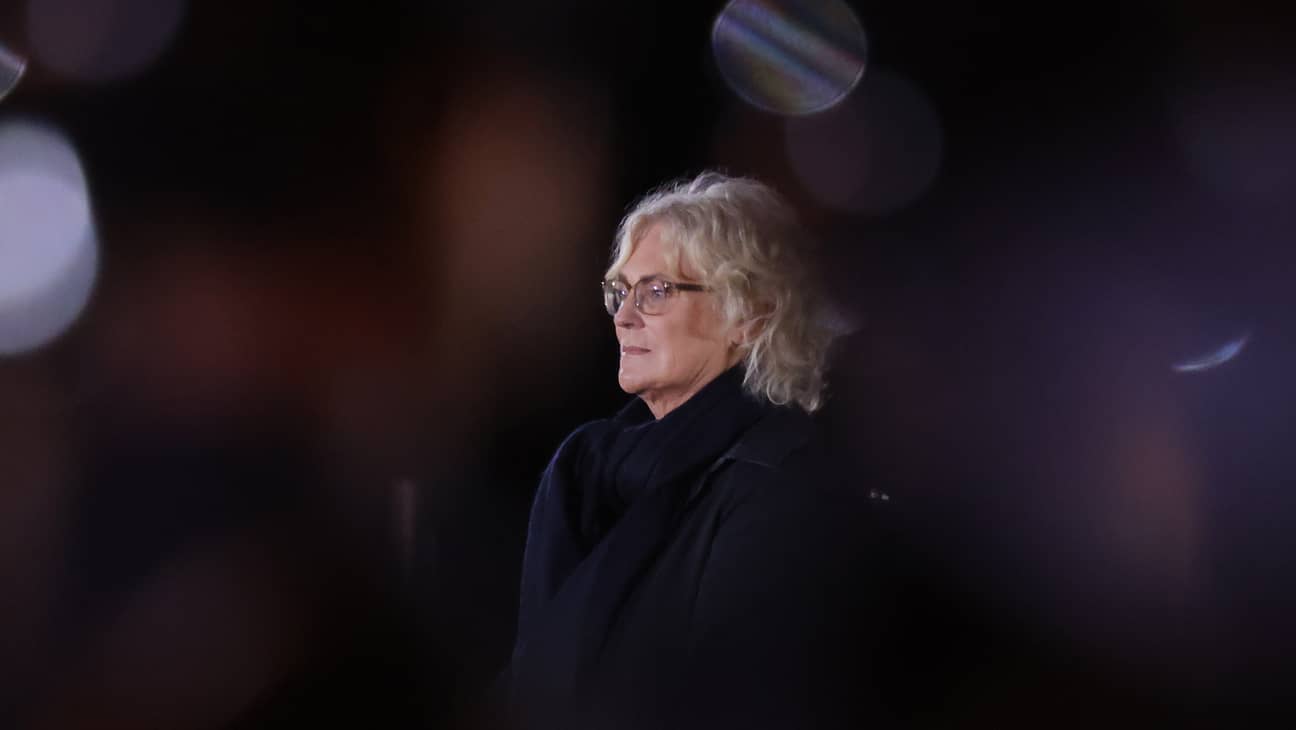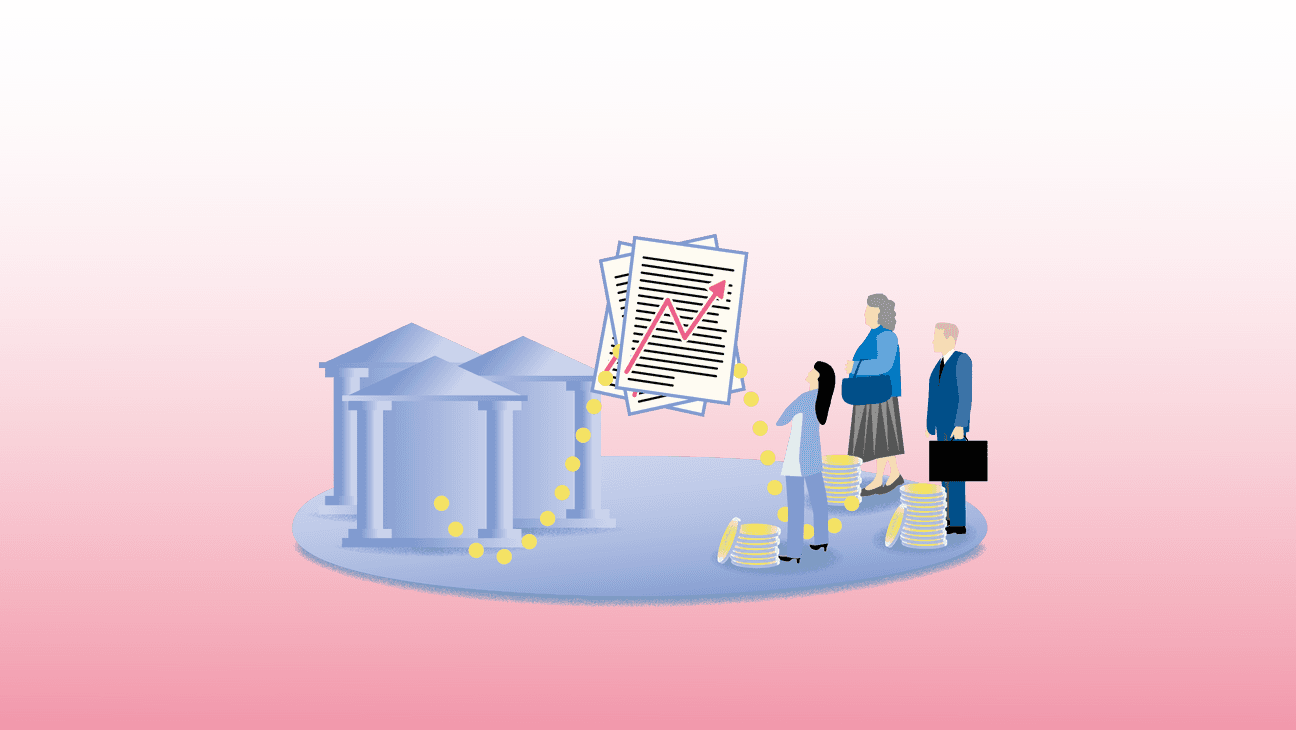Das Politische Buch
Die taumelnde Staatsmacht
27. Januar 2023
-
7 Min. Lesezeit
„Weshalb vergeude ich kümmerliche Worte darum, um denen diesen Winter begreiflich zu machen, die ihn nicht miterlebt haben? Es sind und bleiben Worte nur und doch umspannen sie den ganzen tragischen Zusammenbruch unausgeträumter Hoffnungen ungezählter, namenloser Helden und Märtyrer.