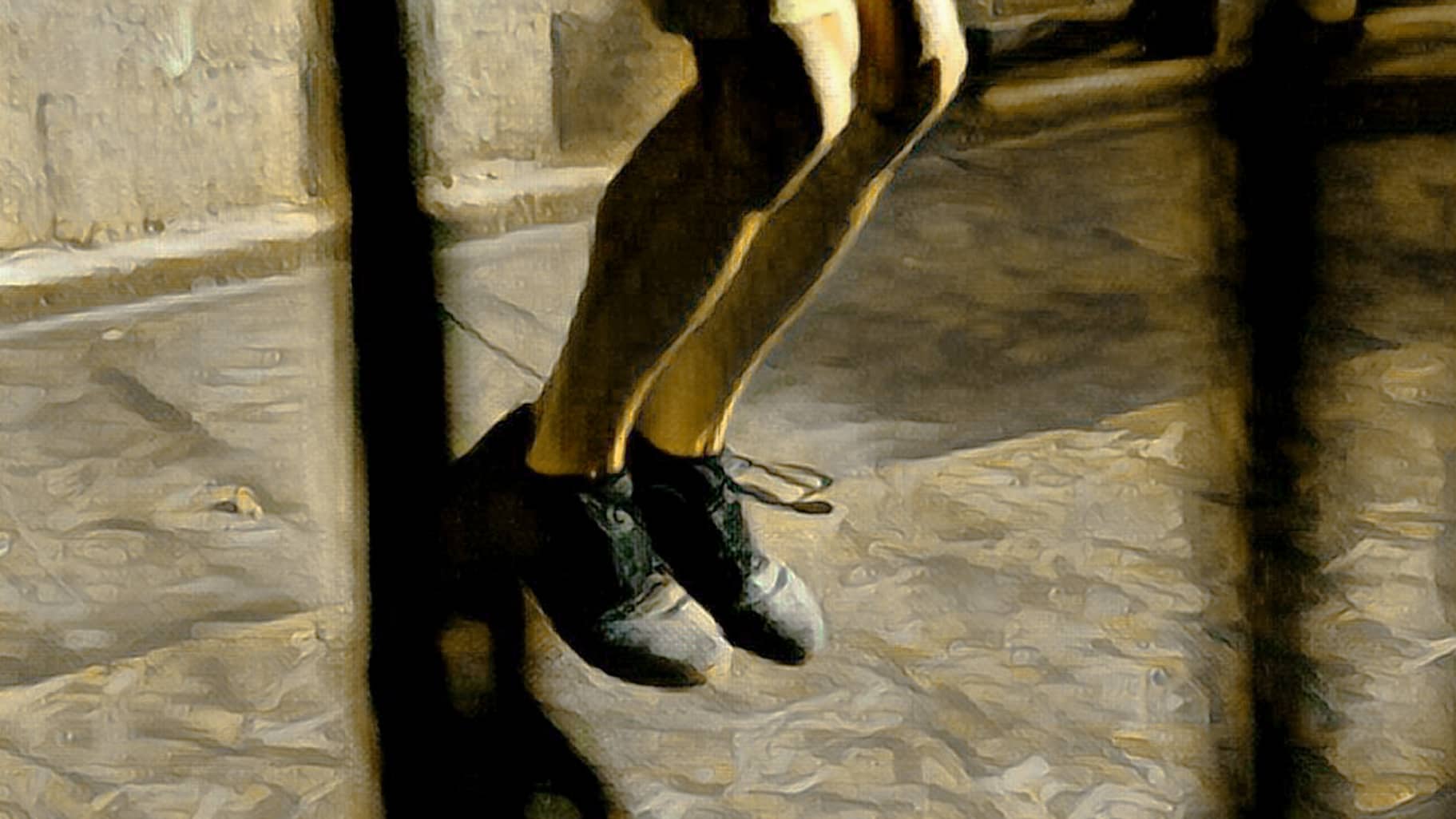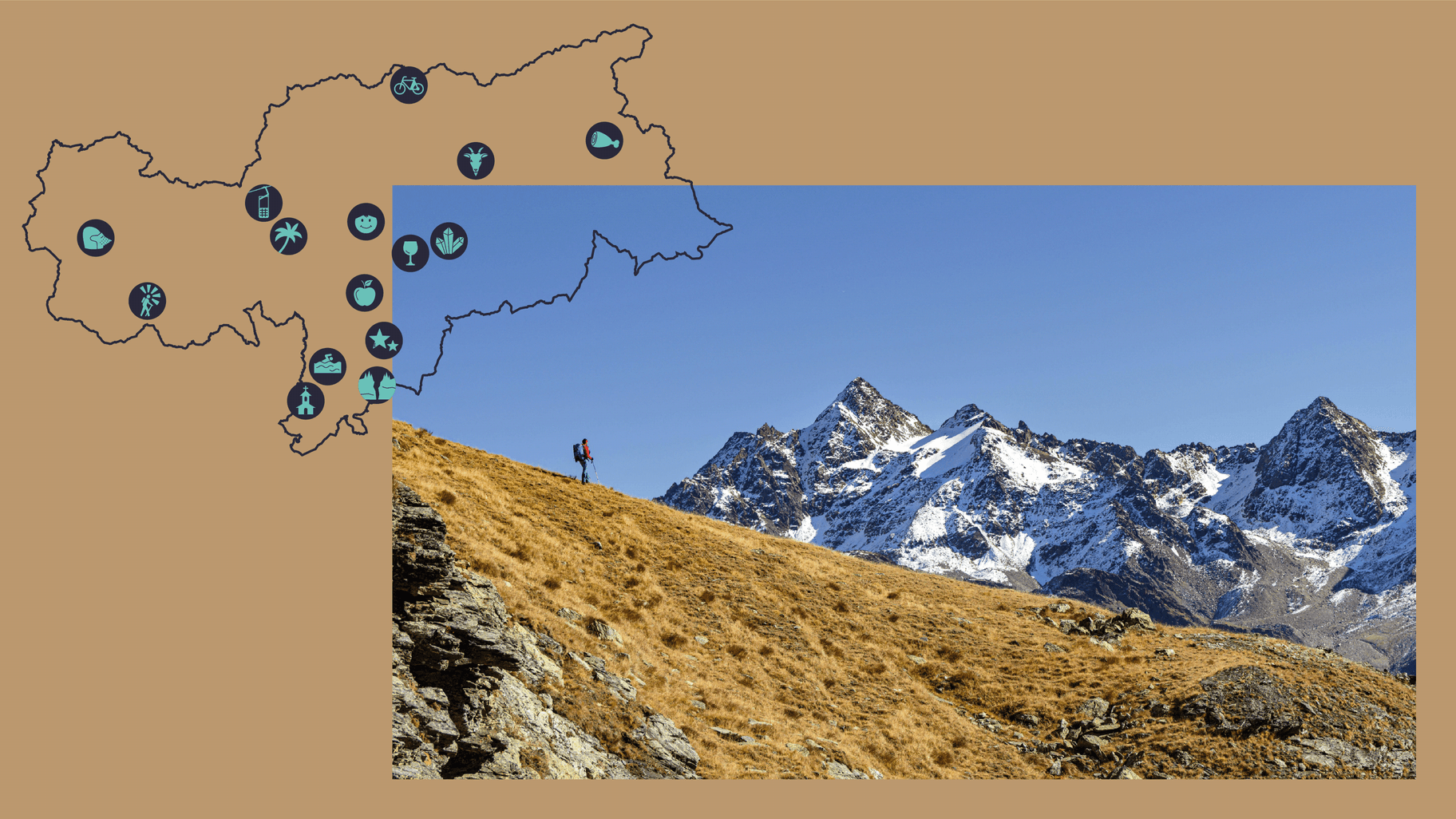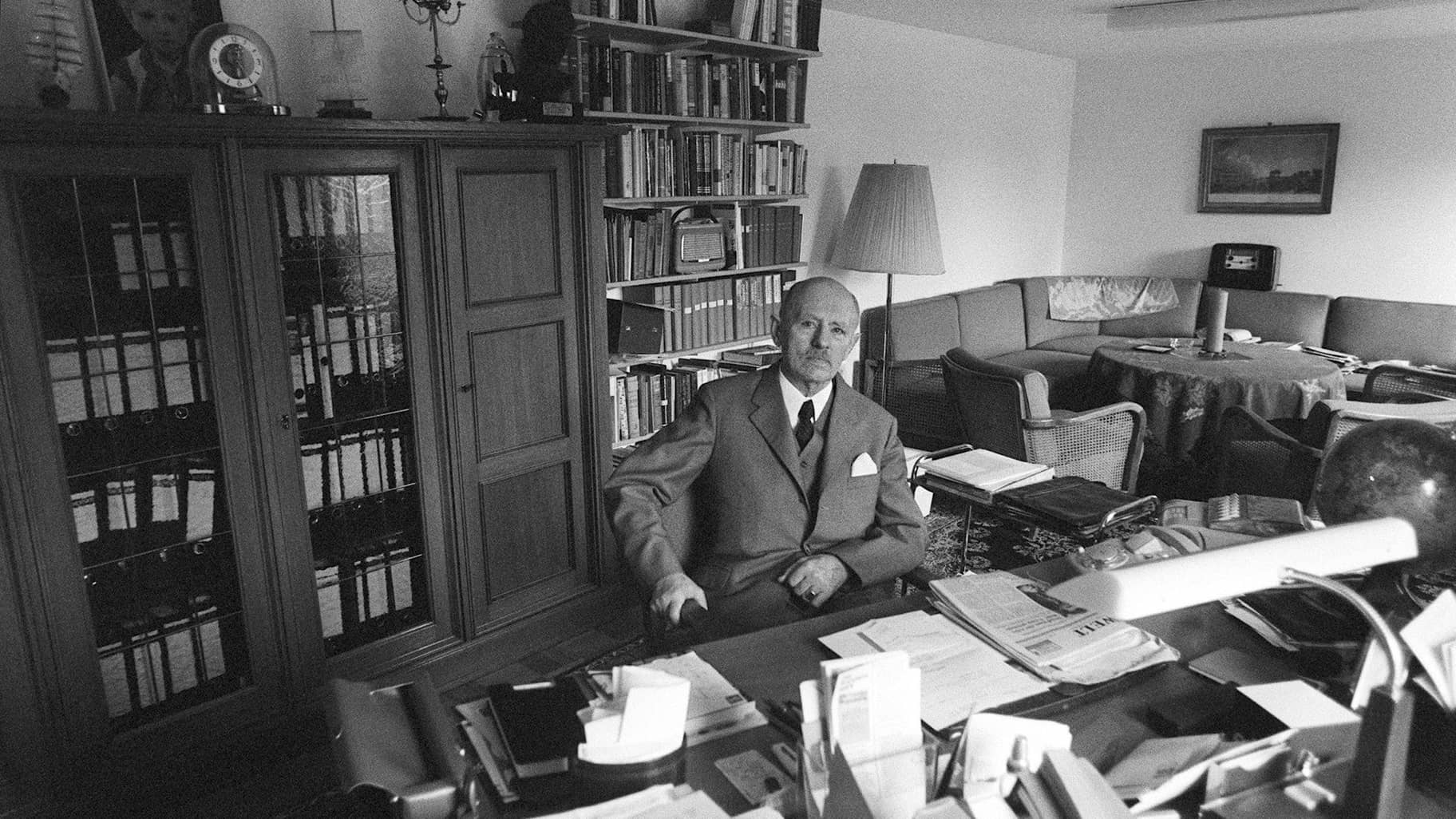Max Strohe im Interview
„Mein Leben ist keine Heldenstory“

Foto: Christian Kielmann/imago
Foto: Christian Kielmann/imago
22. August 2022
-
11 Min. Lesezeit
Erster Eindruck, wenn man den Sternekoch Max Strohe besucht: Was für ein Typ! Nein: Endlich ein Typ! Direkt, herzlich, angstfrei.