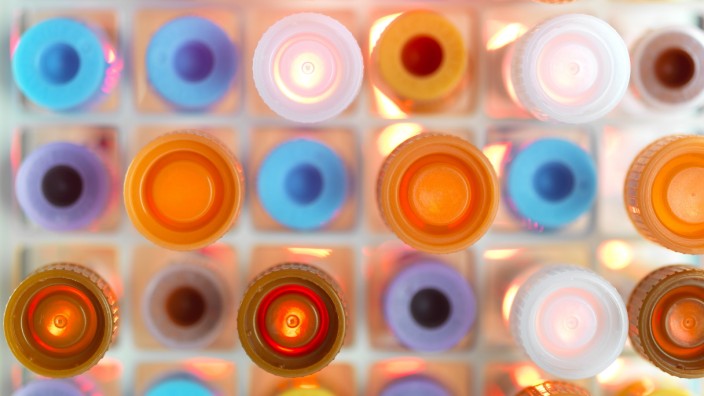Klatsch. Eine Handbewegung, und hundert durchsichtige Pipettenspitzen landen im Müll. Die blauen Einweghandschuhe aus Nitril gleich hinterher. Später fliegen noch zwanzig Petrischalen aus Polystyrol mit einem Scheppern in die Tonne - einmal verwendet, um Zellkulturen zu züchten, schon werden sie ausgemustert. Wer mit Laboranten spricht, hört immer wieder einen Satz: Wir verbrauchen ganz schön viel Plastik.
Ganz schön viel - das sagt man so einfach. Aber schön ist das bei Müll eigentlich nie. Und nach dem Ende der kostenlosen Plastiktüte an der Ladenkasse, einem EU-weiten Verbot von Einweggeschirr und Strohhalmen und dem medienwirksamen Start des Ocean-Cleanup-Projekts im Pazifik wird es immer schwieriger, den immensen Plastikverbrauch von Forschungslaboren zu rechtfertigen. Die Plastikdiskussion hat die Lebenswissenschaften erreicht.
Bereits 2015 hat ein Team um den chilenischen Tierphysiologen Mauricio Urbina, damals an der University of Exeter, abgeschätzt, dass biologische, medizinische und agrarwissenschaftliche Labore auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr ungefähr 5,5 Millionen Tonnen Plastikmüll verursacht hatten. Das entspricht dem Gewicht von 67 Kreuzfahrtschiffen oder knapp zwei Prozent der globalen Plastikproduktion. In einem Brief an die Fachzeitschrift Nature schrieben die Wissenschaftler damals: "Als verantwortungsvolle Forschende sollten wir die Verwendung von Einwegplastikprodukten zurückschrauben." Doch hat sich seitdem etwas getan?
In Deutschland wird der Plastikverbrauch von Laboren nicht erfasst
Das ist schwer zu sagen, denn der Plastikverbrauch von Laboren wird statistisch nicht erfasst; auch gibt es keine verpflichtenden Strategien zur Reduzierung von Plastikmüll in der Wissenschaft. In Deutschland setzt sich seit 2016 die freiwillige Initiative Hoch-N für nachhaltige Entwicklung an Universitäten und Hochschulen ein; umweltfreundlichere Labore und weniger Plastikmüll sind eines der Ziele.
So legt Hoch-N teilnehmenden Institutionen nahe, in ihren Laboren Glaswaren anstelle von Plastikprodukten zu verwenden, Großeinkäufe zu machen, um Verpackungsmüll einzusparen, und den Aspekt Nachhaltigkeit bei der Lieferantenauswahl zu berücksichtigen - sofern möglich. Lediglich 16 von insgesamt 426 deutschen Hochschulen und Universitäten engagieren sich institutionell an der Hoch-N-Initiative, darunter die Technische Universität Dresden, die Universität Bremen, die Freie Universität Berlin und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Hinzu kommen zahlreiche Einzelpersonen von anderen Unis und Hochschulen, die sich in das Netzwerk einbringen.
Auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen rückt der Plastikverbrauch von Forschungseinrichtungen zunehmend in den Fokus. Zum Beispiel entwickelten die University of Washington, die Harvard University und die University of Boulder in Colorado in den vergangenen Jahren Green-Lab-Programme, die Laborprozesse umweltfreundlicher machen sollen. Das University College London kündigte im Oktober sogar an, Plastikprodukte von seinem Campus bis 2024 komplett zu verbannen, darunter auch die vielen Laborutensilien aus Plastik, wie Petrischalen, Pipettenspitzen und Probengefäße. Damit folgt die Londoner Universität der University of Leeds, die bis 2023 plastikfrei werden will.
Doch Kerstin Hermuth-Kleinschmidt ist skeptisch, ob das in den Lebenswissenschaften tatsächlich funktioniert. Die promovierte Chemikerin aus Freiburg berät Labore, die ihre Prozesse nachhaltiger gestalten möchten. Und neben der Energiebilanz von Gebäuden und Geräten spielt Müll dabei eine wichtige Rolle. "Ganz ohne Plastik geht es in der Forschung bislang leider nicht", sagt sie. "Manchmal kann man Plastik in Experimenten einfach noch nicht ersetzen."
"Nicht alle Versuche müssen hundert Prozent steril ablaufen"
Zum Beispiel in der DNA-Analytik. Dort wird nämlich mit winzigen Erbgutabschnitten gearbeitet, sodass schon kleinste Verunreinigungen das gesamte Experiment ruinieren können. Deshalb müssen die verwendeten Materialien garantiert frei von fremder DNA und bestimmten Enzymen sein, die das Erbgut verändern. Eine einfache Sterilisation mit einem Autoklaven, einem gasdicht verschließbaren Druckbehälter, der in vielen Laboren steht, reicht dafür nicht aus, und so können bei wiederverwendbaren Utensilien aus Glas zum Beispiel kleinste Mengen von Fremd-DNA in den Versuchsablauf gelangen und das Ergebnis verfälschen. "Immer wenn in kleinsten Mengen gearbeitet wird oder wenn es auf absolute Sterilität ankommt, wird es schwierig, Plastik durch Glas zu ersetzten", sagt Kerstin Hermuth-Kleinschmidt. Das ist zum Beispiel in der Molekular- und Mikrobiologie häufig der Fall.
Wenn es auf absolute Sterilität ankommt, ist Kunststoff kaum zu ersetzen
Auch bei der Züchtung von Zellkulturen sind Kunststoffe aus einem ganz praktischen Grund unentbehrlich: Sie wachsen nämlich am besten auf Oberflächen aus Plastik. "Es ist schwierig, die effektivsten Zellkulturplatten zu finden", sagt Kerstin Hermuth-Kleinschmidt. "Knochenzellen wachsen zum Beispiel besonders gut in Behältern aus Polystyrol." Und obwohl Zellen theoretisch auch auf Unterlagen aus Glas wachsen, hat sich die Züchtung mittlerweile auf Kunststoffoberflächen spezialisiert, weil die Zellen einfach besser an ihnen haften.
Andere Produkte verkaufen Laborzulieferer prinzipiell als einzeln verpackte Einwegprodukte. Zum Beispiel die feinporigen Membranfilter, durch die Laboranten Vitaminzusätze und Spurenelemente laufen lassen, um bakterielle Kontaminationen zu vermeiden. Mikroorganismen brauchen diese Zusätze, um zu wachsen, weshalb viele Nährmedien mit ihnen angereichert werden. Würde man sie in einem Autoklaven bei 121 Grad Celsius für 20 Minuten unter Druck sterilisieren, gingen die Nährstoffe kaputt.
Ohne hitzeempfindliche Zusätze können Nährmedien jedoch ohne Probleme in Autoklaven von bakteriellen Kontaminationen befreit werden. "Und nicht alle Versuche müssen hundert Prozent steril ablaufen", sagt Kerstin Hermuth-Kleinschmidt. Deshalb können Pipetten und Gefäße aus Kunststoff oder Glas häufig einfach gespült und öfter verwendet werden.
Ein Vorteil ist auch, dass viele Laborutensilien aus sehr reinen Kunststoffen hergestellt werden, zum Beispiel aus Polypropylen oder High-Density Polyethylen. So lassen sich viele der Artikel bei fachgerechter Entsorgung gut recyceln - solange gefährliche Kontaminationen ausgeschlossen sind. "Trotzdem landen viele dieser Laborutensilien einfach im Restmüll und werden verbrannt", sagt Kerstin Hermuth-Kleinschmidt.
Manche Hersteller bieten umweltfreundlichere Pipetten und Nachfüllpackungen an
Selbst Einweghandschuhe aus Nitril können gesammelt und recycelt werden. Ein amerikanischer Hersteller, der auch in Deutschland Laborartikel verkauft, bietet seinen Kunden nämlich an, gebrauchte Handschuhe zurückzusenden. So können sie zu Pellets gepresst und später zu Gartenmöbeln oder Transportkisten verarbeitet werden. "Das ist dann eher ein Downcycling", kommentiert Kerstin Hermuth-Kleinschmidt. Aber besser, als die Handschuhe einfach wegzuwerfen, ist es auf jeden Fall, vor allem wenn man bedenkt, dass Laboranten oft mehrere Paare am Tag benutzen.
Auch andere Hersteller von Laborbedarf arbeiten daran, ihren Plastikverbrauch zu minimieren - zum Beispiel, indem sie dünnwandigere Pipettenspitzen aus Polypropylen herstellen oder Nachfüllsysteme für Produkte entwickeln, die häufig als Einwegartikel verkauft werden. Selbst bei Verpackungen gibt es kunststofffreie Alternativen: Zum Beispiel stellt eine deutsche Firma Isolierboxen aus Stroh her, die Styroporboxen für den Transport von Enzymen und anderen temperaturempfindlichen Substanzen ersetzten können. Weniger Plastik bei gleicher Qualität gibt es also immer öfter, auch wenn es nur einzelne Firmen sind, die diese umweltfreundlicheren Alternativen und Services anbieten.
Außerdem werden viele alltägliche Utensilien auch immer noch in den traditionellen Varianten aus Glas angeboten, zum Beispiel Erlenmeyerkolben oder Petrischalen. Dann wird zwar für die Sterilisation Energie und Wasser verbraucht, aber man kann sie viele Male einsetzten.
"Im Laborbetrieb ist nicht immer alles ersetzbar oder lösbar", sagt Kerstin Hermuth-Kleinschmidt. "Man muss sich die einzelnen Prozesse anschauen und sehen, wo es Möglichkeiten gibt, Plastikmüll zu reduzieren." Komplett plastikfrei werden die Lebenswissenschaften wohl nie arbeiten, doch die Spielräume, um Plastik einzusparen, sind auf jeden Fall da.