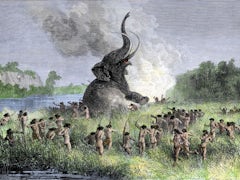An den Wänden des Knochenkellers lehnen Oberschenkelknochen, manche mehr als hüfthoch und so schwer, dass kein Mitarbeiter des Museums sie alleine tragen könnte. Sie stammen von Dinosauriern wie dem Dicraeosaurus, der vor etwa 150 Millionen Jahren im heutigen Tansania lebte. Auch in den Regalen liegen mit Gips zusammengeklebte, versteinerte Knochen, dazwischen stehen ein paar alte Kisten und kleine, tonnenförmige Behälter, ehemalige Bambustrommeln.
Deutsche Expeditionsteilnehmer haben sie während der Kolonialzeit vor mehr als 100 Jahren aus dem damaligen Deutsch-Ostafrika nach Berlin gebracht. Mehr als 230 Tonnen Material sandte die Tendaguru-Expedition ans Naturkundemuseum. Im Eingangsbereich steht der mächtige Giraffatitan, dessen Hals bis unter das Dach reicht. Es ist das "weltweit größte montierte Saurierskelett". Der aus vielen Einzelteilen in jahrzehntelanger Arbeit in Berlin zusammengebaute Dinosaurier ist eine Ikone des Museums.

Männer sind heldenhafte Jäger, Frauen kümmern sich um Heim und Kind - soweit die gängige Vorstellung von der Steinzeit. Es gibt nur ein kleines Problem: Das stimmt nicht.
Nun werden Forderungen etwa aus Tansania lauter, einige der Fossilien zurückzugeben, darunter auch den Giraffatitan. Es ist nicht der einzige Fall. Dem Natural History Museum in London liegen drei konkrete Rückführungsanträge aus Afrika vor, so bat etwa Sambia um den 300 000 Jahre alten Schädel eines berühmten Hominiden aus Broken Hill, heute Kabwe. Was lange Zeit vor allem das kulturelle Erbe betraf, weitet sich nun auf Objekte aus naturkundlichen Sammlungen aus. Es geht dabei sowohl um sterbliche Überreste von Menschen, also etwa Schädel oder mumifizierte Körper, um fossile Überreste, Knochen von Vor- und Frühmenschen, als auch um andere natürliche Objekte, Mineralien, Tier- und Pflanzenreste. Dazu gehören etwa die Dinosaurierknochen aus dem Naturkundemuseum in Berlin.
"Es geht nicht nur darum, die Objekte aus der Kolonialzeit in einen Container zu packen."
Die Diskussion eskaliere gerade in vielen Ländern, sagt Ciraj Rassool von der University of the Western Cape im südafrikanischen Bellville, Historiker und weltweit renommierter Experte für die Dekolonialisierung von Museen. "Der Druck nimmt zu." Es gehe dabei nicht nur um die Rückgabe einzelner Objekte aus Sammlungen, sondern um das Verhältnis zur Kolonialgeschichte insgesamt. Und einiges bewegt sich tatsächlich - aber nicht allen geht es schnell genug.
Anfang März war eine tansanische Delegation in Berlin, wenige Wochen später folgte der deutsche Gegenbesuch. Gemeinsam mit hochrangigen Mitarbeitern des Auswärtigen Amts flogen Museumsvertreter nach Daressalam, darunter Christoph Häuser vom Berliner Naturkundemuseum und Friedemann Schrenk vom Frankfurter Senckenbergmuseum, um mit den dortigen Kollegen über das Problem und die Zusammenarbeit bei künftigen Ausgrabungen zu sprechen. Als erste Maßnahme soll eine Kopie des großen Tendaguru-Dinosauriers für das Nationalmuseum in Daressalam hergestellt werden, finanziert vom Berliner Naturkundemuseum und der neuen Agentur für Internationale Museumszusammenarbeit.
Die Delegation besuchte auch den einstigen Grabungsort nahe dem Berg Tendaguru. Es ist noch heute eine der fossilienreichsten Gegenden der Welt. "Dort liegen tonnenweise Dinosaurier", sagt Johannes Vogel, der Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums. Die Hoffnung ist groß, dort neue spektakuläre Dinosaurier zu entdecken und wissenschaftlich auszuwerten. Vogel ist sehr an neuen gemeinsamen Ausgrabungen interessiert. "Die Originale würden dann wie schon bei früheren gemeinsamen Expeditionen natürlich im Museum in Daressalam bleiben", sagt er.
Noch sind jedoch nur wenige deutsche Museumsvertreter bereit, alte Objekte zurückzugeben. So hält Johannes Vogel die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit zwar für wichtig. Den Giraffatitan aber sieht er nicht als "richtiges Objekt für die Rückgabediskussion", man müsse "zwischen Kultur- und Naturgütern unterscheiden". Der Giraffatitan sei schließlich so gar nicht in Tansania gefunden worden, sei also mitnichten ein Kulturobjekt, das Tansania entrissen wurde. Nur die unterarmgroßen Fragmente stammten von dort: "Er wurde erst in Berlin in jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit zu einem Dinosaurier-Modell zusammengesetzt", sagt Vogel.
Ciraj Rassool hält diese Äußerung für opportunistisch. "Natürlich steckt im Giraffatitan intellektuelle Arbeit, die in Deutschland stattfand, aber die Objekte stammten nun mal aus Tansania", sagt Rassool. "Vogel vertritt überholte Positionen." Der Historiker hält eine grundlegendere Diskussion für notwendig. "Es geht nicht nur darum, die Objekte aus der Kolonialzeit in einen Container zu packen und nach Afrika zu bringen", sagt er. "Es geht auch um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Die Museen und ihre Sammlungen müssen sich verändern. Naturgeschichte ist nicht unpolitisch oder neutral, sie ist ein Teil der Kulturgeschichte."
Auch Friedemann Schrenk, der häufig in Afrika forscht und in Malawi ein naturkundliches Museum mitinitiiert hat, fordert eine viel stärkere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. "Gerade junge und gebildete Menschen in vielen afrikanischen Ländern entdecken ihre Geschichte und die Bedeutung wichtiger Funde für die Identität eines Landes", sagt der Frankfurter Paläoanthropologe. "Das erhöht den Druck auf die Regierenden, es ist die zunehmende Demokratisierung kulturellen und natürlichen Erbes, die diese Diskussionen antreibt."
Schrenk geht das bisher Erreichte nicht weit genug. In einem Artikel in der FAZ forderte er jüngst, man müsse endlich miteinander über die Objekte verhandeln, es gehe schließlich um Afrikas Erbe. Eine weitere große Forderung ist Zugänglichkeit. "Mit dem Pass eines afrikanischen Staates hat man keine Chance auf ein Visum, um europäische Museen zu besuchen: Eine bittere Erkenntnis für Menschen, die an ihrem Erbe teilhaben wollen, aber behandelt werden wie lästige Bittsteller", sagt Schrenk. "Kolonialismus zeigt sich heute an den Grenzen: Wer hat die Freiheit zu reisen, und wer nicht?", sagt auch Rassool. Er erzählt, wie mühsam und oft auch teuer es selbst für ihn sei, ein Visum für eine Konferenz zu erhalten. Erst kürzlich habe er daher die Teilnahme an einer Konferenz absagen müssen. Die Diskussion berühre eben auch die aktuellen politischen Fragen der europäischen Abschottung.
Es gibt jedoch erste Fortschritte. Immer häufiger verbringen afrikanische Wissenschaftler zur Aus- und Weiterbildung Zeit an deutschen Instituten oder arbeiten an Ausstellungen mit, die dann international gezeigt werden. Mittelfristiges Ziel ist es, Museen in Afrika dafür bereit zu machen, auch wertvolle Objekte professionell zu lagern und Kapazitäten für die internationale Forschergemeinde bereitzustellen. Es gibt etwa im äthiopischen Addis Abeba Einrichtungen auf internationalem Niveau. Dort werden mittlerweile Lucy und weitere wichtige Hominiden-Funde unter optimalen Bedingungen aufbewahrt. Forscher aus aller Welt pilgern ganz selbstverständlich nach Äthiopien, um die Geschichte der Menschheit zu erforschen. So plädieren Anthropologen dafür, Objekte dann zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen wie in Addis Abeba da seien. Manche Wissenschaftler bezweifeln jedoch, dass sich dieses Niveau bald erreichen lässt.
Das Thema Rückgabe ist sensibel und komplex. Doch es gibt auch kreative Vorschläge. So könnte man die Eigentumsrechte an wichtigen Objekten aus der Kolonialzeit zurückgeben und die Exponate gleichzeitig über Verträge dauerhaft zurückleihen. Die Leihgebühr könnte in den Herkunftsländern Museen sowie dem Aufbau von Infrastruktur und Expertise zugute kommen. Für Stücke wie den Giraffatitan wäre das eine Möglichkeit, auch für kulturelle Güter wie die Elgin Marbles von der Akropolis am British Museum in London wird das diskutiert. Aus Sicht der betroffenen Museen wäre das eine Möglichkeit, wichtige Exponate zu halten.

Im Norden Israels könnten sich vor 55 000 Jahren moderner Mensch und Neandertaler zum ersten Mal begegnet sein. Feuerstellen, ein Schädelknochen und viel Fantasie beflügeln diese Theorie. Ein Besuch in der Höhle von Manot.
Doch es geht nicht nur um Einzelfälle, sondern generell um das Erscheinungsbild der großen Museen in London, New York, Paris oder Berlin. Schließlich meinen viele Wissenschaftshistoriker, dass die heutigen Naturkundemuseen ohne die Kolonialzeit gar nicht denkbar wären - ein Zusammenhang, der für den Besucher selten bis nie deutlich wird. Zum Teil beginnen die Museen jedoch von sich aus, die düstere Geschichte ihrer Exponate aufzuarbeiten.
Für das jüngst erschienene Buch "Dinosaurierfragmente" haben Holger Stoecker von der Humboldt-Universität Berlin und Ina Heumann vom Museum für Naturkunde jahrelang die Geschichte der Tendaguru-Expedition und die Herkunft der Objekte untersucht. So rekonstruierten die Forscher etwa, dass die Aneignung der Fossilien auf einem Verwaltungsbetrug beruhte und Tansania bis heute in keiner Form irgendeine Gegenleistung erhalten habe.
Sie belegten auch, dass der Anteil der Einheimischen bei der Entdeckung ignoriert wurde. So wird in den Dokumenten der Expedition ein Dino als "Nyororosaurus" bezeichnet, nach Seliman Nyororo, der 1909 die Ausgrabung leitete. Offiziell heißt das Exemplar aber Dicraeosaurus sattleri nach einem deutschen Bergbauingenieur. "Damit reiht sich die Tendaguru-Expedition in eine endlose Reihe von kolonialen Entdeckungsgeschichten ein, in denen der - oftmals entscheidende - Anteil von Indigenen bewusst unsichtbar gemacht wurde", sagt Stoecker.
Noch ist nicht abzuschätzen, wie sich Fälle wie jener der Berliner Tendaguru-Dinosaurier entwickeln werden, und ob die einst beraubten Staaten in Afrika mit den Lösungen zufrieden sein werden. Aber vielleicht wird das Berliner Museum irgendwann zumindest einige Originalknochen aus seinem Keller räumen und an Afrika zurückgeben müssen.