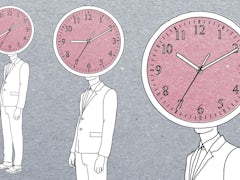Schon der wahrscheinlich allererste Science-Fiction-Roman war einfach nur hanebüchen: Da leben Aliens auf dem Mond, gegen die Atemnot im All hilft ein feuchter Schwamm vor der Nase. Manche Kritiker würden abwinken und rufen: "Alles unrealistisch!" Wüssten sie aber den Namen des Urhebers, wer weiß, sie würden womöglich verstummen. Denn es war der große Astronom und Naturphilosoph Johannes Kepler, der in seiner Erzählung "Somnium" (lateinisch für "der Traum") eine Traumreise zum Mond beschrieb - im Jahr 1608, einige Zeit bevor Galileo Galilei sein Teleskop auf die Sterne richtete und mehr als 300 Jahre, bevor der US-Astronaut Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte.
Die Mondlandung war also 1969 eigentlich schon ein alter Hut. Zumindest, wenn man von der Idee ausgeht. Kepler beschreibt in seinem Roman eine Space Odyssee, spart nicht mit physikalischen Details über die Schwerelosigkeit im All und spekuliert über die Verhältnisse, die auf dem Erdtrabanten wohl herrschen mögen. Auch wenn vieles nicht besonders realistisch ist, so war Keplers Idee doch prophetisch. Es muss wohl kaum erwähnt werden, dass auch Kepler nur einen Gedanken aufschrieb, der wiederum schon viele Jahrhunderte zuvor in den Köpfen anderer Denker geschwelt hatte, zum Beispiel in denen der antiken Schriftsteller Plutarch und Lukian. Science-Fiction als Literaturgattung ist viel älter, als die meisten glauben.

Die Mondlandung ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr der Gang der Welt und auch die Entwicklung der Wissenschaft und Technologie sich in den Geschichten zeigen, die man liest oder in Filmen sieht - und wie sehr diese wieder zurückspiegeln in die Wissenschaft. Umso merkwürdiger ist die Arroganz, mit der viele Kulturschaffende und Literaturkritiker, aber auch Wissenschaftler auf Filme oder Bücher hinabsehen, die sich nicht mit der Vergangenheit oder der Gegenwart befassen, sondern mit der Zukunft. Science-Fiction sei etwas für Eskapisten, heißt es oft.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn natürlich ist es wichtig, sich mit den Gedankenentwürfen über die Zukunft zu befassen. Die Menschheit verändert ihre Lebenswelt in solchem Tempo, dass die Visionen von gestern schnell zur Realität von heute werden können. Science-Fiction ist außerdem schon seit Langem keine Domäne pickliger Nerds mehr: Längst im Mainstream angekommen, beeinflusst sie die Meinung der Menschen über die Wissenschaft - und zugleich auch ihre Richtung. Sie spiegelt unser Weltbild und weist auf gesellschaftliche Themen, die kommen werden.
Es gibt unzählige Anekdoten darüber, welche Technologien zuerst in fiktionalen Geschichten auftauchten und später Teil der Wirklichkeit wurden. Als Klassiker gilt Stanley Kubricks "2001: Space Odyssey" aus dem Jahr 1968, in dem sprechende Computer, künstliche Intelligenz, iPad-ähnliche Computerflundern, ebenfalls eine Mondlandung und viele andere visionäre Gadgets auftauchen. Nicht umsonst hieß das erste Klapphandy von Motorola StarTac in Anlehnung an Star Trek, in dem bekanntermaßen schon lange mit "Kommunikatoren" telefoniert wurde, die im Grunde wie heutige Handys aussehen.
Auch der Film Minority Report aus dem Jahr 2002 ist eine regelrechte Fundgrube: Hier finden sich bereits Gesichtserkennung, personalisierte Werbung, Videotelefonie, Gestensteuerung und das Internet der Dinge. Angeblich sind rund hundert Patente aus dem Film heraus entstanden. Und das ist auch kein Zufall, wenn man die Professionalität betrachtet, mit der Steven Spielberg und sein Szenenbildner Alex McDowell an die fiktive Zukunft im Film herangingen.

So setzte sich McDowell mit einigen der damals einflussreichsten Computerforscher zusammen, mit Stadtplanern und Wissenschaftlern, unter anderem vom MIT in Boston. Von ihnen ließ er sich im Detail erklären, wie die Transportsysteme, die Waffen der Zukunft und das Bildungssystem im Jahr 2054 wohl aussehen könnten. Aus den Ergebnissen erstellte er einen Zukunftskatalog, die er "2054-Bibel" nannte. Deshalb wirkt Minority Report wie eine Zukunftsvorhersage, die immer noch nicht veraltet ist.
Der Film "Der Marsianer" wäre nicht entstanden ohne das Expertenwissen der Nasa

Aber noch viel interessanter ist, dass die wissenschaftlich inspirierten Zukunftsentwürfe der Entertainment-Branche wiederum die reale Welt beeinflussen. Alex McDowell etwa leitet heute das World Building Institute an der University of Southern California in Los Angeles, das Nichtregierungsorganisationen, Architekten und Unternehmen berät - die, angeregt von seinen Ideen, Gebäude bauen und Städte planen. "Mich interessieren heute die Probleme der echten Welt mehr als die Probleme der Filmindustrie", sagt McDowell. Wohlgemerkt, McDowell war ursprünglich "nur" ein Szenenbildner in Hollywood.
Überhaupt ist der Einfluss fiktionaler Geschichten viel größer, als ein paar visionäre Gadgets in Filmszenerien glauben machen. "In den USA gibt es eine enge Verflechtung zwischen Hollywood und der Raumfahrtforschung", sagt Alexandra Ganser, Professorin für Amerikanistik an der Universität Wien. Sie untersucht in einem eigenen Forschungsprojekt die Zukunftsvisionen Hollywoods und wie sich diese in der US-amerikanischen Politik und Wissenschaftslandschaft niederschlagen. Spätestens seit Beginn des Wettlaufs ins All mit der Zündung der sowjetischen Sputnik-Rakete am 4. Oktober 1957 beeinflussen sich der Hollywood-Weltraumfilm und die tatsächliche Astrotechnologie wechselseitig.

Auch die didaktischen Filme "Man and the Moon" und "Man in Space" von Walt Disney aus dem Jahr 1955 sind schöne Beispiele. Darin erklärt der deutsche Raketenkonstrukteur Wernher von Braun, der nach dem Zweiten Weltkrieg für die Nasa arbeitete, wie die Raumfahrt funktioniert, ergänzt durch Cartoonszenen. Diese Zusammenarbeit setzte sich im 21. Jahrhundert fort. "Der Film 'Der Marsianer' von Ridley Scott wäre nicht entstanden ohne das Expertenwissen der Nasa, sie war auch sehr an der Vermarktung des Films beteiligt", sagt Ganser. Die Nasa unterhalte ein eigenes Kulturbüro, das PR macht und Einfluss nimmt auf kulturelle Institutionen. "Im Gegenzug eröffnen solche Science-Fiction-Filme Spielräume für das Denken, wecken Interesse und regen zu Ideen an, die dann später wiederum in der Wissenschaft aufgegriffen werden", sagt Ganser.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Konzept des "Terraformings", also der Erdumformung. Damit bezeichnen Forscher Technologien, die einen Planeten physikalisch und chemisch so verändern, sodass er fruchtbar und bewohnbar für Menschen wird. Im Zentrum der Forschung steht besonders häufig der Mars. Der Begriff tauchte zum ersten Mal in der Kurzgeschichte "Collision Orbit" auf, die der Schriftsteller Jack Williamson im Jahre 1942 in einem Science-Fiction-Magazin veröffentlicht hatte.
Mittlerweile ist Terraforming zu einem ernsthaften Forschungsthema innerhalb der Astrogeophysik und Planetenwissenschaften geworden. Der wohl bekannteste Wissenschaftler in diesem Bereich ist Christopher McKay am Nasa Ames Research Center, der schon vor Jahrzehnten Studien dazu im Fachmagazin Nature veröffentlichte. Er beschäftigte sich unter anderem mit den Atmosphären des Saturn-Mondes Titan und des Mars, forschte an extremen Orten wie dem Death Valley oder den Seen der Antarktis.

Auch irdische Botaniker versuchen, Kartoffeln unter Marsbedingungen anzubauen
"Unter dem Eindruck der Ökologiebewegung entstanden schon in den 70er-Jahren Filme, die Terraforming im weitesten Sinne thematisieren, zum Beispiel Soylent Green oder Silent Running", so Ganser. Der Marsianer von Ridley Scott ist eines der neuesten Beispiele: Mark Watney versucht, Kartoffeln auf dem Mars anzubauen - und das funktioniert auch, denn er ist Botaniker. Tatsächlich versuchen derzeit auch irdische Pflanzenkundler Kartoffeln unter Marsbedingungen anzubauen. Forscher des International Potato Centers in der peruanischen Hauptstadt Lima haben gemeinsam mit der Nasa ein Minilabor entwickelt, in dem sie Temperaturen, Druck, Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre des Roten Planeten imitieren. Der Boden stammt aus der peruanischen La-Joya-Wüste.
Ein weiteres gutes Beispiel für die Symbiose von Wissenschaft und Science-Fiction ist die Astrobiologie, die sich mit möglichem Leben im Weltraum jenseits der Erde beschäftigt. "Im Grunde hat nur der Einfluss von Science-Fiction dazu geführt, dass im 20. Jahrhundert sehr viele Forschungsgelder in die Suche nach außerirdischem Leben gesteckt wurden", schreibt Mark Brake in seinem Buch "The Science of Science Fiction".

Womöglich suchen deshalb seit den 1960er-Jahren immer wieder SETI-Forschungsprojekte (Search for Extraterrestrial Intelligence) das All nach Signalen fremder Intelligenzen ab. "Bis heute haben wir ja keinen wissenschaftlich haltbaren Hinweis darauf, dass Zivilisationen außerhalb der Erde existieren, die ähnliche Nachrichtentechnologien nutzen. Hier führt also pure Imagination zu wissenschaftlicher Forschung", schreibt Brake, der Professor für Wissenschaftskommunikation an der britischen Universität von Glamorgan war.
Das Genre Science-Fiction verändert sich außerdem: Es wird immer ernsthafter und wissenschaftlicher. "Der Anspruch Hollywoods ist es heute, harte Science-Fiction zu machen, die möglichst auf Fakten beruht, die also ernst genommen wird. Die Science-Fiction ist seriös geworden", sagt Alexandra Ganser. Zum Beispiel veröffentlichen mittlerweile sogar sehr respektable wissenschaftliche Verlage Reiseführer für Weltalltouristen.
Auch entsteht gerade ein ganz neues populärwissenschaftliches Genre: Das Magazin National Geographic etwa hat die Serie "Mars" produziert. Sie ist aufgebaut wie eine Qualitätsserie, wie sie etwa der Fernsehprogrammanbieter HBO produziert: Es geht um ein fiktives Astronautenteam, das im Jahr 2033 zum Mars aufbricht. Zugleich aber wird die Handlung immer wieder unterbrochen durch Sprünge ins Jetzt, mit Kommentarsequenzen etwa von Tesla-Chef Elon Musk. "Fiktion und Wissenschaft gehen hier Hand in Hand", kommentiert Ganser.
Doch genau darin liegt aus ihrer Sicht auch eine Gefahr: "Es vermischen sich Fiktionalität und Projektionen in die Zukunft mit der Realität. Es wird impliziert, dass es eine natürliche Entwicklung zum Leben auf dem Mars gibt, dass es im Wesen der Menschheit liegt, zu expandieren." Darin sieht die Amerikanistin die Fortführung einer amerikanischen Eroberungsrhetorik. "Es wird mit diesen Filmen und Serien vermittelt, dass die Menschheit auf der Erde nicht überleben kann und eine Expansion ins Weltall unvermeidlich ist, der logische nächste Schritt.
Dabei ist das wiederum wirklich reine Fiktion." Viel sinnvoller sei es, den Pioniergeist dafür aufzubringen, die Erde nicht zu zerstören, als die Vorstellung zu verbreiten, es sei leicht machbar, das Universum nachhaltig zu gestalten. Ganser hat einen Verdacht: "Die hohen Kosten für die Raumfahrt müssen legitimiert werden. Dafür ist die Traumfabrik Hollywood natürlich der richtige Ort - um Menschen glauben zu machen, diese Forschung sei für uns überlebenswichtig." Es lohne sich also für die Nasa, Geld in Hollywood zu investieren, denn sei die Stimmung im Land passend, bekämen auch Wissenschaftler eher ihre Forschungsprojekte finanziert. "Es ist in den USA außerdem deutlich, dass viele Wissenschaftler in der Raumfahrt diesen Ideen relativ unhinterfragt anhängen."
Es gibt sogar einen neuen, feststehenden Begriff für diese Vorstellungen der Kolonialisierung des Universums: "Astrofuturismus" bezeichnet eine Utopie, die der Menschheit ein neues Leben auf anderen Planeten im All nicht nur voraussagt, sondern als unvermeidlich darstellt. Die Dystopie auf der Erde ist darin gesetzt. Ein Beispiel dafür ist das Buch "How we'll live on Mars" von Stephen Petranek, das voraussagt, wie Menschen im Jahr 2027 auf dem Mars leben werden. Das Buch ist in den USA sehr erfolgreich, Petranek tourte damit durch zahlreiche Talkshows.
"Sogenannte Pro-Space-Aktivisten veröffentlichen ihre Ideen fleißig und bieten eben guten Stoff für Geschichten", sagt Ganser. "Aktuell sind Apokalypsen und Dystopien sehr en vogue. Dabei brauchen wir positive Erzählungen über die Zukunft, die mehrere Möglichkeiten offenlassen - damit wir uns nicht reale Handlungsmöglichkeiten verbauen."
Tatsächlich sind auch Wissenschaftler nur Menschen - und viele von ihnen waren als Kinder begeisterte Science-Fiction-Fans. Der amerikanische Raketenforscher Robert Goddard interessierte sich für das Weltall, weil er als Kind "Krieg der Welten" von Herbert George Wells gelesen hatte. Wells gilt heute neben Autoren wie George Orwell, Stanislaw Lem oder Aldous Huxley als einer der Urväter der modernen Science-Fiction-Literatur. Goddard hatte später als erfolgreicher Raketenforscher Wells einen Brief geschrieben, in dem er ihm für die Inspiration dankte.
Auch der deutsche Forscher Jürgen Schmidhuber, ein Pionier der sogenannten neuronalen Netze, die zentral für die künstliche Intelligenz sind, war schon als Kind ein Science-Fiction-Liebhaber. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Direktor bei der Idsia, einem Schweizer Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz. Er nennt als Lieblingsromane seiner Kindheit Daniel F. Galouyes "Simulacron-3". Der Roman beschrieb schon 1964 das Hochladen eines menschlichen Verstandes in eine Computersimulation. "Visionär war außerdem William Gibsons "Neuromancer"-Trilogie aus den 80ern, die von einer superklugen KI erzählt, die im Cyberspace Menschen manipuliert. Die Bücher gab es, bevor es das www gab", sagt Schmidhuber. Er kennt unglaublich viel Science-Fiction, ist aber ein äußerst kritischer Konsument: "99 Prozent der Science-Fiction ist Schrott. Aber 0,1 Prozent sind Perlen. Die mag ich."
Als Kind las Schmidhuber viel. "Was mir an den Büchern meistens sehr unrealistisch erschien, war die Menschenzentriertheit. Denn wahrhaft kluge KI interessiert sich wohl kaum für Menschen, sondern vor allem für andere wahrhaft kluge KI. Damals schon schien mir: Ich muss radikaler denken als diese immer noch eher zögerliche Science-Fiction." Dieser Impuls mündete darin, dass der 15-jährige Schmidhuber die Idee verfolgte, eine sich selbst verbessernde künstliche Intelligenz zu bauen, die klüger ist als er selbst. Was daraus wurde, ist bekannt: Einige Jahrzehnte später nutzt Google seine sogenannten Deep-Learning-Netzwerke für die Mustererkennung. Wohl deshalb hat New York Times geschrieben: "Wenn künstliche Intelligenz einmal heranwächst, dann wird sie Jürgen Schmidhuber Papa rufen."
Es könnte wichtig sein, welche Filme jene Menschen sehen, die unsere Zukunft gestalten
Selbstverständlich sind Informatiker nicht unbedingt überlegene Ratgeber in Sachen Unterhaltung und Kunst. Aber es könnte möglicherweise doch eine Rolle spielen, welche Bücher und welche Filme diejenigen gut finden, die gerade die Zukunft der Menschheit gestalten.
Wenn unsere Gesellschaft darüber nachdenken soll, wohin all die technologischen Entwicklungen führen werden, dann ist es von Vorteil, einen Blick in die Zukunft zu wagen und Science-Fiction ernst zu nehmen - egal ob es um künstliche Intelligenz, Robotik, Gentechnik oder die Folgen des Klimawandels geht.
Der Buchautor Mark Brake sieht sogar grundsätzliche Parallelen zwischen Science-Fiction und Wissenschaft: "Science-Fiction ist ein erfinderisches Werkzeug um hypothetische Welten theoretisch zu untersuchen. Auch Wissenschaftler bauen Modelle hypothetischer Welten und testen dann ihre Theorien", schreibt er in seinem Buch "The Science of Science Fiction". Zum Beispiel sei Einstein berühmt gewesen für seine Gedankenexperimente, die zu seiner Relativitätstheorie geführt hatten. "Der Unterschied ist, dass ein Science-Fiction-Schriftsteller hypothetische Welten erkundet, ohne an Grenzen gebunden zu sein. Wissenschaftler bewegen sich innerhalb gesteckter Grenzen."
Aber vielleicht ist der gemeinsame Hintergrund beider Disziplinen viel einfacher. Es ist die eine Frage, die Menschen bewegt: Was wäre, wenn?