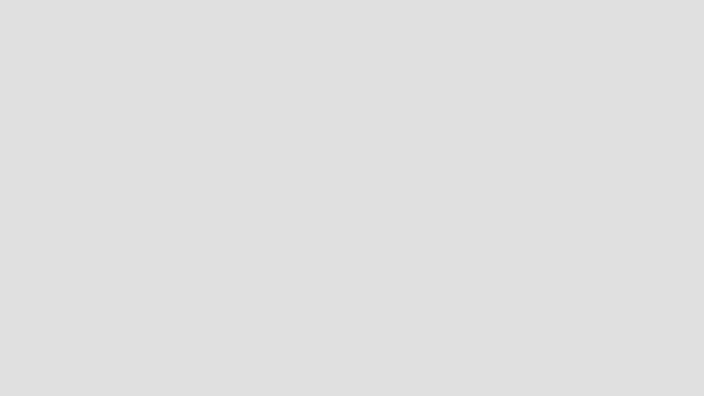Die Frage ist einfach und plausibel: Wenn Wissenschaftler mit Steuermitteln forschen und neue Erkenntnisse gewinnen, sollten diese Ergebnisse dann nicht öffentlich zugänglich sein? Open Access - freier Zugang zu Forschungsergebnissen - heißt das Thema, das seit etwa 15 Jahren immer wieder diskutiert wird. Bislang erscheinen laut einem Papier der Max-Planck-Gesellschaft nur etwa 13 Prozent aller Fachaufsätze in Zeitschriften, die im Internet frei zugänglich sind. Den Rest vermarkten Fachjournale, deren Abonnement zum Teil grotesk teuer ist. So entsteht die fragwürdige Situation, dass für die bereits mit öffentlichen Mitteln bezahlte Forschung ein zweites Mal bezahlt werden muss, dann nämlich, wenn Universitätsbibliotheken und Institute die Fachjournale einkaufen.
Nun ist ein Datum in der Welt, zu dem sich alles ändern soll: Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit der EU beschloss Ende Mai den Übergang zu Open Access bis zum Jahr 2020. Alle wissenschaftlichen Publikationen aus öffentlich finanzierter Forschung müssten dann "ohne finanzielle und juristische Barrieren" zugänglich sein. Und zwar "unverzüglich". Auf diese starken Worte folgen allerdings schwammige Formulierungen: Es könnten "verschiedene Modelle" des Open Access genutzt werden; Sperrfristen solle es nicht geben, "oder so kurze Sperrfristen wie möglich".
Open Access ist ein dehnbarer Begriff. So können die Verlage Forschern das Recht einräumen, ihre Aufsätze nach einer Sperrfrist auf eigene Faust, etwa auf einem Dokumentenserver, zu veröffentlichen. Insider nennen dies den "Grünen Weg". Schon die vage Forderung des Wettbewerbsrats nach möglichst kurzen Fristen ruft nun den Widerspruch der Wissenschaftsverlage hervor: Die Sperrfristen müssten lang genug sein, um das Geschäftsmodell der Verlage nicht zu gefährden, mahnt die International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers, deren Mitglieder etwa zwei Drittel aller wissenschaftlichen Artikel veröffentlichen.
Der "Goldene Weg" bedeutet, dass ein Aufsatz sofort nach dessen Erscheinen von der Fachzeitschrift digital und barrierefrei publiziert wird. In diesem Fall bezahlen nicht die Leser dafür, sondern diejenigen, die veröffentlichen, finanziert meist aus Mitteln ihrer Universität oder Forschungseinrichtung.
Ärzte könnten sich jederzeit auf den neuesten Stand bringen. Das käme auch Patienten zugute
Seit vielen Jahren werden Wissenschaftler ermuntert, ihre Ergebnisse über Open-Access-Journale zu publizieren oder zumindest auf dem "Grünen Weg" zugänglich zu machen - nicht zuletzt seitens der Forschungsorganisationen. Der offene Zugang als erstrebenswertes Verfahren setze idealerweise die aktive Mitwirkung eines jeden Urhebers wissenschaftlichen Wissens voraus, heißt es etwa in der "Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen", die 2003 veröffentlicht wurde. Doch Appelle allein bewegen wenig, stellt Kai Geschuhn von der Max Planck Digital Library fest. Allzu stark habe die Open-Access-Bewegung darauf gesetzt, eine Verhaltensänderung bei den wissenschaftlichen Autoren zu erreichen.
Wissenschaftler aber haben andere Dinge im Auge, vor allem die Reputation des Journals, das dem eigenen Ansehen förderlich sein sollte - für Forscher am Anfang ihrer Karriere unverzichtbar. Geschuhn hält daher wenig von moralischen Appellen. Sie sagt: "Open Access muss schlichtweg zum Standard-Geschäftsmodell für wissenschaftliche Literatur werden, finanziell und administrativ ermöglicht durch die Wissenschaftseinrichtungen und Bibliotheken." Das gesamte wissenschaftliche Publikationswesen umzukrempeln, fordern auch die bislang 50 Unterzeichner der im März gestarteten internationalen Initiative OA2020 - darunter alle großen deutschen Wissenschaftsorganisationen sowie die Hochschulrektorenkonferenz. Sie alle wollen weg von Abogebühren, hin zu einem Bezahlmodell für die Veröffentlichung.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Forscherkollegen in aller Welt hätten Zugriff auf den gesamten Schatz des Wissens, nicht nur auf jene Zeitschriften, die ihr Institut abonniert hat; Ärzte könnten ihre Kenntnisse jederzeit auf den neuesten Stand bringen, und wer als interessierter Zeitungsleser Näheres erfahren möchte über ein Thema aus dem Ressort Wissen, kann selbst in die Fachwelt vordringen.
Ist die große Freiheit bezahlbar?
Gerd Antes, Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums in Freiburg, betont: "Wenn der freie Zugang zu medizinischen Forschungsergebnissen nicht gewährleistet ist, schadet das der Wissenschaft und den Patienten." Wichtig sei allerdings eine Qualitätskontrolle: "Wenn die Verlage für jeden publizierten Fachaufsatz Geld einnehmen, schafft das Anreize, auch weniger gute Arbeiten zu veröffentlichen." Problematisch findet er, die Finanzierung auf der Ebene einzelner Forschungsinstitutionen umzustellen. Kleine Einrichtungen blieben da leicht auf der Strecke.
"Früher hieß es: 'Wer arm ist, kann nicht lesen'. Künftig könnte es heißen: 'Wer arm ist, kann nicht schreiben.'" Die Brüsseler Forderung nach Open Access, sei "gut und schön, aber sie sagt leider nichts dazu, wie das umgesetzt werden soll". In Deutschland könnten die zuständigen Bundesministerien gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz, den großen Verlagen, etwa dem Branchenriesen Elsevier, ausreichende Verhandlungsmacht entgegensetzen und akzeptable Modelle aushandeln, die allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Land ermöglichen, in Open-Access-Journalen zu publizieren und das veröffentlichte Wissen zu nutzen, fordert Antes. "Doch Wissenschaft und Politik haben das bislang verschlafen."
Zwei große Verlage haben in der vergangenen Woche nicht auf Fragen zum aktuellen EU-Beschluss reagiert. Als "wichtigen Meilenstein" bezeichnet ihn Georg Botz, Koordinator des Open-Access-Themas bei der Max-Planck-Gesellschaft. "Jetzt wird es aber darauf ankommen, wie diese Ziele in den einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Leider liegt die umfassende Open-Access-Strategie für Deutschland, die vor zwei Jahren als Teil der 'Digitalen Agenda' der Bundesregierung angekündigt wurde, immer noch nicht vor. Eine aktivere Rolle der Politik - wie in den Niederlanden - würde den Forschungseinrichtungen in Verhandlungen mit den Verlagen den Rücken stärken."
Wenn Forschungsergebnisse frei verfügbar sind, lassen sich neue Zusammenhänge erkennen
Es geht dabei um weit mehr, als um die Möglichkeit, Fachaufsätze kostenfrei zu lesen. Martin Hofmann-Apitius, Leiter der Abteilung Bioinformatik am Fraunhofer Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen in Sankt Augustin, betont den Mehrwert, der entsteht, wenn Wissenschaftler Massen von Publikationen mit automatisierten Verfahren durchsuchen und darin verborgene Zusammenhänge zutage fördern. "Wir haben Methoden entwickelt, kausale und korrelative Zusammenhänge in Publikationen zu finden." Mit solchen Verfahren wurden Millionen von Abstracts in der Datenbank Medline ausgewertet. Daraus entstand beispielsweise ein Modell der Alzheimer Erkrankung, das nun frei zur Verfügung steht und mit Messungen, zum Beispiel aus klinischen Studien verglichen werden kann.
Ein Positionspapier der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen betont: "Die digital arbeitende Wissenschaft ist darauf angewiesen, dass Publikationen rechtlich und technisch nachnutzbar sind. Verfahren wie Text- und Data-Mining können nur angewendet werden, wenn Forschenden entsprechende Nutzungsrechte an den Publikationen eingeräumt werden." Es sei daher wichtig, dass Open-Access-Publikationen unter Nutzung liberaler Lizenzmodelle erscheinen. "Alle Welt schreit 'Digitalisierung!'. Doch jetzt, wo die technischen Möglichkeiten da sind, verhindern politische und juristische Blockaden, dass sie für die Forschung und die medizinische Versorgung nutzbar gemacht werden", bedauert Gerd Antes.
Doch ist die große Freiheit bezahlbar? Es geht um viel Geld: Weltweit geben Bibliotheken jährlich etwa 7,6 Milliarden Euro für Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften aus. Publiziert werden pro Jahr etwa 1,5 bis zwei Millionen Fachaufsätze. Damit, so rechnet die Max Planck Digital Library vor, werden pro Aufsatz etwa 3800 bis 5000 Euro im System des wissenschaftlichen Publikationswesens umgesetzt. Das ist deutlich mehr, als die rund 1300 Euro, die Open-Access-Journale durchschnittlich für die Veröffentlichung eines Artikels verlangen.
In Deutschland geben Bibliotheken weit mehr als 200 Millionen Euro für Fachzeitschriften aus. Im Jahr 2014 wurden rund 70 000 wissenschaftliche Artikel mit einem deutschen Hauptautor veröffentlicht. Selbst bei einem Artikelpreis von 2000 Euro (soviel zahlt die DFG maximal) lägen die Gesamtausgaben somit bei 140 Millionen Euro. Das neue System käme also billiger. Vorausgesetzt, die Gebühren für die Publikation ersetzen die Kosten für Abonnements und fallen nicht zusätzlich an.
Aus der Perspektive eines Fachjournals kann das anders aussehen. "Ein so aufwendig produziertes Magazin wie Nature kann mit Bearbeitungsgebühren, wie sie derzeit gezahlt werden, nicht als 'goldenes' Open- Access-Journal existieren", sagt Nature-Chefredakteur Philip Campbell. "Wir beschäftigen einen Stab von Redakteuren, die nicht nur jene Artikel bearbeiten, die gedruckt werden - etwa acht Prozent der eingereichten Manuskripte - sondern auch die, die nie erscheinen." Gleichwohl unterstütze die Verlagsgruppe Springer Nature die Open-Access-Idee.
Campbell verweist auf Nature Communications, ein Tochter-Journal, das erfolgreich nach dem "Goldenen Weg" publiziert wird. Um seine kritische Auswahl aufrechtzuerhalten, müsste Nature aber noch weit mehr verlangen als die stolzen 5200 Pfund pro Artikel, die eine Veröffentlichung bei Nature Communications kostet, erklärt Campbell. "Das ist derzeit nicht realistisch." Doch sei viel im Fluss auf dem Zeitschriftenmarkt. Campbell glaubt, dass eines Tages die vollständige Umstellung aller Fachjournale auf den "Goldenen Weg" gelingt. "Doch da lässt sich kein Termin von oben herab aus Brüssel anordnen." Ein Grund mehr für den Brexit? "Auf keinen Fall", wehrt Campbell ab, er sei unbedingt für den Verbleib in der EU.
Und da der Wettbewerbsrat nicht angekündigt hat, seinen Beschluss mit irgendwelchen Maßnahmen durchzusetzen, dürfte die Deadline 2020 vorerst kein Grund zur Sorge sein, für Verlage in Großbritannien oder anderswo.