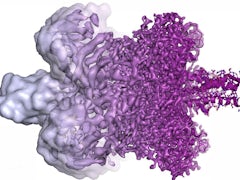Einmal noch wird ein Komitee an diesem Montag vor die Öffentlichkeit treten, dann ist der diesjährige Nobelpreis-Reigen vorbei. Und wieder stellt sich die Frage, welche Botschaften die höchste wissenschaftliche Auszeichnung bereithält, angesichts dessen, was in der Welt geschieht. Man kann an Theresa May denken, die auf dem Parteitag der Tories vergangene Woche viel hustete, aber auch ausführlich über die Größe der britischen Wissenschaft sinnierte. Sie hob die Physik-Nobelpreisträger von 2010 hervor, Andre Geim und Konstantin Novoselov von der University of Manchester. Was May verschwieg: Die gebürtigen Russen kamen auf breiten Wegen nach England - quer durch eine offene europäische Forschungslandschaft, von der sich die Briten mit dem Brexit nun abwenden.
Wie die zwei Nobelpreisträger befürchten nun viele Wissenschaftler im Königreich, dass ihre Kooperationen zertrümmert werden und ihre Forschungsgelder verloren gehen. Nationalismus baut Mauern, aber Nationalismus ist nicht die einzige Gefahr für die Hochleistungs-Wissenschaft.
Auch in Deutschland weiß man, was wissenschaftlicher Größe im Weg steht: Als der in Berlin geborene Amerikaner Rainer Weiss am vergangenen Dienstag eine Hälfte des Physik-Nobelpreises zugesprochen bekam, wurde umgehend seine "Deutschstämmigkeit" betont. Wie bedrückend ist so ein Wort angesichts der Tatsache, dass der Vater von Weiss Jude war. Verfolgt von deutschen Nationalsozialisten flüchtete die Familie 1938 in die USA. Auch der diesjährige Chemienobelpreisträger Joachim Frank, in Deutschland geboren und aufgewachsen, hat einen amerikanischen Pass. Im Gegensatz zu Weiss ging er freiwillig nach Amerika - weil er den liberalen Geist der Forschung dort schätzte.

Er hat den Grundstein für die Jahrhundertentdeckung der Gravitationswellen gelegt: Zusammen mit zwei US-Forschern gewinnt der Physiker Rainer Weiss den Nobelpreis.
Forschung kann nur in offenen Gesellschaften funktionieren
Freilich muss niemand sehnsüchtig in die USA schauen, denn das Land der Einwanderer und der wissenschaftlichen Neugier ist wie Großbritannien gerade dabei, sein größtes Pfund zu verspielen: die Offenheit für Menschen aus aller Welt, unabhängig von Nationalität, Religion und Hautfarbe. Es ist die Abwesenheit von Mauern, die nicht zuletzt die Forschung in den USA groß gemacht hat. Das hat ein renommierter Neurobiologe nach Donald Trumps Einreisebann veranschaulicht. Auf Fotos zeigt er erst die gesamte Forscherriege seines Labors. Dann verschwinden nach und nach all jene, die keine Green Card, keinen US-Pass oder keine amerikanische Geburtsurkunde haben. Am Ende bleiben von gut 70 Menschen zwölf übrig, deren Eltern in den USA geboren wurden.
Der Nobelpreis würdigt keine Nationalitäten. Die Auszeichnung ist ein Lob der Internationalität. Man kann trotzdem fragen, ob sie in jeder Hinsicht zeitgemäß ist. Vor allem in den Lebenswissenschaften wirken die Errungenschaften der Laureaten oft veraltet und realitätsfern. Und das, obwohl Alfred Nobel den Preis für Forscher vorsah, die "im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Dienst erwiesen haben". In Physik, Medizin und Chemie werden zudem fast nur alte Männer ausgezeichnet. Auch 2017 ist kein Preisträger jünger als 65 Jahre. Unter ihnen findet sich keine einzige Frau. Von 599 Laureaten in den Naturwissenschaften waren überhaupt nur 18 weiblich. Das liegt nicht daran, dass es keine Kandidatinnen gäbe.
Der Nobelpreis versäumt es, Zeichen zu setzen. Aber eine Wahrheit spiegelt er eben doch: Wissenschaft ist multikulturell und frei. Abschottung und Nationalismus schaden der Forschung in einem Land. Nur die Offenheit für Menschen aller Herkunft ermöglicht die geistige Freiheit, die sie braucht - und die auch die Gesellschaft benötigt. Denn ohne Forschung gibt es keine Innovation und ohne Innovation keine Zukunft für bald zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten.