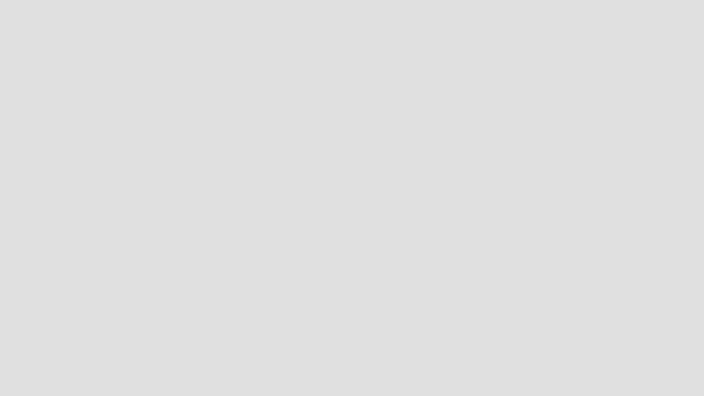Norilsk war einst eine Metropole. In Zentralsibirien weit über dem Polarkreis gelegen, bot sie 300 000 Menschen in einer unwirtlichen und kargen Landschaft ein Zuhause. Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. "Die Stadt ist von 300 000 auf 176 000 Einwohner geschrumpft, und dennoch herrscht massive Wohnungsnot", sagt Nikolai Shiklomanov von der George Washington University in der US-Hauptstadt, der die sibirische Stadt besucht hat. Der Grund ist auf seinen Fotos klar zu erkennen: Norilsk verfällt, seine Häuser sinken ins Erdreich. Ganze Wohnblocks, die auf Stelzen im ewig gefrorenen Boden standen, reißen auf oder bröckeln dahin, weil der Permafrost taut.
Der gefrorene Boden ist seit Jahrzehnten eine gewaltige Herausforderung für Ingenieure, die darauf Häuser, Straßen, Gleise, Brücken oder Pipelines verankern wollen. Er ist in der Arktis allgegenwärtig; wer darauf nicht bauen kann, vermag das Gebiet kaum zu nutzen. Schon wegen der reichhaltigen Rohstoffvorräte aber wollen die Länder am Polarkreis die Region nicht den indigenen Völker überlassen, die hier mit ihren Rentierherden leben oder auf die Jagd gehen. Russland erzielt in Sibirien bei der Förderung von Öl und Gas einen großen Anteil seiner Wirtschaftsleistung.
Doch Infrastruktur erzeugt Wärme im gefrorenen Boden, schon beim Bau und erst recht im Betrieb. Sie verändert die Zyklen von steigenden und sinkenden Temperaturen und vergrößert die "aktive Schicht", die im Wechsel der Jahreszeiten auftaut und gefriert. Selbst wo Ingenieure den Effekt nach allen Regeln ihrer Kunst minimieren, verschärft der Klimawandel ständig die Anforderungen. Schon heute zeigt sich deutlich, was dem hohen Norden bevorsteht.
Manche Straßen in Alaska haben nach all den Ausbesserungen eine meterdicke Asphaltschicht
In der ganzen Polarregion entstehen zum Beispiel ständig neue Thermokarst-Seen: einbrechende Oberflächen, unter denen Eisschichten schmelzen. In Alaska kennt man inzwischen auch "betrunkene Wälder", wo sich Bäume zum Beispiel im Denali-Nationalpark zur Seite neigen, weil der aufgeweichte Boden den Wurzeln weniger Halt bietet. Manche Straßen in der Nähe von Fairbanks haben inzwischen eine drei Meter dicke Asphaltdecke, weil jährlich neue Schichten aufgelegt wurden, um die Fahrbahn gerade zu halten.
Vielleicht müssen sogar ganze Dörfer verlegt werden. 31 Gemeinden von Ureinwohnern seien in Gefahr, hatte der US-Rechnungshof schon 2009 festgestellt. Doch nur im Ort Newtok am Ningliq-Fluss im Yukon-Delta, wo 350 Menschen leben, gibt es konkrete Pläne für einen Umzug. Sie kommen allerdings kaum voran, auch weil die Kosten auf 130 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) geschätzt werden. Die Bewohner der Insel Shishmaref, weiter nördlich in der gleichen Region gelegen, haben jetzt den gleichen Beschluss gefasst: Sie wollen auf das Festland umsiedeln.
Kanada sieht ebenfalls große Ausgaben vor sich. 250 bis 420 Millionen kanadische Dollar (170 bis 290 Millionen Euro) könnten hier nötig sein, um Gebäude in den Northwest Territories zu stabilisieren, berichtete 2011 der kanadische Rundfunk CBC. Auch viele Straßen in den Norden wie die berühmten Yukon und Dempster Highways sind gefährdet. Ein besonderes Risiko stellen die früheren Minen dar. Mehr als 10 000 Bergwerke seien ausgebeutet und verlassen, stellte die Umweltgruppe Mining Watch fest. Oft beruht die Stabilität der Dämme, die dort den nach dem Bergbau übrig bleibenden Schlamm zurückhalten, auf permanent gefrorenen Böden.
In Russland vermag die in den 1940er-Jahren gebaute Eisenbahn vom westsibirischen Workuta auf die Jamal-Halbinsel nur noch 30 Prozent der einst geplanten Güter zu befördern, so sehr sind die Gleise inzwischen verbogen, sagt Ivan Sokolov vom internationalen Vermessungs-Unternehmen Fugro: "Meist kann man auf der Strecke nur noch 40 Kilometer pro Stunde fahren - manchmal auch nur vier."
Eine neue Vorschrift in Kanada soll Bauherren zwingen, den Klimawandel einzuplanen
Stark betroffen ist auch die Energiewirtschaft. Die russische Ölindustrie müsse 1,2 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben, um Permafrostschäden an ihren Pipelines zu reparieren, berechnete Greenpeace bereits im Jahr 2009. Ohnehin laufe in Sibirien bereits ein Prozent des geförderten Öls durch Lecks aus, nehmen Umweltschützer an: Das wären fünf Millionen Tonnen pro Jahr, mehr als das Fünffache der Deepwater-Horizon-Freisetzung. Geringer wird diese Menge sicher nicht, wenn der Boden unter den Rohren auftaut. Zudem hat Russland auch Kernkraftwerke an der Küste des Polarmeers. Besonders die vier Reaktoren in Bilibino weit im Nordosten machen Beobachtern Sorgen. Sie stehen in einer Permafrost-Hochrisiko-Gegend, und die Sicherheitstechnik ist aus den frühen 1970er-Jahren.
Auf all das reagiert Kanada inzwischen mit verschärften Bauvorschriften, sagt Lukas Arenson, der nach einem Ingenieur-Studium an der ETH Zürich in Kanada arbeitet. Er ist in seiner Wahlheimat am Entwurf einer neuen Baunorm beteiligt. Sie verlangt, bei der Planung von Strukturen auf Permafrost die zu erwartenden Veränderungen durch den Klimawandel zu berücksichtigen. "Das muss in der Praxis als Bemessungswert angewandt werden, so wie dies zum Beispiel für Hochwasser getan wird", sagt er. "Dann sind Bauherren gezwungen, sich darauf einzustellen."
Der Permafrost auf dem tibetischen Hochplateau könnte komplett verschwinden
Kanada gehört zu den "großen vier", die besonders mit der Instabilität des Permafrosts zu kämpfen haben, weil auf sie der Löwenanteil der 20 Millionen Quadratkilometer ständig gefrorenen Bodens entfällt. Mit zum Club gehört neben Russland und den USA noch China. Dieses grenzt zwar nicht an die Arktis, will aber seine Kontrolle über Tibet mit Hochspannungsleitungen, einer Eisenbahn und Straßen über das von Permafrost durchzogene Hochplateau festigen. Bei allen Projekten müssen die Ingenieure schon seit Jahren auch an den Klimawandel denken.
Der Permafrost auf dem tibetischen Hochplateau könnte bei einer ungebremsten Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts beinahe komplett verschwinden, zeigen Modellrechnungen. Die chinesischen Ingenieure treiben darum großen Aufwand, ihre Bauwerke zu schützen. Sie nutzten zum Beispiel für die gut 1200 Hochspannungsmasten auf Permafrost vier verschiedene Typen von Betonfundamenten, die entweder besonders tief in den Boden versenkt wurden oder sich am unteren Ende tellerförmig verbreiterten. Dennoch lief manches unerwartet, erzählt Qihao Yu von der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Etwa ein Viertel der Betonträger habe sich in vier Jahren Betrieb bewegt.
Viele Fundamente werden gezielt gekühlt: Die Ingenieure haben bis zu vier sogenannte Thermosiphons pro Pfeiler eingesetzt. Dabei handelt es sich um verkapselte Metallrohre, die oben aus dem Bauwerk ins Freie ragen. Sie sind mit einem Kältemittel wie Kohlendioxid gefüllt, das unter hohem Druck verflüssigt wurde. Ist im Winter der Boden wärmer als die Luft, verdunstet das Mittel unten im Rohr. Das Gas steigt auf; oben angekommen kondensiert es wieder und tropft zurück. Die Wärme wird dabei aus Fundament oder Untergrund gezogen und an die Luft abgegeben. Im Sommer hingegen stellt sich im Rohr ein stabiler Zustand ein; es leitet dann keine Wärme ins Erdreich. "Mit solchen Thermosiphons kann man den Boden regelrecht kühlen und zum Beispiel auch Erddämme einfrieren", sagt Lukas Arenson.
Der Boden unter den Gleisen muss mit metertiefen Konstruktionen gekühlt werden
Mit Thermosiphons kühlt auch die Firma von Torsten Mayrberger die Pfeiler einer neuen Brücke in Alaska. 430 Meter misst sie, nach Darstellung des deutschstämmigen Ingenieurs von der Firma PND Engineers ist sie die längste der nordamerikanischen Arktis. Sie überspannt den Nigliq Channel, einen Seitenarm des ins Polarmeer fließenden Colville River, damit der Ölkonzern Conoco-Philips Produktionsanlagen im Gebiet westlich davon ganzjährig erreichen kann. Die sieben Pfeilergruppen der Brücke wurden in einem einzigen Winter im Tal versenkt. Manche stecken in gefrorenem Boden, andere dort, wo der Fluss sein Bett schon lange aufgetaut hat. Der Untergrund besteht aus Schichten von Sand, Kies, Schlamm und Lehm; eine Pfeilergruppe durchstößt eine unterirdische Soleblase. Auf jede Besonderheit mussten die Planer Rücksicht nehmen.
Solchen Aufwand können Ingenieure bei den vielen Hundert Kilometer langen Pisten und - vor allem in Asien - Gleisen der Arktis nicht treiben. Sie behelfen sich mit metertiefen Unterkonstruktionen aus zerstoßenem Fels, durch deren Poren Luft zur Kühlung unter der Fahrbahn hindurch strömen kann. Quer eingezogene Rohre können die Zirkulation noch verbessern. Senkrecht stehende Schornsteine lassen angestaute Wärme entweichen. Über kritischen Stellen der Böschung bringen die Planer Blenden an, die Schatten spenden; helle Beimischungen im Straßenbelag oder weißer Kies im Gleisbett verringern die Absorption von Sonnenlicht. Geflochtene Matten aus Kunstfasergewebe im Straßendamm leiten Feuchtigkeit ab und verhindern ein Verrutschen des Baumaterials. Dennoch passiert es immer wieder, dass sich gerade unter den Böschungen der Straßen die aktive Schicht deutlich vergrößert, die im Frühsommer auftaut. Die übliche Folge sind Längsrisse und Senkungen am Rand der Fahrbahn.
Manche der Probleme lassen sich nur mit internationaler Hilfe lösen, darum tauschen sich die Ingenieure auf Kongressen aus. Für die Wohnungsprobleme in der russischen Arktis-Metropole Norilsk gibt es womöglich eine Lösung mit kanadischer Technik. Wie Nikolai Shiklomanov berichtet, wurde dort vor Kurzem zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein neues Wohnhaus gebaut. Statt der früher üblichen Gebäude aus schweren Fertigbauelementen errichteten die Arbeiter auf einem der alten Fundamente eine leichte Stahlrahmenkonstruktion. Sie hat auch nicht fünf bis neun Stockwerke wie die alten Häuser, sondern nur drei. Mehr kann der tauende Permafrost nicht tragen.