Es ist das Jahr 2027. Demonstranten ziehen vor den Sitz der Firma Sarif Industries in Detroit. Die Konfrontation zwischen den Protestierenden und Sicherheitskräften eskaliert, die Unruhen werden gewaltsam beendet. Ziel der Proteste sind Unternehmen und Wissenschaftler, die "Gott spielen", indem sie die Menschen mit künstlichen Körperteilen (Augmentierungen) versehen: Synthetische Gliedmaßen und Sinnesorgane, die mehr leisten als die natürliche Form ( Fiktives Werbe-Video oben).
In einem ( ebenfalls fiktiven) Video schneidet eine Aktivistengruppe Werbebilder der Augmentierungs-Industrie mit Aufnahmen gegen, die die negativen Folgen der Technologie zeigen: Wer sich die Verbesserungen nicht leisten kann, ist im Nachteil. Und die teuren Medikamente, die sie verträglich machen, machen abhängig. Wer sie sich nicht mehr leisten kann, dessen Leib stößt sie ab. Eine neue Generation verstümmelter Obdachloser entsteht. Und über die Hirnchips können Menschen manipuliert werden.
Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert
Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.
Es ist ein Science-Fiction-Szenario - der Hintergrund des Videospiels " Deus Ex: Human Revolution". Doch auch wenn die Problematik vermutlich stark übertrieben dargestellt wird - zu gesellschaftlichen Konflikten über den Einsatz solcher Technologien könnte es in Zukunft tatsächlich kommen. Denn synthetische Mittel, die die Lernfähigkeit, das Gedächtnis, Wachheit oder Aufmerksamkeit erhöhen, sind bereits im Einsatz. Und auch künstliche Gliedmaßen sowie Computerchips fürs Hirn existieren bereits.
Schon lange diskutieren Wissenschaftler und Philosophen über ethische und gesellschaftliche Aspekte des sogenannten Neuro-Enhancements (Hirn-Dopings) sowie Augmentierungen, die Leistungen erlauben, die über das "normale" Maß hinaus gehen. Seit es Kriege gibt, experimentieren Armeen mit Drogen, um ihre Soldaten effizienter zu machen.
Hirndoping findet schon statt - ein wenig
Spätestens seit 2005 ist die Diskussion um "Smart Pills" in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Damals berichteten Wissenschaftler um Sean Esteban McCabe von der University of Michigan in Ann Arbor, dass fast sieben Prozent der Studierenden an US-Universitäten bereits verschreibungspflichtige Medikamente missbraucht hatten, um intensiver lernen zu können, in Prüfungen besser abzuschneiden oder ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen. In späteren Studien kamen US-Forscher auf einen Anteil von bis zu 25 Prozent. Und auch Professoren gaben den Konsum solcher Mittel zu.

Um belastbarer im Job zu sein, greifen immer mehr Deutsche zu verschreibungspflichtigen Medikamenten. Eine Studie der Krankenkasse DAK zeigt außerdem: Dabei geht es nicht um gehetzte Manager.
Der Unterschied zwischen solchen Medikamenten und illegalen Drogen, die ebenfalls aufputschen können: Arzneien können vom Arzt verschrieben werden und haben keinen so negativen Ruf. Schließlich wird zum Beispiel Ritalin auch aufmerksamkeitsgestörten Kindern verabreicht. Andere verwendete Mittel sind etwa Modafinil (Provigil) für Narkoleptiker, Antidepressiva oder das Alzheimermedikament Donepezil.
Der Einsatz von Neuro-Enhancern - "Verstärker" oder "Verbesserer" kognitiver Leistungen - stellt die Menschen vor eine ganze Reihe von Fragen: Einerseits sollte der Einzelne für sich entscheiden dürfen, sich auch mit neuen Hilfsmitteln zu "optimieren". Auf der anderen Seite befürchten Kritiker, dass "Smart Pills" und andere Technologien zur "Verbesserung" des Menschen sich negativ auf die Chancengleichheit und die Verteilungsgerechtigkeit auswirken werden.
Aber ist das nicht völlig übertrieben? Der Anteil der Menschen, die bislang schon einmal Hirndoping betrieben haben, ist noch immer klein. In Deutschland etwa deuten entsprechende Studien darauf hin, dass bis zu fünf Prozent der Studierenden und auch einige ihrer Professoren gelegentlich auf verschreibungspflichtige Mittel zurückgreifen. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts ergab 2011, dass 1,5 Prozent der Bevölkerung schon verschreibungspflichtige Mittel als Neuro-Enhancer zweckentfremdet hat - vor allem Erwerbstätige mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von mehr als 40 Stunden.
Bei Arbeitnehmern und Managern ist der Anteil der DAK zufolge von 4,7 Prozent im Jahr 2008 auf 6,7 Prozent (2014) gestiegen. Die Dunkelziffer könnte bei bis zu zwölf Prozent liegen. Das sind keine dramatischen Zahlen, aber immerhin: Knapp drei Millionen Deutsche haben demnach schon einmal ihr Gehirn gedopt. Etwa 1,9 Prozent der Berufstätigen, also rund eine Million, greifen sogar regelmäßig zu Medikamenten. Sie haben Angst vor Prüfungen, Präsentationen oder wichtigen Gesprächen, die Sorge, nicht die erwarteten Leistungen zu erbringen oder hoffen, die Mittel würden das Lernen erleichtern.
Ist ihr Verhalten verwerflich oder fragwürdig? 2008 forderte eine Gruppe von sieben US-Wissenschaftlern um den Juristen Henry Greely von der Stanford University im Magazin Nature, dass es Erwachsenen möglich sein sollte, Neuro-Enhancer "verantwortungsvoll" einzusetzen.
Ein Jahr später behaupteten sieben deutsche Experten um Thorsten Galert vom Bonner Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften in einem Memorandum, es gebe keine überzeugenden grundsätzlichen Einwände gegen eine pharmazeutische Verbesserung des Gehirns oder der Psyche. Vielmehr sei hier die Fortsetzung eines zum Menschen gehörenden geistigen Optimierungsstrebens mit neuen Mitteln zu sehen. Dazu verwenden Menschen schließlich schon lange eine Reihe von Drogen oder Nahrungsmitteln - von Coca-Blättern, Betel oder Khat bis hin zu Kaffee, Schokolade oder Ginkgo-Präparaten.
Drei Millionen Deutsche haben laut einer Studie ihrer Leistung im Job mit Medikamenten nachgeholfen. Im Interview erklärt Arbeitsmedizinerin Gabriele Freude das Phänomen Neuro-Enhancement und wie sich Stress anders bekämpfen lässt.
Und was spricht gegen Augmentierungen wie flinkere Finger, kräftigere Beine, schärfere Augen oder andere "Verbesserungen" über das normale menschliche Maß hinaus, wie sie sich Transhumanisten wie der schwedische Philosoph Nick Bostrom von der Oxford University vorstellen?
Privilegierte wieder im Vorteil
Etlichen Fachleuten bereitet dieser Gedanke Sorgen. Was ist, wenn sich vor allem die bereits Privilegierten solche Mittel leisten können, fragt etwa der Philosoph Thomas Metzinger von der Universität Mainz. Der Philosoph Nicholas Agar von der Victoria University of Wellington in Neuseeland befürchtet sogar, dass einzelne zwar davon profitieren könnten, die Menschheit insgesamt jedoch einen hohen Preis bezahlen wird. In seinem Buch " Humanity's End" warnt er davor, dass sich zwei Klassen entwickeln werden: Jene, die bereit sind oder sich gedrängt fühlen, Enhancer zu nutzen und jene, die sich weigern - und so zur Unterklasse werden.

Leben wir bald in einer Welt, in der reiche Menschen sich mit Hilfe moderner Medizin unsterblich machen und Maschinen den Großteil der Bevölkerung ohne Job und Aufgabe zurücklassen? Der israelische Universalhistoriker Yuval Harari behauptet das. Ein Gespräch.
Selbst Wissenschaftler, die die Selbstoptimierung für eine Chance halten, warnen. So sagte etwa Christian Elger von der Universität Bonn zu Bild der Wissenschaft: "Die größte Gefahr ist, dass wir in Wissende und Unwissende unterteilt werden - also in Menschen, die diese Systeme nutzen, und in andere, die das nicht können oder wollen. Das könnte die Gesellschaft spalten."
Steigender Leistungsdruck
Auch der zunehmende Leistungsdruck ist ein Problem. Die Anforderungen an alle - angefangen von der Grundschule bis zu Akademikern und Handwerkern - seien in den vergangenen 20 bis 30 Jahren "sehr sehr deutlich gestiegen", stellt etwa Raphael Gaßmann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen im DAK-Report 2015 fest. Und "je höher die Anforderungen sind, desto größer ist die Versuchung, dem zu entsprechen, in dem man eine Pille schluckt". Dazu kommt die Konkurrenz mit anderen. Sobald sich die Hilfsmittel ausbreiten, wird sich Druck aufbauen.
"Was ist, wenn der Verbleib im Job oder in der Schule davon abhängt, ob jemand neurokognitive Verstärkungen anwendet?", fragten Wissenschaftler um die Bioethikerin Martha Farah von der University of Pennsylvania und den Hirnforscher Eric Kandel von der Columbia University im Jahre 2004. Unter solchen Bedingungen droht die Gefahr eines "Wettrüstens".
Auch Stephan Schleim von der Universität im niederländischen Groningen sieht in diesem "Wettrüsten" das größte Problem des Neuro-Enhancements: "Wenn 'dopen' normal wird, ist 'nicht-dopen' keine Wahl mehr. Für die Gesellschaft wäre das eine Katastrophe", sagte Schleim SZ.de.
Probleme für Chirurgen, Piloten und Soldaten
Auf ein weiteres Problem haben unlängst Wissenschaftler um Filippo Santoni de Sio von der niederländischen Delft University of Technology hingewiesen: Manche Menschen, von deren Arbeit die Gesundheit oder das Leben anderer abhängt, werden vor der Frage stehen, ob sie nicht verpflichtet sind, sich auch mit Pillen fit zu machen. Zu solchen Berufsgruppen gehören etwa Chirurgen oder Piloten. Unweigerlich denkt man hier auch an die Katastrophe des Germanwings-Fluges 4U9525.
Ein besonderer Fall ist der Einsatz beim Militär. Bereits 2006 warnte der US-Philosoph und Historiker Jonathan Moreno von der University of Pennsylvania, dass Soldaten normalerweise nicht um ihre Einwilligung gebeten werden, wenn ihre Kommandeure entscheiden, was die beste Vorbereitung auf ein Gefecht ist. Moralisch gesehen sei es schwer zu erkennen, wieso eine Verpflichtung zu Neuro-Enhancements anders betrachtet werden sollte als andere Befehle.

Nun haben auch die Wissenschaftler um Henry Greely 2008 und um Thorsten Galert 2009 bedenkliche Aspekte wie Verteilungsgerechtigkeit und Leistungsdruck bedacht - und Neuro-Enhancer als Chance für die Benachteiligten betrachtet. Die Politik müsste eben für einen fairen und sozioökonomisch verträglichen Einsatz der Mittel sorgen. Außerdem weisen die Befürworter eines liberalen Umgangs mit den Mitteln darauf hin, dass schon jetzt eine große Ungleichheit existiert. So hat der Nachwuchs von wohlhabenden Eltern bekanntlich bessere Chancen auf eine gute Bildung und Ausbildung. Es müssten eben alle Zugang zum Hirndoping haben.
"Natürlich wären Neuro-Enhancer nicht die einzige Quelle von Ungleichheit", sagt Wiebke Rögener von der TU Dortmund anlässlich des Bundeskongresses Politische Bildung zu "Ungleichheiten in der Demokratie" in Duisburg. "Aber möchten wir die Ungerechtigkeit weiter vorantreiben?", fragt die Autorin des 2014 erschienenen Buches " Hyper-Hirn".
Und Leistungssteigerung sei ja nicht prinzipiell etwas Gutes, sagt Stephan Schleim. Wieso wäre sonst eine Beschränkung der Arbeitszeit eingeführt worden? Außerdem erhöhe eine Leistungssteigerung möglicherweise die eigenen Erwartungen und die der Gesellschaft - so dass die Pillen immer häufiger eingeworfen würden.
"Außerdem halte ich zum Beispiel die Vorstellung, Benachteiligte könnten entsprechende Subventionen bekommen, für eine Illusion", sagt Rögener SZ.de. "Es wird angesichts der älter werdenden Bevölkerung doch schon in Frage gestellt, wie sich das bestehende Gesundheitssystem weiter finanzieren lässt." Manche Länder hätten außerdem schon Probleme, die Gesundheitsversorgung überhaupt aufrecht zu erhalten. Sollte Hirndoping tatsächlich einmal funktionieren, würden innerhalb der Länder die Armen und international die armen Länder von reichen Staaten abgehängt.
Doch wie weit ist die Wissenschaft überhaupt? Die Wirkung der Arzneimittel als Dopingmittel ist hoch umstritten. So hat eine kleine Studie des US-Militärs zwar gezeigt, dass Hubschrauberpiloten nach 40 Stunden ohne Schlaf durch Modafinil und Ritalin fitter und entscheidungsfähiger waren als mit einem Scheinmedikament. Die Studienlage zu diesen und anderen "Hirndoping"-Mitteln ist jedoch nicht eindeutig. Helge Torgersen vom Wiener Institut für Technikfolgenabschätzung ist deshalb jüngst zu dem Fazit gekommen: Keines der derzeit verwendeten Mittel ist ein sicherer und verlässlicher Neuro-Enhancer.
Genauso sieht es eine Reihe von Fachleuten, die die DAK für den Gesundheitsbericht 2015 befragt hat. Und auch Stephan Schleim stellt fest: "Der praktische Nutzen dieser Substanzen ist fraglich, vom subjektiven Aufputsch- und Motivationsaspekt abgesehen".

Dafür müssen die Konsumenten mit teils heftigen Nebenwirkungen rechnen: Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Verdauungs- und Leberstörungen, Krampfanfälle, bei Antidepressiva wird sogar vor suizidalen Gedanken gewarnt. Zu denken gibt auch der Fall von zwei US-Piloten, die unter dem Einfluss von Amphetaminen ("Go-Pillen" mit Dexedrin gegen Müdigkeit) 2004 in Afghanistan kanadische Soldaten bombardiert und vier von ihnen getötet haben.
Es gibt also gute Gründe, dass Psychopharmaka nur zur Behandlung bestimmter Krankheiten eingesetzt werden sollten. Und angebliche Neuro-Enhancer wie etwa Nootrobox, truBrain, Nootrobrain oder Nootroo, sogenannte Nootropika, die als "Nahrungsergänzungsmittel" angeboten werden, haben ihre Wirkung noch nicht unter Beweis gestellt.
Ein kommerzielles Interesse an "Smart Pills" ist sicher da. Selbst die EU-Kommission hält das Thema Neuro-Enhancement für so relevant, dass sie das Projekt " Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation" (Nerri) finanziert. Forscher von 18 Universitäten und Institutionen aus elf Ländern beschäftigen sich in dessen Rahmen mit den Folgen und Möglichkeiten der Technologie. Die Pharmaindustrie allerdings hält sich derzeit etwas zurück mit der Forschung an neuen Mitteln, die wie Ritalin, Modafinil oder Antidepressiva auf die Hirnchemie zielen. "Große Unternehmen haben seit 2010 ihre psychopharmakologischen Labors geschlossen", sagt Stephan Schleim. "Der erwartete Nutzen ist zu gering, die Entwicklungs- und Zulassungskosten zu hoch."
Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) bestätigt, dass die Zahl von Antidepressiva oder Neuroleptika in der klinischen Erprobung abgenommen hat - auch wenn immer noch geforscht werde. Viele Unternehmen setzten auf neue Wirkprinzipien oder auf die Umwidmung von Wirkstoff-Klassen. In Richtung Neuro-Enhancer geht diese Forschung aber nicht. Denn: Ein möglicher Nutzen für Gesunde, so Hömke, lasse sich nicht absehen - und würde auch nicht untersucht.
Und der Versuch, existierende, aber verschreibungspflichtige Medikamente als "off-label"-Produkte für einen Einsatz zu vermarkten, für den sie nicht zugelassen sind, kann die Unternehmen teuer zu stehen kommen. Das hatte etwa das US-Unternehmen Cephalon mit Modafinil (Provigil) getan - und musste deshalb 2008 eine Strafe von 425 Millionen Dollar zahlen.
Mittel gegen die Demenz als Gedächtnispillen?
Intensiv geforscht wird allerdings an Medikamenten, die gegen Demenzen wie Alzheimer helfen sollen. Hoffen die Unternehmen, dass wenigstens dabei Gedächtnispillen - sogenannte Memory Booster - herauskommen könnten, die sich an Gesunde verkaufen ließen? Wiebke Rögener weist darauf hin, dass es für solche Pillen "einen Riesenmarkt" gebe. Das belegt etwa das Alzheimer-Mittel Donepezil, das nur einen geringen Nutzen hat, sehr teuer ist, und trotzdem verschrieben wird. Das Medikament gehört ebenfalls zu den Neuro-Enhancern, die manche Gesunde verwenden.
Rolf Hömke hat allerdings von einer entsprechenden Hoffnung bei den Pharmaunternehmen noch nichts gehört und hält es auch für unwahrscheinlich, dass sie berechtigt wäre. Denn "Alzheimermedikamente versuchen in Krankheitsprozesse einzugreifen, die im gesunden Hirn gar nicht auftreten."
Es gibt außerdem andere Möglichkeiten, das Hirn anzuregen, für die sich einige Unternehmen, vor allem aber das Militär interessieren, sagt Rögener: Methoden wie die "transkranielle Stimulation".
Dabei wirken Magnetfelder oder schwache Stromstöße mit Gleichstrom auf verschiedene Hirnregionen. Damit lässt sich offenbar Müdigkeit unterdrücken und die Aufmerksamkeit erhöhen. Forscher um Friedhelm Hummel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnten zeigen, dass ältere Menschen unter transkranieller Gleichstromstimulation leichter Fingerübungen erlernten - junge Menschen dagegen nicht.
Das Militär prüft zum Beispiel, ob die Technologie die Wahrnehmungsfähigkeit der Soldaten unter simulierten Gefechtsbedingungen in einem virtuellen Nahost-Szenario erhöht. In Form von Headsets sind "Denkkappen", die so arbeiten, bereits auf dem Markt. Allerdings ist die Technologie umstritten. Niemand wisse, so Torgersen, wann und warum sie manchmal funktioniere.

Berhard Sehm und Patrick Ragert vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig warnen insbesondere vor dem Einsatz bei Soldaten und Sicherheitskräften, die unter der "Stimulierung" andere Menschen gefährden könnten. Außerdem kann die Technik offenbar auch das moralische Verhalten der Träger beeinflussen. So hielten Versuchspersonen es eher für akzeptabel, dass Personen vor einer Gefahr nicht gewarnt werden, wenn ganz bestimmte Hirnregionen einem Magnetfeld ausgesetzt waren.
Die Probleme bei der Entwicklung der Neuro-Enhancer hängen unter anderem damit zusammen, dass sich das gesunde Gehirn in einem Teilbereich vielleicht optimieren lässt, aber andere Funktionen dadurch beeinträchtigt werden. "Das Naturprinzip der Homöostase (Gleichgewicht) lässt sicher erwarten, dass längerfristiges Neuroenhancement Gegenregulationen induziert", sagt etwa Jürgen Fritze von der Universität Frankfurt am Main im DAK Gesundheitsreport 2015. Mit anderen Worten: Das Gehirn stellt sich auf bestimmte Substanzen ein. Dann aber wird die Wirkung nachlassen und es droht eine Abhängigkeit.
Auch Leon Kass, Moralphilosoph und damals Vorsitzender des Bio-Ethikrates des US-Präsidenten, wies bereits 2004 darauf hin, "der menschliche Körper und Geist, hochkomplex und fein balanciert als Folge einer äonenlangen, graduellen und anspruchsvollen Evolution, wird durch alle schlecht überlegten Versuche der "Verbesserung" gefährdet.
Über Prothesen und Gedächtnis-Chips zum Super-Soldaten
Neben den Methoden, die auf die Hirnchemie und -physik abzielen, gibt es aber noch ein anderes Feld, auf dem die Entwicklung deutlich erkennbar voranschreitet. Der Einsatz von Geräten, die in den Körper implantiert oder über Nerven und das Gehirn gesteuert werden: Cochlea-Implantate lassen Taube schon seit Jahren wieder hören. Manche Blinde können mit Silizium-Chips im Auge, die Reize über den Sehnerv ins Gehirn schicken, wieder genug sehen, um sich räumlich zu orientieren.
Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert
Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.
An Universitäten, Rehabilitationszentren und in Laboren des US-Verteidigungsministeriums arbeiten Wissenschaftler an Roboterarmen und -beinen mit Gedankensteuerung. Inzwischen gelingt es Wissenschaftlern wie Thomas Stieglitz von der Universität Freiburg sogar, Amputierten über eine Prothese sensorischen Input zurückzuschicken. Die Patienten lernen also, mit einem künstlichen Glied etwas zu "fühlen".
Gelähmte senden bereits über Brain-Computer-Interfaces E-Mails. Blinde bekommen über Elektroden im Auge Informationen von einer Kamera - und können hell und dunkel wieder unterscheiden. Forscher fliegen mit ihren Gedanken Flugzeuge im Simulator, lassen über Hirnstrommessungen (EEG) den Schwanz einer Ratte zucken oder nutzten die Hand eines anderen Menschen, um auf eine Taste zu tippen. Ein junger Mann ohne Kontrolle über seine Beine steuert ein Exo-Skelett mit seinem Gehirn und eröffnet mit einem Tritt gegen einen Ball die WM 2014. Selbst zwei Gehirne wurden auf eine Weise miteinander verbunden, dass sich ihre Besitzer über große Distanz einfache Signale zusenden konnten.

Der Hirnforscher Christian Elger von der Universität Bonn erwartet, dass die Menschen in einigen Jahrzehnten auch Computerprogramme mit ihren Gedanken bedienen werden, indem sie ganz bestimmte Hirnregionen aktivieren. "Ich werde dann Kraft meiner Gedanken zum Beispiel mein Haus aufschließen können", sagte Elger kürzlich dem Magazin Bild der Wissenschaft.
Wer Hugh Herr begegnet, bekommt schon jetzt einen Eindruck von dem, was die Zukunft bringen wird - und muss unweigerlich an die Augmentierungen aus "Deus Ex" denken. Der Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology hat 1982 bei einem Unfall in den Bergen beide Beine unterhalb der Oberschenkel verloren. Mit seinen "bionischen" Prothesen geht er nicht nur, er rennt und steigt sogar wieder auf Berge. Die künstlichen Unterschenkel eines Oscar Pistorius sind nichts dagegen.
Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert
Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.
Für verschiedene Bedingungen hat Herr unterschiedliche Prothesen entwickelt. So besitzt er Fußprothesen mit Spikes, um damit Gletscherwände zu bewältigen. Gegenwärtig zielt solche Technologie vor allem darauf, Behinderten, Kranken und Alten zu helfen. Herr glaubt, dass die Menschheit in 50 Jahren physische oder seelische Gebrechen weitgehend eliminiert haben wird.
Aber künstliche Glieder könnten - und sollen - in Zukunft auch stärker sein als natürliche Arme und Beine. Mit sogenannten Exo-Skeletten, aber auch mit Prothesen könnten Menschen übermenschliche Fähigkeiten erhalten. Insbesondere das Militär, das schon jetzt regelmäßig auf Drogen und Arzneimittel zurückgreift, interessiert sich für solche Forschung.
Theodore Berger von der University of Southern California ist davon überzeugt, dass gravierende Fortschritte bevorstehen: Er arbeitet an Gedächtnis-Chips, die US-Soldaten mit Hirnverletzungen helfen sollen. Laborratten haben Berger und sein Team bereits mit einem solchen Gerät Erinnerung daran eingespeist, welcher Hebel im Käfig eine Belohnung verspricht. Er kann sich vorstellen, dass in Zukunft Menschen Erinnerungen auf einem Chip speichern, und sich mit Hilfe des Gerätes dann an Dinge wie die Namen ihrer Enkelkinder erinnern.
Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert
Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.
Mit der wachsenden Lebenserwartung steigt die Zahl von Patienten, die lange Zeit unter Demenz leiden werden und versorgt werden müssen. Die Kosten der Chips, so Berger, würden im Vergleich dazu verblassen. Fernziel solcher Forschung ist aber nicht die Heilung von Patienten, sondern die Optimierung von Leistungen etwa von Soldaten. Vielleicht werden einmal die Nervenbahnen von Soldaten direkt mit den Schaltkreisen ihrer Waffen, Fahrzeuge oder Jets verbunden sein. "Wenn man eine F18 fliegt", so rechtfertigte Berger im Fachmagazin Nature 2003 seine Arbeit, "kann man sich keine Fehler erlauben".
Vielleicht werden Soldaten sich in Zukunft also mit superschnellen, extrem starken Exo-Skeletten oder künstlichen Gliedern fortbewegen. Unterstützt von Gedächtnisimplantaten, die helfen, schnelle Entscheidungen zu fällen oder Manöver zu vollziehen, ohne sie mühselig zu trainieren.
Die Menschheit, so meinen jedenfalls Forscher wie Theodore Berger und Hugh Herr, sei auf dem Weg ins "Zeitalter der Cyborgs". Ähnlich sieht es auch Stefan Greiner von Cyborgs e.V. Greiner gilt als einer der ersten Cyborgs der Welt, da er sich einen Magneten in einen Finger hatte einsetzen lassen. Damit konnte er durch Vibrieren etwa Kabel in der Wand spüren. Der Magnet ist aus praktischen Gründen wieder draußen, doch Greiner und andere experimentieren weiter mit implantierten Magneten und RFID-Chips, um ihre Smartphones zu steuern oder Musik zu hören. Oder, wie der Amerikaner Rich Lee, um eine Art Echolot zu entwickeln, das seine Augen ersetzen soll, wenn er aufgrund einer Krankheit weiter erblinden sollte.
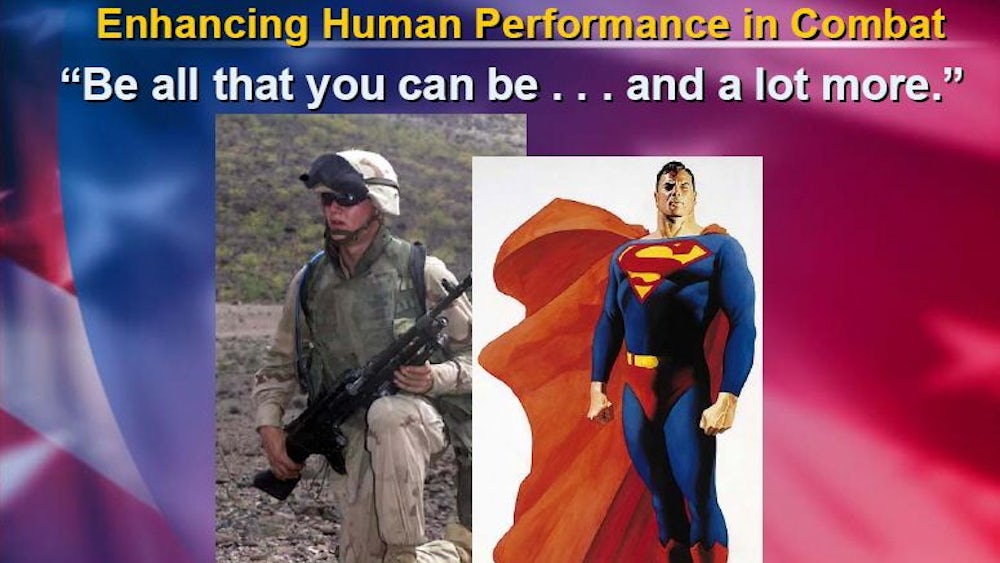
Auch der Philosoph Thomas Metzinger von der Universität Mainz wähnt uns in einer historischen Übergangsphase, die möglicherweise zu einer "naturalistischen Wende im Menschenbild" führen wird: Möglicherweise bewegen wir uns auf ein grundlegend neues Verständnis dessen zu, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Die Technik lässt sich vielleicht auf lange Sicht nicht aufhalten. Aber die Gesellschaft, sagt Rögener, kann durchaus Einfluss darauf nehmen, wohin es geht. "Das beginnt schon damit, in welche Richtung geforscht wird." Schließlich entscheiden Universitäten und andere Forschungseinrichtungen nicht nur selbst über ihre Arbeit. Sie hängen auch von Forschungsgeldern ab. "Aber es scheint kaum jemanden zu interessieren, welche Forschungen etwa das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder EU-Institutionen finanziell fördern und welche nicht."
Solange die Freiheit der Forschung gewährleistet ist, kann eine Regierung in einem gewissen Rahmen regulierend eingreifen. Und ob Studien zu Hirndopingpillen, die eigentlich mit gesunden Menschen stattfinden müssten, von medizinethischen Kommissionen akzeptiert würden, ist fraglich. "Auch bei der Zulassung von Neuro-Enhancern, die ja den Nutzern nicht schaden dürfen, ließen sich Regulierungen einziehen", sagt Rögener.
Oder sollte man auf Nicholas Agar hören, der fordert, zumindest weitgehendes "Enhancement" einfach zu untersagen? Roland Kipke vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) an der Universität Tübingen ist skeptisch. Er geht davon aus, dass es in einer liberalen Gesellschaft nicht zu rechtfertigen wäre, einzelnen den Einsatz von Neuro-Enhancern zu verbieten.

Umso wichtiger ist es ihm, darauf hinzuweisen, dass es zur "mentalen Selbstformung" altbewährte und vielfach erprobte Methoden ohne Nebenwirkungen gibt, um an sich zu arbeiten: Gedächtnis- und Konzentrationstraining, Meditation, Yoga und andere Versuche, sein Verhalten zu verändern. "Das mag mühsam sein und langsam gehen", sagte Kipke SZ.de. "Aber wenn man jahrerlang an sich arbeitet und auf sich achtet, lernt man sich selbst auch besser kennen und verstehen." Und Selbsterkenntnis wird schließlich allgemein geschätzt.
Auf jeden Fall scheint es angesichts der Komplexität und fein ausbalancierten Physiologie unserer Psyche und unseres Körpers sinnvoll, über eine Empfehlung des Moralphilosophen Leon Kass nachzudenken: " Mach langsam, du könntest alles ruinieren." Es gehe, so Kass, nicht nur um negative Nebenwirkungen. Es gehe auch darum, "ob unsere Ziele eigentlich vernünftig sind".
Linktipps: