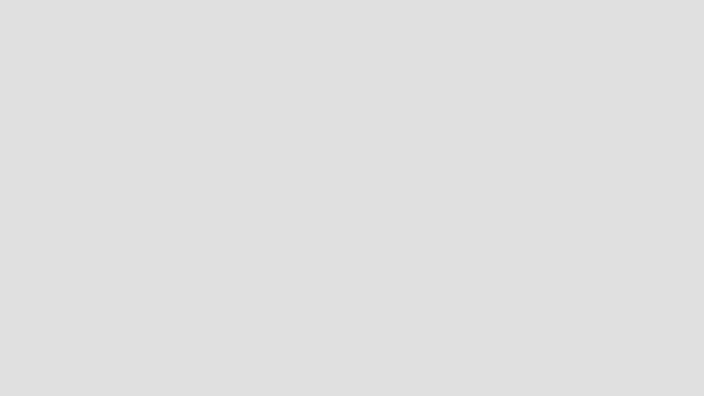Es ist eine der wichtigsten und mächtigsten Branchen der Schweiz: die Pharma-Industrie, die in Basel mit Roche und Novartis zwei der größten Medikamentenhersteller der Welt beherbergt. Doch seit diesem Dienstag stehen die beiden Konzerne unerwartet unter Druck. Die Nichtregierungsorganisation Public Eye, die sich in den vergangenen Jahren mit Recherchen über Rohstoffhändler, Nahrungsmittelproduzenten und Kreditinstitute einige der größten Unternehmen des Landes vorgeknöpft hat, fordert die Basler Pharma-Unternehmen heraus. Die Unternehmen sollen ihre Medikamentenpreise senken und transparent machen, wie sich die Preise für Krebstherapien und andere kostspielige Behandlungen zusammensetzen.
Dabei erhalten die Aktivisten prominente Unterstützung. So sprechen sich der Präsident der schweizerischen Krebsliga, Onkologe Thomas Cerny, und weitere Ärzte für die Petition der Zürcher Nichtregierungsorganisation aus. Ihre Befürchtung: Selbst in der Schweiz, wo das Gesundheitssystem einen hohen Standard hat, könnte eine Zweiklassenmedizin entstehen. Zwischen steigenden Krankenkassenbeiträgen, einer alternden Gesellschaft und Therapien, die zum Teil viele 100 000 Euro kosten, könnte das öffentliche System über kurz oder lang in die Knie gehen. Nicht mehr jeder Versicherte würde die Therapie bekommen, die er braucht.
In Videobotschaften berichten Ärzte, dass sich Kollegen nicht trauen, teure Therapien zu verschreiben. Zudem berichtet die frühere Bundesrätin und Bundespräsidentin Ruth Dreifuss von den Verhandlungen mit der Pharma-Branche: Die Politik habe stets am kürzeren Hebel gesessen, nicht einschätzen können, wie hoch die Entwicklungskosten eines Medikaments tatsächlich waren - und wie viel Druck man somit auf die Preise machen könnte. Es gibt nur Schätzungen, wie teuer die Entwicklung eines Medikamentes ist - und da sind die Kosten für Fehlschläge meist eingerechnet.
"Profite wie im Drogenhandel"
Die Ausgaben für Arzneimittel belasten die Gesundheitssysteme vieler Länder. In Deutschland regelt das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (Amnog) die Preisfindung. Im ersten Jahr nach der Markteinführung können die Hersteller die Preise setzen. Für Arzneimittel mit einem vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgestellten Zusatznutzen, verhandeln die Hersteller einen Preis mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen (GKV). Nur er wird von den Krankenkassen erstattet. Manche Hersteller nehmen ihr Präparat vom Markt, wenn dieser Preis nicht ihren Wünschen entspricht. Der GKV-Spitzenverband sieht das erste Jahr, in dem der Hersteller den Preis festlegen kann, "kritisch", wie es heißt. "Wir haben den Eindruck, dass das erste Jahr strategisch genutzt wird", so eine Sprecherin. Der Verband fordert, dass der ausgehandelte Preis rückwirkend ab dem Markteintritt gilt.
Severin Schwan, Chef der Roche-Gruppe, mag das Wort Monopolpreise nicht. Mit Marktverzerrung habe das nichts zu tun, sagte er vergangene Woche der SZ: "Die Pharmakonzerne geben ihr Wissen der Öffentlichkeit preis, indem sie Patente beantragen." Dies ermögliche anderen Unternehmen, auf entsprechenden Innovationen aufzubauen. Erst das Patent würde den Forschern den Anreiz geben, neue Medikamente zu entwickeln. Dieses System habe sich "für die Menschheit" bewährt.
Ganz anders klingt Public Eye, die sich besonders kritisch mit den Brustkrebsmedikamenten von Roche auseinandersetzt. Hier werden die Profite der Pharma-Unternehmen gar mit denen von Drogenhändlern verglichen. Eine Vertreterin von Ärzte ohne Grenzen glaubt: Jetzt, wo die teuren Medikamentenpreise nicht nur für Patienten in Entwicklungsländern, sondern auch für Kranke in der reichen Schweiz zum Problem würden, könnte sich an der Politik der Schweiz etwas ändern. Genau wie Public Eye fordert sie die Politik auf, wenn nötig zum schärfsten Schwert zu greifen: Der Zwangslizenz, also der Verpflichtung für Pharmafirmen, ihre Produkte sofort, ohne Patentschutz, zur Verfügung zu stellen. Dieses Mittel steht in den Staaten laut einer Regelung der WTO zwar zur Verfügung, wurde aber bisher nur sehr selten eingesetzt - und von der Schweiz international stets bekämpft.