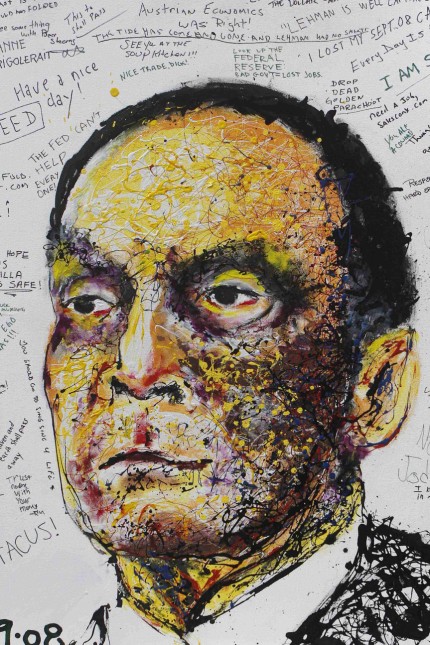Hier der Wirtschaftswissenschaftler, dort die Wirklichkeit - Laien kommt die Ökonomie wie eine Parallelwelt vor, der sie mit Unbehagen begegnen. Dieses Unbehagen wird von vielen Fachleuten und Studenten geteilt: Seit Ausbruch der Finanzkrise hört die Schelte an den Ökonomen nicht mehr auf. Inzwischen kommt die schärfste Kritik aus den Reihen der Wissenschaftler selbst, nicht nur von jungen Rebellen, sondern aus dem Herzen des Establishments von Ökonomen wie Olivier Blanchard, Narayana Kocherlakota und Paul Romer, die sich vor allem an den Modellen stoßen, mit denen viele arbeiten.
Makroökonomen, das sind jene Volkswirte, die für die großen Zusammenhänge in der Wirtschaft zuständig sind. Im Kern ist ihr Fach heute angewandte Mathematik. Mit Modellen schätzen die Forscher zum Beispiel, wie eine Volkswirtschaft reagiert, wenn Politiker an bestimmten Stellschrauben, den Steuern etwa, drehen. Dazu nutzen sie Gleichgewichtsmodelle, die im Englischen unter dem Akronym DSGE bekannt sind ("dynamic stochastic general equilibrium"). Aber moderne Volkswirtschaften sind hoch komplex. Sie ganz genau in Modelle zu übersetzen, ist unmöglich. Also müssen die Makroökonomen die Welt für ihre Gedankengebäude vereinfachen. Die Frage ist nur, wie viel Vereinfachung ist zulässig, bevor sie volkswirtschaftliche Zusammenhänge verfälscht? Hier setzen die Kritiker an. Was ist dran an ihren Anschuldigungen? Die fünf wichtigsten Vorwürfe im Überblick:
Banken und Geld spielen keine Rolle
Banken, so die Klage, würden in makroökonomischen Konzepten häufig ausgeblendet - also genau jene Institutionen, die 2008 die Finanzkrise ausgelöst haben. Zudem gelte die Geldpolitik in einfachen Gleichgewichtsmodellen als neutral, kritisiert der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer in seinem jüngsten Aufsatz ("The Trouble with Macroeconomics"), obwohl doch spätestens seit der Volcker-Rezession klar sein müsste, dass die Notenbanker großen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Der amerikanische Notenbankchef Paul Volcker setzte der hohen Inflation (15 Prozent) Anfang der 80er-Jahre außerordentlich hohe Leitzinsen (zeitweise über 20 Prozent) entgegen und löste so einen Einbruch der Wirtschaft aus.
"Die Pauschalkritik, dass Kredit und Kapitalmärkte keine Rolle spielen, grenzt langsam ans Absurde", sagt Moritz Schularick. Der Volkswirt und Wirtschaftshistoriker hat sich mit empirischen Arbeiten über die Finanzkrise, Kreditbooms und Immobilienmarkt-Blasen einen Namen gemacht. Spätestens seit Ausbruch der Finanzkrise haben Geld, Kredit und Kapitalmärkte, Banken und Währungshüter eine große Bedeutung in der Forschung; auch die Lehrbücher wurden längst überarbeitet und um Kapitel über Börsenexzesse ergänzt. "Man kann nicht behaupten, das würde nicht ernst genommen", sagt der deutsche Wirtschaftstheoretiker Gerhard Illing, der selbst - gemeinsam mit Olivier Blanchard - ein solches Lehrbuch ("Makroökonomie") verfasst hat. "Die Analyse von Finanzmarktturbulenzen ist eines der am stärksten blühenden Forschungsgebiete in der Makroökonomie", beobachtet Illing. In der Praxis stellt sich aber immer die Frage: Wofür verwendet man ein Modell? Wer die Wirtschaftsentwicklung im nächsten Jahr prognostizieren will, kommt mit einer einfachen Version ohne Finanzmärkte zu einer recht zuverlässigen Prognose. Wer herausfinden will, wie man Finanzmärkte besser reguliert, braucht ein komplexes Modell, in dem auch Kapitalmärkte, Kredit und Überschuldung eine Rolle spielen. Den Forschungsbetrieb dominieren mittlerweile Makrosysteme mit Bankensektor.
Die Modelle werden der Realität nicht gerecht
Die Frage ist, ob sich ein so komplexes Gebilde wie zum Beispiel die Weltwirtschaft mit ihren sieben Milliarden Menschen mit einem Modell beschreiben lässt. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. "Ich würde sagen, man sollte es auf jeden Fall versuchen", sagt Schularick. "Aber natürlich muss man, um die Weltwirtschaft zu modellieren, Annahmen treffen, die relativ eng sind und dadurch der Komplexität nicht unbedingt gerecht werden." Es gibt also einen Zielkonflikt zwischen der Eleganz und Geschlossenheit von Gleichgewichtsmodellen und der Vielschichtigkeit und Uneinheitlichkeit der realen Welt.
Und doch: Ein Großteil der Kritik hinkt der Zeit hinter. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt und große Forschungsgebiete innerhalb der Makroökonomie arbeiten heute ganz ohne allgemeine Gleichgewichtsmodelle. Wer zum Beispiel mehr über Ungleichheit erfahren will, kommt mit den alten Ansätzen nicht weiter, in denen es nur einen repräsentativen Agenten gibt, der ewig lebt: Gegenüber wem will der ungleich sein? Oder die Forschung über Finanzmärkte: Gleichgewichtsmodelle unterstellen in der Regel, dass die Preise von Anleihen, Aktien oder Immobilien zuverlässige Signale geben; aus der Verhaltensökonomik weiß man aber, dass Überoptimismus häufig zu Spekulationsblasen führt, zu völlig übertriebenen Preisen also. Das lässt sich mit den alten Modellen nicht abbilden. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Narayana Kocherlakota und der Makroökonom Olivier Blanchard, einst Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, plädieren deshalb dafür, ein breiteres Spektrum an Modellen anzuwenden. Blanchard fordert in einem Papier ("Do DSGE Models Have a Future?"), dass die vorherrschenden Gleichgewichtsmodelle "weniger imperialistisch" werden sollten. Sein Haupteinwand gegen die alten Ansätze: "They are based on unappealing assumptions" - ihre Bausteine stehen auf wackeligem Boden.
Das Menschenbild ist wirklichkeitsfremd
Schon die Erfinder der rationalen Erwartungen, Robert E. Lucas, Edward C. Prescott und Thomas Sargent wussten, dass der Homo oeconomicus mehr einem Spielzeugroboter gleicht denn einem menschlichen Wesen. Und doch waren sie der Überzeugung, dass eine konsistente Modellbildung auch die Annahme rationaler Erwartungen verlangt, sonst würden Analysen beliebig. Blanchard überzeugt das nicht, er rügt, dass die Ökonomen bis heute mit unrealistischen Annahmen arbeiten würden, also nicht nur mit vereinfachenden Annahmen, sondern mit Annahmen, die zu der Realität und allem, was man über das Verhalten von Konsumenten oder Unternehmern weiß, im Widerspruch stehen.
Ein Verbraucher zum Beispiel lebt im Modell ewig, er ist bestens informiert und macht seinen Konsum über die Zeit von der Höhe der Zinsen abhängig. Mit dem tatsächlichen Verhalten der Menschen hat diese Vorstellung vom rational optimierenden Wirtschaftssubjekt nichts zu tun. Das ist auch Ökonomen bewusst. Aus der Verhaltensforschung wissen sie, dass Entscheidungen nicht immer logisch und teilweise sogar widersprüchlich getroffen werden, dass auch Fairness und Gerechtigkeit eine Rolle spielen - und nicht nur der eigene Nutzen. "Diese Fragen in ein makroökonomisches Modell zu integrieren ist extrem schwierig und eine der großen Aufgaben fürs nächste Jahrzehnt", sagt Schularick. "Aber da geht die Reise hin."
Die Krise wurde nicht vorhergesehen
Die Volkswirte hätten die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 nicht kommen sehen, lautet ein populärer Vorwurf. Sie hätten keine Antwort auf die berühmte Frage der Queen: "Why did nobody notice it?" Die Klage ist verständlich, aber nicht ganz fair. "Genauso, wie man den Zeitpunkt eines Erdbebens nie vorhersehen kann, kann man auch nicht vorhersagen, wann in einer Volkswirtschaft eine Krise ausbricht", sagt Illing. Eine treffsichere Prognose sei von Wirtschaftswissenschaftlern noch viel weniger zu erwarten als von Naturwissenschaftlern. Zudem gab es ja eine Reihe von Ökonomen, die angesichts der wachsenden Verschuldung schon frühzeitig vor einer Finanzkrise gewarnt haben. Aber wann genau eine Blase platzt, lässt sich eben schwer voraussehen. Das ist das Dilemma der Mahner. Da Wirtschaft und Börsen trotz wachsender Schulden viele Jahre weiter gut liefen, wurden sie nicht ernst genommen - gewiss ein Fehler.
Aus den Fehlern wurde nichts gelernt
Dieser Kritikpunkt ist nicht haltbar. Mag sein, dass vor zehn Jahren nur das als ordentliche Ökonomie galt, was sich in allgemeine Gleichgewichtsmodelle gießen ließ. Aber heute stimmt das nicht mehr. "Die Krise hat sich als Turbo für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Denkens erwiesen", sagt Illing. Seither gibt es einen starken Trend zu empirischer Forschung, die enorm aufgewertet wurde. Das belegen die vielen Arbeiten zur Staatsschuldenkrise, zur Immobilienblase, zu den Verteilungswirkungen von Inflation in der Euro-Zone und zur Ungleichheit im Allgemeinen: Allesamt empirische Arbeiten, die in den angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. Auch jenseits dieser Themengebiete gilt: Kein Wissenschaftler bekommt heute ein makroökonomisches Papier in einem guten Journal veröffentlicht, in dem er nicht sehr saubere, in der Regel auf Mikro-, also Haushaltsdaten basierende empirische Forschung präsentiert. "Die neue Runde im Ökonomenstreit tut den Wissenschaftlern Unrecht", sagt Schularick. "Es hat längst ein Umdenken stattgefunden." Heute gehe es mehr um ökonomische Ideen, um die Bedeutung einer Fragestellung als um die mathematische Komplexität einer Modelllösung. Auch den Ökonomen ist aufgefallen: Wenn es um die Mathematik geht, sind die Mathematiker noch immer besser als die Wirtschaftswissenschaftler.