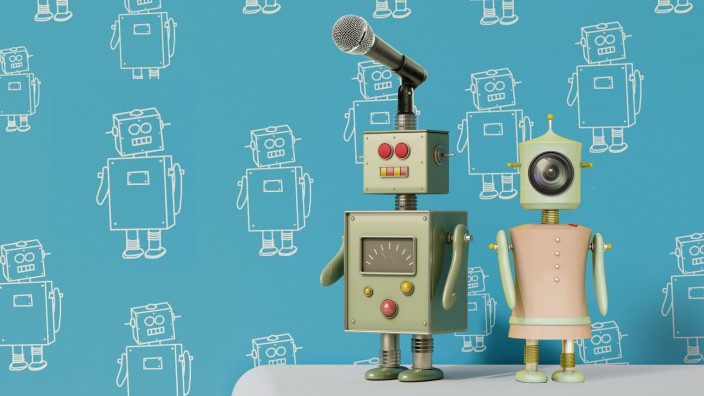Marie hatte es nur gut gemeint mit Sara, doch wie so oft, wenn etwas gut gemeint ist, geht die Sache umso fataler aus. Als Sara drei ist, lässt die besorgte Mutter ihr einen Chip in den Kopf pflanzen. Marie weiß fortan stets, wo das Kind ist, mithilfe eines Tablet-Computers kann sie sogar sehen, was es sieht. Mehr noch: Das Implantat sorgt dafür, dass die Bilder auf Saras Netzhaut verpixelt werden, wenn Mitschüler sich prügeln oder andere unschöne Dinge um sie herum passieren. Erst als die Tochter zum Teenager heranwächst, legt Marie das Gerät zur Seite - nur um es in einem Anfall von Besorgnis gleich wieder hervorzuholen. So ist sie live dabei, als Sara zum ersten Mal mit einem Jungen schläft und Drogen ausprobiert. Als die mittlerweile Fünfzehnjährige davon erfährt, schlägt sie Marie mit dem Tablet den Schädel ein.
Sicher, es ist nur eine Folge der Science-Fiction-Serie "Black Mirror", von der hier die Rede ist. Doch wer sich in dieser Woche auf der weltgrößten Technologiemesse CES in Las Vegas umsah, wer registrierte, welche Chips und Sensoren Groß und Klein nach den Plänen der Tech-Firmen künftig am und im Körper tragen sollen, dem erscheint die TV-Episode plötzlich gar nicht mehr als so futuristisch. Die Branche hat Eltern als ebenso zahlungskräftige wie beeinflussbare Zielgruppe für sich entdeckt - und die Folgen, die das für die Erziehung von Kindern, für deren Selbstbestimmung und Werdegang haben wird, können kaum überschätzt werden.
Mathe-Genie, Supersportler oder chronisch krank?
Da gibt es etwa das amerikanische Start-up Orig3n, das Gentests für Kinder anbietet, darunter das Programm "Child Development". Es soll Aufschluss darüber geben, welche Sportart zum Kind passt, ob es ein Mathe-Genie wird, Lernschwächen drohen oder eine Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten vorliegt. "Sie können das Kind dann in die richtige Richtung führen", sagt der Mann am Stand. Aber was heißt es für die Erziehung, wenn die Tochter später Tennis spielen will, obwohl die Eltern schriftlich haben, dass sie völlig talentfrei ist? Sollen sie das Tennisspielen verbieten und das Kind stattdessen Mathe pauken lassen? "Sie können die Ergebnisse interpretieren, wie immer Sie möchten", sagt der Orig3n-Mann freundlich.
Das gilt auch für den Test "Behavior", der darüber informieren soll, ob das Kind suchtgefährdet ist, zu Panikattacken neigt oder gar ein Aggressionsproblem entwickeln könnte. Doch was, wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Ja lautet? Wer erfährt davon? Nur die Eltern? Der Arzt? Oder können später auch Versicherer oder potenzielle Arbeitgeber auf die Informationen zugreifen? "Wir geben nichts an Dritte ohne Ihre Zustimmung", heißt es auf der Homepage des Unternehmens, die ein Stück weiter unten aber auch verrät, dass die eingesandte DNA nur vernichtet wird, wenn man das ausdrücklich verlangt. Und: "Unsere Zellenbank ist die größte der Welt und repräsentiert 90 Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten."
Viele der Produkte und Programme, die auf der CES präsentiert wurden, werfen somit nicht nur technische, sondern auch ethisch-philosophische Fragen auf. Welche Rechte hat ein Neugeborenes an jenen Daten, die vom ersten Tag seiner irdischen Existenz an erhoben werden? Ab wann wird aus elterlicher Fürsorge systematische Fremdüberwachung? Und haben Kinder das Recht auf eine Privatsphäre?
Um nicht missverstanden zu werden: Moderne Elektronik hat ihren Platz im Kinderzimmer. Es wäre nicht nur weltfremd, sie verbannen zu wollen, sondern auch fahrlässig, sie nicht zu nutzen, um Kindern beim Lernen zu helfen, Krankheiten zu erkennen und Wege zu sparen. Wer einmal zur Grippezeit zwei Stunden lang mit anderen übervorsichtigen Müttern und Vätern im überfüllten, lärmgetränkten Wartezimmer eines Kinderarztes gesessen hat, der kann sich nur wünschen, er hätte zunächst daheim die Gesundheitsapp befragt.
Jedes Detail wird penibel aufgezeichnet
Auch viele der Freizeit- und Lernspiele, die auf der CES präsentiert wurden, haben sehr wohl ihren Sinn. Die Firma Root Robotics etwa hat einen kleinen Zeichen-Roboter entwickelt, dem schon Fünfjährige mithilfe einer einfachen Programmiersprache Dinge beibringen können. "Nicht jedes Kind muss in Zukunft Programmierer werden", sagt Entwickler Raphael Cherney. "Wer aber spielend lernt, wie Codes geschrieben und Roboter gesteuert werden, der versteht zumindest die Grundlagen und verliert die Angst vor der Technik."
Die größte Präsenz auf der Messe hatten neben Lern - und Spielsoftware vor allem Überwachungs- und Gesundheitsprogramme. Dabei nutzen viele Firmen gezielt jenen Gefühlstsunami, der Eltern mit der Geburt eines Kindes überrollt wie die erste große Liebe. Da ist die Zuneigung zu diesem hilflosen Bündel, gepaart mit einer Mischung aus Überforderung und jahrelanger Angst, etwas falsch zu machen. In vielleicht keiner Phase seines Lebens ist ein Mensch so anfällig für Empfehlungen von Ärzten, Lehrern, Gesundheitsanbietern und anderen mutmaßlichen Autoritäten. "Man kann diese Angst von Eltern sehr wohl vermarkten", räumt Jeff Cutler, Vorstandsmitglied des Gesundheitsdienstleisters Tyto Care, in Las Vegas ein, um gleich hinterherzuschieben, dass sein Unternehmen das natürlich nicht tue.
"Die App sagt dir, was dein Kind dir nicht sagen kann"
Genau daran jedoch hat so manch unabhängiger Experte seine Zweifel. "Technologiefirmen wissen genau um den Einfluss von Lehrern und Ärzten und versuchen deshalb, sie mithilfe von Geschenken und anderen Anreizen dazu zu bringen, ihre Produkte zu empfehlen", sagt Douglas Levin, der mit seiner Firma Edtech Strategies unter anderem die US-Schulbehörden bei der Beschaffung von Lernsoftware berät. "Die Lehrer und Ärzte stecken deshalb oft in einem Interessenkonflikt, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß."
Zu den Firmen, die die Technologisierung des Kinderzimmers vorantreiben, gehören die Elektronikriesen Motorola und Philips. Der eine bietet ein komplettes Arsenal an Überwachungskameras für Wiege und Kinderbett an, der andere hat die App uGrow ("Du wächst") entwickelt, mit der Eltern jedes Detail eines Kleinkinderlebens aufzeichnen und teilen können: Stillzeit, Schlafdauer, Schlafposition, Essensmenge, wann die Windel gewechselt wurde und so fort. Verhält sich das Baby ungewöhnlich, steht per Videotelefonat ein Arzt bereit, der alle Daten natürlich längst in seinem Computer hat. "Die App sagt dir, was dein Kind dir nicht sagen kann", verspricht Philips im Werbefilm.
Zu den großen Konzernen kommen unzählige Jungunternehmen wie das US-Start-up Owlet. Firmengründer Kurt Workman hat mit seinen Partnern einen intelligenten Strumpf entwickelt, der vor allem nachts die Herzfrequenz, die Temperatur, die Sauerstoffversorgung und die Schlafqualität des Kindes überwacht. "Wir alle haben Angst um unsere Kinder, und diese neuen Instrumente helfen uns, bessere Entscheidungen zu treffen", sagt Workman, der zur ersten Elterngeneration gehört, die selbst mit Laptop, Internet und Smartphone aufgewachsen ist. Drei von vier der sogenannten Millennials glauben einer Umfrage zufolge, dass sich ein Großteil der Probleme, von denen Mütter und Väter unweigerlich überfallen werden, mit moderner Technik besser lösen lassen.
Geht es ums Kind - oder doch eher um die Daten?
Nur: Wie werden Gesundheitsdienstleister, Anbieter von Lernsoftware oder soziale Netzwerke mit der ungeheuren Datenflut umgehen, die ihnen Kinder frei Haus liefern? Die Vorschriften sind in jedem Land anders, vielfach variieren sie gar von Bundesstaat zu Bundesstaat. Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter helfen nicht weiter: Sie sind oft unpräzise, widersprüchlich und für Laien praktisch nicht zu verstehen. Das Ergebnis ist ein völliger Wildwuchs, bei dem niemand genau weiß, wer was wann speichert, teilt und womöglich verkauft.
Ähnlich steht es um mögliche Sicherheitsprobleme: Endet die Datensammelei etwa, wenn ein Gerät in den Ruhezustand versetzt wird, oder ist es wie einst beim amerikanischen Fahrdienstvermittler Uber, der seine Kunden auch dann noch ortete, wenn diese die App geschlossen hatten? Wer hat Zugriff auf Videos, bei denen Kinder gelegentlich auch nackig durchs Bild hüpfen? Und kann tatsächlich nur der Vater die Nachrichten lesen, die seine Tochter ins Kinder-Handy tippt - oder lesen da noch andere mit?
Schul- und Elternberater Levin hat den Verdacht, dass mancher Anbieter bei der Entwicklung seiner Lern- und Überwachungsprogramme weniger an das Wohlergehen der Kinder denkt als vielmehr an jenen Datenschatz, der da vor ihm liegt und sich womöglich gewinnbringend an die Werbeindustrie verkaufen lässt. "Das Sammeln von Informationen über Kinder", so der Experte, "ist längst nicht immer in deren Interesse." Ein Satz, den Eltern im Gedächtnis behalten sollten.
der jungen Eltern zwischen 18 und 33 Jahren sind davon überzeugt, dass moderne Technik ihnen bei der Erziehung helfen und einen Teil der Sorgen ersparen wird, mit denen sich Mütter und Väter früher herumplagten. "Wir müssen uns bewusst machen, dass es eine Generation Eltern gibt, die keine Kulturpessimisten sind, sondern fest daran glauben, dass Technik das Leben verbessert", sagt Daniel Coates, dessen Analysefirma Ypulse die Daten ermittelt hat. Die Umfrage ergab zudem, dass sich eine fast genauso hohe Zahl von Müttern und Vätern nicht darum kümmert, was ihre Kinder mit technischen Geräten und in sozialen Netzwerken anstellen.