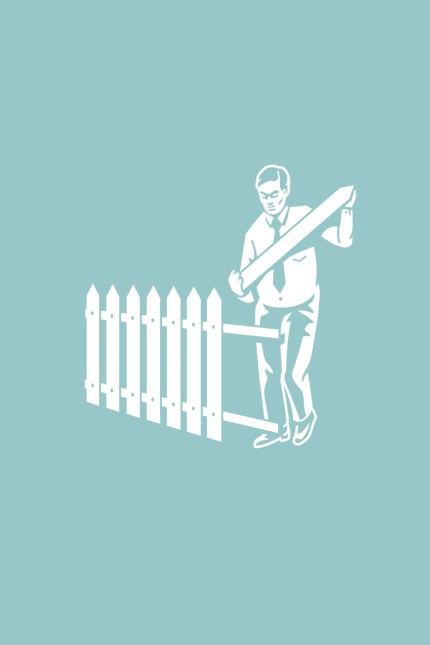Die Börsianer waren diese Woche optimistisch. Sie hofften auf einen Deal im US-chinesischen Handelsstreit, der die Aktienkurse beflügelt. Doch die Verhandlungen brachten nichts außer neue großspurige Ankündigungen von Donald Trump. Abseits der kurzfristigen Kalkulationen der Finanzmärkte sind die Aussichten wenig berauschend. Zwar glauben viele Beobachter, dass sich die weltgrößten Wirtschaftsmächte irgendwie einigen. Die Frage ist, wie lange das halten würde.
US-Präsident Trump will seine Strafzölle nur langsam abbauen. Das muss der Regierung in Peking missfallen. Zudem wird Trump unter Druck geraten, weil er selbst mit einem Deal seine öffentlich verkündeten Ziele verfehlen dürfte: Weder wird das Handelsdefizit mit China klar abnehmen - noch der Diebstahl geistigen Eigentums.
So unklar also die Vorteile von Trumps aggressivem Vorgehen sind, so eindeutig sind schon heute ihre Schäden. Global lähmt Unsicherheit die Unternehmen, bilanziert Robert Azevêdo, Chef der Welthandelsorganisation WTO: "Die ganze Welt verliert." Der globale Warenaustausch wächst dieses Jahr nur um 2,6 Prozent - kaum mehr als halb so viel wie 2017. Exportnationen wie Deutschland werden das besonders spüren.
Bedroht ist noch mehr: Das ganze System offener Wirtschaft, das der Westen auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs aufbaute. Was Donald Trump anrichtet, ist ohne Beispiel: 2018 verhängten er oder Staaten in Reaktion auf ihn Strafzölle auf ausländische Produkte für 500 Milliarden Dollar. So viel zählte die WTO noch nie. Die Bürger des Westens haben sich daran gewöhnt, dass der Freihandel ihnen Wohlstand bringt. Doch in Wahrheit sind offene Grenzen keine Selbstverständlichkeit, sondern historische Ausnahme. Im Mittelalter beherrschten Zollschranken jede Stadt. Zwischen 19. Jahrhundert und Zweitem Weltkrieg bremste eine Wirtschaftsmacht wie die USA ausländische Firmen mit Zöllen, die zwischen zehn und 60 Prozent hin und her sprangen. "Wir dürfen nicht wieder in diese Fieberkurven rutschen", warnt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Donald Trump macht diesen Rückfall in eine nationalistischere, ärmere Zeit erschreckend möglich.
Die Amerikaner müssen sehr verzweifelt sein, wenn sie einen Wüterich auf dem offenen Wirtschaftsmodell herumtrampeln lassen, dass sie selbst nach 1945 weltweit verankerten. In der Tat wirken die USA wie ein verunsicherter Riese, der Rivalen an sich vorbeiziehen sieht. Trump geht es nicht nur um das Handelsdefizit mit China und Europa, sondern um die technologische Führung im 21. Jahrhundert.
Wer in die Vergangenheit blickt, entdeckt bemerkenswerte Parallelen. Sie legen nahe, dass Trump mit seiner Einschüchterungstaktik baden geht. Es gibt bessere Instrumente, um seine wirtschaftliche Stellung zu halten. Und das ist keine Frage, die nur die USA angeht. Ob Amerika auf einen vernünftigen Weg einschwenkt, hat Bedeutung für die ganze Welt. Auf dem Spiel steht der gesamte Wohlstand durch die Globalisierung - und dazu Werte wie die Demokratie.
Amerika vs. China erinnert an die Rivalität von britischem Empire und Deutschem Reich im 19. Jahrhundert, urteilt der Wirtschaftshistoriker Harold James. Man mag es angesichts der Selbstverzwergung im Brexit-Drama kaum glauben, aber ja: So wie heute die USA war damals Großbritannien der wirtschaftliche Platzhirsch. Deutschland begann mit der Industrialisierung erst viele Jahrzehnte nach den Briten. So wie China erst die Demütigung der Opiumkriege, die japanische Besatzung und die kommunistischen Experimente unter Mao durchlitt, bis es zur Wirtschaftsmacht wurde.
Zum Aufstieg setzten beide Newcomer auf ähnliche Instrumente, schreiben James, Markus Brunnermeier und Rush Doshi in der Zeitschrift Washington Quarterly. Während das Deutsche Reich die britische Dominanz der Meere durch die Berlin-Bagdad-Bahn kontern wollte, attackiert China die maritime US-Überlegenheit ebenfalls auf dem Landweg: Durch das Projekt einer neuen Seidenstraße bis nach Europa. Industriespionage war den Deutschen ebenso wenig fremd wie heute China, dem bis zu 80 Prozent des Diebstahls geistigen Eigentums in Amerika vorgeworfen wird. Industrielle wie Alfred Krupp und Eberhard Hoesch tarnten sich damals als Adelige, um englische Stahlwerke und Eisenhütten auszukundschaften. Wobei Hoesch einmal nur knapp den Polizisten entkam, die ein britischer Werkschef benachrichtigt hatte.
Ähnlichkeiten existieren auch bei der Rolle des Staates. Großbritannien hielt sich unter Queen Viktoria, die bis 1901 sagenhafte 64 Jahre amtierte, weitgehend aus der Wirtschaft heraus. Das Deutsche Reich unter Kanzler Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm II. dagegen setzte - wie heute China - auf Industriepolitik. Das theoretische Fundament dafür lieferte der Nationalökonom Friedrich List: "Jede verantwortungsvolle Regierung sollte das Wachstum seiner wirtschaftlichen Kräfte anregen" - eine klare Absage an die britische marktliberale Schule à la Adam Smith, wie der Autor James Fallows im Magazin The Atlantic herausarbeitet.
Konkret bedeutete das: Das Deutsche Reich förderte massiv Exporte, Fusionen - und Technologie. Die Briten hatten ein Monopol bei Telegrafie, dem Kommunikationsweg dieser Zeit. Das versuchten die Deutschen durch AEG/Siemens zu knacken, wozu gehörte, zeitweise britische Technik auszusperren, um die eigenen Firmen groß werden zu lassen. Ganz ähnlich sperren die Chinesen heute US-Monopole wie Google und Facebook aus, wodurch heimische Alternativen wie Baidu und WeChat aufblühten. Zunächst abgeschottet von Konkurrenz, werden Chinas Firmen beim mobilen Bezahlen stark - und bedrohen weltweit die Führung der US-Konzerne Visa und Mastercard. Wie heute die Amerikaner China spürten damals die Briten den heißen Atem des Rivalen im Nacken.
Die spannende Frage ist, was Amerika aus der historischen Parallele lernen könnte. Die Antwort ist: Kooperation - statt Krawall. Um zu verhindern, dass die Chinesen bei Technologien die Spitze erringen, sollten sich die Amerikaner lieber nicht am Empire der Queen orientieren, sondern am Deutschen Reich. Das investierte so stark in Forschung, dass die Deutschen bald doppelt so viele Nobelpreise abräumten wie die Briten. Die USA dagegen vernachlässigt heute die Unis. Um zu verhindern, dass die Chinesen die technologischen Standards der Zukunft setzen, sollten die Amerikaner internationale Kooperationen suchen. So wie einst das Deutsche Reich, das damit das britische Telegrafiemonopol angriff. Für die USA hieße das heute: Handelsabkommen wie TPP und TTIP.
Donald Trump aber greift lieber zum Protektionismus - wie einst das Empire. Um deutsche Produkte bei britischen Konsumenten als Ramsch zu diskreditieren, schrieben die Briten die Kennzeichnung "Made in Germany" vor. Das wurde durch Marken wie Faber-Castell, Aspirin, Steiff oder Märklin bald zum Qualitätssiegel. Die deutsche Wirtschaftsleistung hatte bei Reichsgründung 1871 nur zwei Drittel der britischen erreicht. 1908 überholte das Reich das Empire.
Die Briten lernten daraus nichts. Das führt zur zweiten Parallele zu Trumps Strafzöllen, die ebenso auf der Hand liegt wie Harold James' Exkursion ins 19. Jahrhundert: Das Empire erhob wie andere Staaten hohe Strafzölle, als die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre begann. Dieser Protektionismus beendete endgültig die erste Phase der Globalisierung, die begonnen hatte, das national geprägte Denken zu überwinden. Nun kehrte der Nationalismus zurück. In manchen Ländern nur ökonomisch. In Hitler-Deutschland auch politisch, mit Massengräueln, die das 20. Jahrhundert für immer prägten.
Auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt: Ähnlichkeiten lassen sich auch hier ausmachen. So wie in den 1930er Jahren die Wirtschaftskrise das Denken in Nationen verstärkte, ging Trumps "America first" der ökonomische Absturz der Finanzkrise voraus. Und damals wie heute finden die Advokaten des wirtschaftlichen Protektionismus schon deshalb Gehör, weil viele Menschen das Tempo des Wandels verunsichert. Der männliche Trump-Anhänger fürchtet, dass ein chinesischer Ingenieur schneller Karriere macht - oder eine amerikanische Kollegin. Im Europa der 1920er Jahre wichen die strikten Normen der Monarchien einem liberaleren Stadtleben mit rasanten Straßenbahnen und rauchenden Frauen, was manches (vor allem männliches) Selbstverständnis erschütterte.
Es waren maßgeblich die USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Lehren aus dem Nationalismus zogen. Politisch durch die Etablierung der Demokratie in Deutschland. Ökonomisch durch ein Kooperationssystem mit Freihandel, Regeln und Institutionen wie der WTO. Ein wirtschaftlicher Rivale soll kein Feind mehr sein.
Hinter diese Standards fällt Donald Trump zurück, wenn er die Chinesen als Feinde bezeichnet: "Genau das sind sie". Die historische Lehre ist eine ganz andere. Die Industriestaaten profitieren am meisten, wenn sie kooperieren, statt sich zu bekämpfen. Von diesem System haben auch die USA in den Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg stark profitiert.
Aber was ist damit, dass sich China heute offensichtlich nicht an manche Regeln hält, die zum marktwirtschaftlichen System gehören? Dass es ausländische Firmen behindert und geistiges Eigentum verletzt? Das ist ohne Zweifel ein Fall für die internationale Gemeinschaft. Zu lange haben es die USA und Europa versäumt, Druck auf China auszuüben, sich an die Regeln zu halten. Das sollten sie nun entschieden tun - gemeinsam. Was die Technologie betrifft, geht es auch darum, Überwachung durch ein undemokratisches Regime zu verhindern.
Wer China auf Regeln verpflichtet, kann das aber glaubwürdig nur tun, wenn er sich selber daran hält. Genau das bleibt Donald Trump mit seinen beispiellosen Strafzöllen schuldig. Die Geschichte zeigt: Mit solchem Protektionismus scheiterte damals auch das britische Empire.