Wenn es ums Essen geht, halten die Italiener Omas Traditionen und die Weisheit eines deutschen Denkers hoch. "Der Mensch ist, was er isst", philosophierte Ludwig Feuerbach Mitte des 19. Jahrhunderts und verbaute sich mit der schockierend materialistischen Denkweise seine Universitätskarriere. Heute spornt Feuerbachs Gastrosophie Maurizio Martina an. Der italienische Landwirtschaftsminister setzte durch, dass auf den Etiketten von Milch-, Nudel-, Reistüten und Tomatendosen das Herkunftsland der verarbeiteten Nahrungsmittel ausgewiesen wird. "Italien bildet die Avantgarde der Kennzeichnungspflicht", sagte der Sozialdemokrat, als er im Juli das Gesetz vorstellte.
Die italienischen Verbraucher goutieren die Transparenz-Pflicht. Die Bauern sehen im Minister gar einen Helden. Aber Martina macht sich mit seinem Vorstoß nicht überall beliebt. Die Industrie ist in Aufruhr. Auch in Brüssel eckt der umtriebige Italiener mit der Aufklärungsoffensive an.
Die Vorgeschichte: Seit April muss in Italien bei Molkereiprodukten auf der Verpackung deutlich das Herkunftsland der Milch erkennbar sein. Im Sommer zog Martina mit drei weiteren Grundnahrungsmitteln nach. Zwei Jahre lang soll die Infopflicht auch bei Pasta, Reis und Tomatenkonserven ausprobiert werden. Rom forderte damit die EU-Kommission heraus. Sollte Brüssel den Alleingang ablehnen, droht die Eröffnung eines Strafverfahrens.
Wer Nudeln al dente mag, kann auf Import-Weizen nicht verzichten, sagen die Hersteller
Rasch war klar, dass die Vorschrift auch in Italien Zündstoff enthält. Besonders brisant ist die Angelegenheit, wenn es um die Nudel geht. Italiens Nationalgericht lässt der kulinarischen Fantasie mit 300 Pasta-Formaten und einer unendlichen Zahl von Zubereitungsweisen weiten Lauf. Sie ist die Krönung der italienischen Küche. Im Jahr setzen die italienischen Pasta-Hersteller 4,7 Milliarden Euro mit Spaghetti und Maccheroni um. "Würden wir Nudeln nur aus italienischem Hartweizen herstellen, dann ginge die Produktion um 30 bis 40 Prozent zurück", sagt Paolo Barilla. Der Vorstoß sei darum "ein Eigentor", schimpft der Weltmarktführer aus Parma, der auch Chef des Verbandes der italienischen Teigwarenhersteller ist. Die Branche kämpft ohnehin mit knappen Margen.
Die Industriellen weisen darauf hin, dass das ausländische Korn unverzichtbar ist. In Italien wird auf 1,3 Millionen Hektar Hartweizen angebaut. Damit lässt sich der Pasta-Hunger - die Italiener verzehren im Jahr 23,5 Kilo pro Kopf - nicht sättigen. Die Jahresproduktion von italienischem Hartweizen liegt bei 4 Millionen Tonnen, die Industrie verarbeitet 7 Millionen Tonnen. Außerdem erfüllt das italienische Korn nicht die Qualitätsanforderungen der Hersteller. Das Lebensmittelgesetz schreibt einen Proteingehalt der Nudel von 10,5 Prozent vor. Nur 60 Prozent der heimischen Ernte erfüllt diese Vorgabe. Damit die Rigatoni auf dem Teller schön bissfest sind, stecken in italienischer Qualitäts-Pasta im Durchschnitt 13 Prozent Protein.
Um den schlappen italienischen Weizen zu stählen, wird er mit dem super-harten Getreide aus den nordamerikanischen Kornkammern Arizona oder Kanada verschnitten. Wer seine Nudel al dente mag, kann auf Import-Weizen nicht verzichten, argumentieren die Hersteller. Nur trauen sie sich nicht, es aufs Etikett zu schreiben.
So entbrannte ein erbitterter Streit zwischen der Regierung und der Industrie. "Guerra del grano", Kornkrieg, nennt die italienische Presse die Schlacht um die heimische Pasta. Es ist ein Kampf aller gegen alle. Nudelhersteller gegen Regierung. Bauern gegen Nudelhersteller. Italienischer Hartweizen gegen ausländischen.
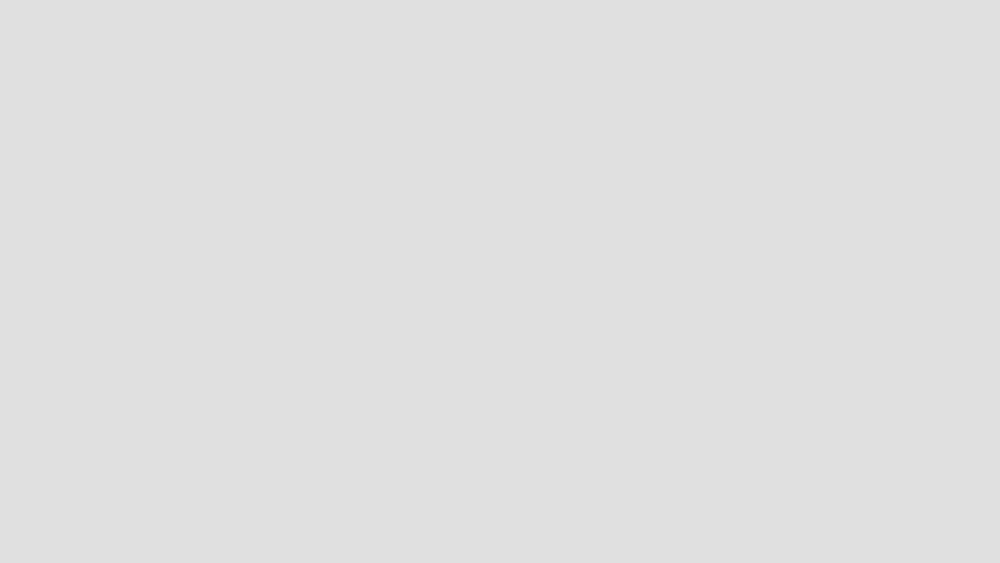
Der Bauernverband Coldiretti verweist darauf, dass 96 Prozent der italienischen Verbraucher den Ursprung der Nahrung erfahren möchten. Sie hätten ein Recht darauf zu erfahren, ob die Nudel zum Beispiel kanadischen Hartweizen enthält, der üblicherweise kurz vor der Ernte noch einmal zum Trocknen mit Glyphosat behandelt wird. In Italien ist das verboten. Die Agrarlobby ließ acht Spaghetti-Label im Labor untersuchen. Alle enthielten Spuren von Glyphosat - allerdings weit unter den zulässigen Grenzwerten. Doch die Verunsicherung der Verbraucher wächst.
Den Bauern, die in Italien meist kleine Betriebe führen, geht es ums Geld. Auf den Kornfeldern Apuliens, am Stiefelabsatz, macht man den Importweizen für einen existenzbedrohenden Preisverfall verantwortlich. Der Erlös für 100 Kilo Hartweizen ist um 48 Prozent unter 19 Euro gesunken - dafür kann man zwei Pizze kaufen.
Wie ein packender Spaghetti-Western hält die Fehde Überraschungen bereit. So legten die italienischen Nudelhersteller Einspruch beim Obersten Verwaltungsgericht ein und verlangten die Aussetzung der Vorschrift. Das Gericht in Rom ist berühmt-berüchtigt, weil es häufig Neuerungen und Reformen gestoppt hat. Martina aber errang einen Sieg. Das "öffentliche Interesse am Verbraucherschutz" sei vorrangig, urteilten die Richter und wiesen die Klage Ende November ab. So kann die umstrittene Bestimmung nun eigentlich am 17. Februar 2018 in Kraft treten.
Doch vergangene Woche konterte die Industrie. Die europäische Branchen-Lobby Food Drink Europe reichte bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen die römische Informationspflicht ein.
Das Motiv der Klage: Man sorge sich um den Binnenmarkt. In acht Mitgliedsländern wurden nationale Vorschriften zur Ursprungsbezeichnung eingeführt, was bereits negative Folgen für den innereuropäischen Handel mit Nahrungsmitteln habe. Mit der Beschwerde will die Industrie auf eine Einhaltung der EU-Regeln pochen. Sie wirft Italien Protektionismus vor. Steht aber das Recht auf Information im Widerspruch zur Marktwirtschaft? Müssen die Europäer auf Aufklärung verzichten, um den Binnenmarkt zu retten? Funktioniert freier Warenverkehr nur, wenn uninformierte Verbraucher brav konsumieren?
Schon im März hatte Rom die Pflicht, den Verarbeitungsstandort auf dem Etikett anzugeben, wieder eingeführt. Eine entsprechende Vorschrift war durch die Neufassung der EU-Verordnungen abgeschafft worden. Der Hinweis liege nicht nur im Interesse des Verbrauchers, er erleichterte den Behörden auch die Kontrollen, heißt es in Rom. Die Jagd auf Lebensmittelfälscher und Betrüger wird in Italien recht ernst genommen.
Einen Monat später kam der Minister mit seiner Anordnung, auf der Verpackung von Molkereiprodukten das Herkunftsland der Milch auszuweisen. Bei Käse ist der Etikettenschwindel an der Tagesordnung. Da beschlagnahmen Carabinieri in Apulien schneeweiße Kugeln mit der Aufschrift "Mozzarella aus Milch aus dem Umland von Bari". Sie waren aber aus ungarischer Milch und Import-Lab hergestellt.
Martinas Vorpreschen soll den italienischen Milchbauern helfen. Sie sind oft wegen ihrer kleinen Betriebe, hohen Lohnkosten und Italiens restriktiven Vorschriften etwa zur Fütterung der Tiere nicht wettbewerbsfähig. 2015 zwang der Milchpreisverfall 1100 Ställe zur Aufgabe. Viele Käsehersteller kaufen Milch billig bei Großmolkereien in Deutschland und Osteuropa ein. In der Käse-Frage geriet Martina bereits 2015 mit Brüssel aneinander. Die EU verlangte die Streichung einer Vorschrift, nach der die 488 italienischen Käsesorten nur aus Milch hergestellt werden dürfen. Es müsse erlaubt sein, sie kostengünstig aus Milchpulver herzustellen. Der EU-Kommission ging es dabei um das "einwandfreie Funktionieren des Binnenmarkts".
So prallen in Europa laufend konträre Interessen aufeinander. Am längeren Hebel sitzt oft Deutschland mit seiner mächtigen Agrarlobby. Martina versucht nun, die Etikettierung als Wettbewerbsinstrument einzusetzen. Italien kann auf dem Weltmarkt nicht mit Billigwaren und Niedrigpreisen punkten, sondern mit Qualität, Esskultur und einer starken Bioproduktion. Die Nachfrage aus dem Ausland nach "Made in Italy" zieht kräftig an. Der Export stieg 2016 auf 38 Milliarden Euro. Um das Potenzial besser auszuschöpfen, will man den Schutz der begehrten Leckereien vor Plagiaten und falschen Etiketten verstärken.
Durch Fake-Produkte wie Parmesan, Barollo-Wein, falschen Parmaschinken oder Makkaroni-Nudeln gehen den Italienern jährlich viele Milliarden Euro durch die Lappen. "Wenn es uns gelänge, unsere Produkte anstelle der fremden Imitate zu verkaufen, könnten wir spielend weitere 100 Milliarden Euro umsetzen", rechnet Luigi Scordamaglia vor, der Chef des Nahrungsmittelverbandes.