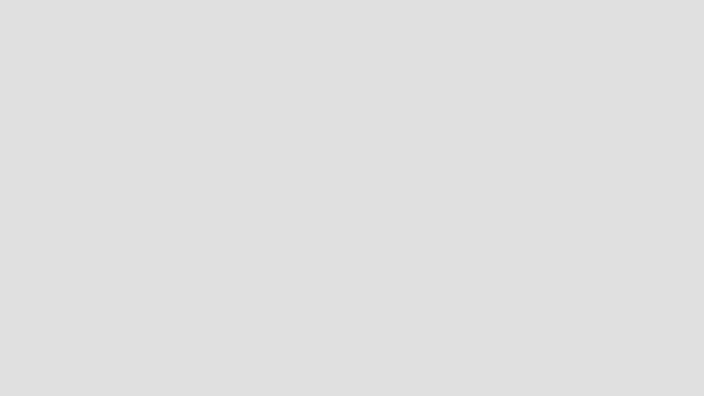Auch wenn die Krise in Griechenland in den vergangenen Wochen sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, so ist sie doch nur ein Nebenkriegsschauplatz, wenn es um die Frage geht, wie lang die Euro-Zone überleben wird. Nachdem Wolfgang Schäuble seinen Plan für einen temporären Grexit vorgelegt hatte, wurde die Gefahr, die von Griechenland für die Euro-Zone ausging, auf die einfache Frage reduziert: Ist eine Währungsunion, aus der jemand austreten kann, noch eine Währungsunion? Die kurze Antwort darauf lautet: Ja, das ist sie - heute und auch künftig.
Mark Blyth, 47, ist Eastman-Professor für Politische Ökonomie an der Brown University in Providence (USA). Der Schotte wurde bekannt als Autor des Buchs "Austerity: The History of a Dangerous Idea" (2013). Im April veröffentlichte er gemeinsam mit Matthias Matthijs "The Future of the Euro".
Griechenland ist als einziger Euro-Staat bankrott und wird auch für absehbare Zeit von der Europäischen Union gepflegt werden müssen. Aber der Rest der Euro-Zone erholt sich gerade - und zwar auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik massiv eingreift und damit die Austeritätspolitik de facto beendet hat. Daher scheint die Zukunft des Euro, jedenfalls auf mittlere Sicht, gesichert zu sein.
Folgt man der herrschenden akademischen Meinung, dann ist der Grund für die Schwäche des Euro weniger im griechischen Wirrwarr oder in der Gefahr eines Austritts zu suchen - sondern in der Unvollkommenheit der europäischen Institutionen. Demnach war Europas Krise vor allem deshalb so tief, weil es lange an einer gemeinsamen Finanzpolitik fehlte, an einer Bankenunion, an einer gemeinsamen Einlagensicherung und an Eurobonds. Als die Krise Europa traf, fehlte es den Ländern der Euro-Zone an der Möglichkeit, ihre Währungen abzuwerten. Deshalb waren sie gezwungen, ihre Wirtschaft intern anzupassen - und zwar alle Länder gleichzeitig. Die Austeritätspolitik wurde daher überall das Mittel der Wahl.
Der Irrtum: Am möglichen Grexit wird die Währungsunion nicht scheitern.
Die Wahrheit: Der Euro überlebt nur, wenn die übrige Welt weiter Europas Waren kauft.
Das Problem: Längst nicht alle Euro-Staaten sind so exportstark wie Deutschland.
Eine Trennlinie verläuft zwischen den EU-Staaten
Die Folge war eine tiefe Rezession. Trotzdem hat die Euro-Zone seit 2010 viel auf den Weg gebracht und zum Beispiel den Fiskalpakt und die Bankenunion geschaffen. Es gibt also einiges zu loben. Und doch bleibt die Währungsunion zerbrechlich, weil der institutionelle Rahmen noch immer nicht stabil ist. So sehen die meisten Akademiker die Probleme Europas. Das ist nicht falsch, die Argumentation hat aber Schwachstellen, denn sie lässt einen wichtigen Gedanken außer Acht. Und der ist für Europas Zukunft entscheidend.
Als der Euro eingeführt wurde, da verwandelte sich jene politischen Union, die einst um die fünf großen Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien errichtet wurde, in eine sehr viel buntere wirtschaftliche Union mit 27 Mitgliedern. In diesem Europa gibt es eine nicht zu überhörende Kakofonie der Interessen und Ziele. Und so kommt nun, in der Krise, ein Europa zum Vorschein, in dem die Trennlinie nicht zwischen dem Norden und dem Süden verläuft. Diese Trennlinie verläuft zwischen jenen Ländern, die dauerhaft Leistungsbilanzüberschüsse erzielen können - und jenen, die das nicht können; zwischen jenen Staaten, die vom Euro profitieren - und jenen, die das nicht können, weil ihnen eine eigene Währung fehlt. Diesen Ländern bleibt nur die Möglichkeit, schmerzvolle Einschnitte vorzunehmen - oder den Ausgang aus der Währungsunion zu suchen.
Die Zukunft des Euro hängt auf lange Sicht davon ab, ob die Mitgliedsstaaten in der Lage sind, im weltweiten Wettbewerb auf den Exportmärkten mit den Amerikaner und Asiaten mitzuhalten. In solch einer Welt spielt die Binnennachfrage nur die zweite Geige. Die asiatischen Länder werden immer produktiver, und die Amerikaner dominieren nach wie vor den oberen Bereich der Wertschöpfungskette. Deshalb hängt der Wohlstand des vom Export getriebenen Europas davon ab, fortwährend die Qualität seiner Produkte zu verbessern, ohne dass die Preise steigen.
Viele Länder, die extrem vom Export geprägt sind
Insofern ist der Essay von Ludger Schuknecht, dem Chefökonomen des Bundesfinanzministeriums, der jüngst in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, korrekt. Würde man die Konjunktur nach keynesianischem Muster ankurbeln, würde dies die Wirtschaftspolitik untergraben. Denn in einer vom Export getriebenen Volkswirtschaft braucht man jemanden anders, der die Wirtschaft in Gang bringt, während man selber darauf achtet, die Preise und Löhne unter Kontrolle zu halten. Wenn man stattdessen einfach die Löhne und Preise erhöht, würde dies die Exporte bloß teurer machen.
Sparen oder nicht? Schuldenschnitt - ja oder nein? Prominente Ökonomen diskutieren in der SZ über die Krise in Griechenland, und was daraus für Europas Zukunft folgt. Alle bisherigen Beiträge - von Marcel Fratzscher über Hans-Werner Sinn und bis hin zu Jeffrey Sachs und James Galbraith - finden Sie unter: www.sz.de/szdebatte-griechenland
In solch einer Welt hat der Euro sehr unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Länder. Man muss dazu nur durch Europa reisen. Wenn man in Finnland startet, Schweden und Dänemark durchquert (zwei Länder, die de facto auch Euro-Länder sind), durch Deutschland nach Norditalien reist, sich gen Osten der Slowakei und Tschechien zuwendet und weiter nach Rumänien und von dort zurück durch Österreich und Polen, dann kommt man durch ein Europa, das auf einzigartige Weise vom Export geprägt ist.
Diese Länder besaßen entweder schon immer eine offene, vom Export beherrschte Wirtschaft; oder aber sie haben nach dem Zusammenbruch des Kommunismus die bestehenden Strukturen zerstört und sich voll neoliberalen Alternativen zugewandt. Ersteren verhalf der Euro zu einem Wechselkurs, der niedriger war, als wenn sie ihre nationalen Währungen behalten hätten. Letztere wurden durch den Euro in jenen von Deutschland beherrschten Produktionsprozess für hochwertige Exportgüter integriert.
Die Zahlen zeigen dies eindrücklich. Der Exportweltmeister Deutschland weist einen Leistungsbilanzüberschuss auf, der 7,75 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Ähnlich verhält es sich mit Schweden und Dänemark, deren Überschüsse rund sieben Prozent betragen. Auch die osteuropäischen Länder, die früher mehr ein- als ausgeführt hatten, weisen nun Exportüberschüsse auf. So wies Tschechien noch 2004 ein Minus von rund fünf Prozent auf, nun erwirtschaftet das Land im Außenhandel Überschüsse. Auch Polen, wo das Minus bei vier Prozent lag, weist nun einen Leistungsbilanzüberschuss auf, ebenso wie Slowenien.
Für manche wird es verlockend sein, aus dem Euro auszusteigen
Aber wie ergeht es den Ländern, die nicht in der Lage sind, diesem Wachstumsmodell zu folgen? Italien ist ein besonders interessantes Beispiel. Das Land wächst seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr, aber es nutzt nun die Zulieferer in Osteuropa - und weist heute einen Leistungsbilanzüberschuss auf. Die Portugiesen haben unter der Austeritätspolitik ihrer Regierung gelitten; aber das Leistungsbilanzminus von sieben Prozent hat sich in ein Plus von einem Prozent verwandelt.
Es gibt jedoch zwei Ausreißer. Der eine ist Frankreich, das früher mehr exportiert als importiert hat. Nun weist das Land ein doppeltes Minus auf: In seinem Staatshaushalt klafft ein Defizit von vier Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung und in der Handelsbilanz von einem Prozent. Der zweite Ausreißer ist Großbritannien, das ebenfalls ein doppeltes Minus ausweist: Im Staatshaushalt beträgt die Lücke 4,9 Prozent, in der Handelsbilanz sogar 6,2 Prozent. Aber wenigstens kann Großbritannien von Zeit und Zeit seine Währung abwerten; es lebt zudem recht komfortabel, da es über den Finanzplatz in London viel Kapital aus dem Rest der Welt steuert.
All dies zeigt: Große Volkswirtschaften werden sich in einem exportorientierten Europa schwertun, wenn ihre Wirtschaft durch die Binnennachfrage getrieben ist und sie einen starken Sozialstaat haben. Diesen Staaten bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder verstoßen sie gegen Haushaltsregeln oder sie werten intern ab, senken also Löhne und Preise, um wettzumachen, dass sie extern nicht abwerten können, weil sie ja keine eigene Währung mehr haben. Diese Länder sind die neuen "Schwachstellen" der Euro-Zone. Für sie wird es über kurz oder lang verlockend sein, aus dem Euro auszusteigen.
Aus dieser Analyse ergeben sich drei Schlussfolgerungen
Das erste Fazit: Zwar schaffen es Länder wie Portugal und Spanien, Überschüsse zu erzielen, aber nur, weil ihre Binnennachfrage zusammengebrochen ist. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in diesen Ländern ist es fraglich, ob diese Politik auf Dauer durchzuhalten ist. Jobs in der Exportindustrie können einfacher durch Kapital ersetzt werden als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Deshalb gehen die anspruchsvollen Jobs im verarbeitenden Gewerbe langfristig zurück. Das mag zwar dazu führen, dass die Exportwirtschaft gute Geschäfte macht. Wenn aber weite Teile der Bevölkerung nicht profitieren, weil Löhne und Beschäftigung nicht steigen, wird dies zum Problem.
Die zweite Schlussfolgerung: Die Anleiherenditen in Europa werden für lange Zeit negativ bleiben. Erinnert sich noch jemand an Ben Bernankes "Savings Glut", an die Flut von Ersparnissen? Mit dieser Theorie hat der frühere US-Notenbankchef vor der Krise die Niedrigzinsen erklärt. Demnach haben die Asiaten mit ihren Handelsüberschüssen einen Überschuss an Ersparnissen erzeugt, und auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten haben sie mit ihrem Geld die globalen Zinssätze gedrückt. Wenn die Euro-Zone so weitermacht wie bisher, wird sie zum Asien von morgen. Das Gegenstück zum enormen Anstieg der Leistungsbilanzüberschüsse in der Euro-Zone ist nämlich ein Überschuss an Ersparnissen im Vergleich zu Investitionen.
Europa profitiert davon, dass andere Geld ausgeben
Und schließlich die dritte Schlussfolgerung: Dieses neue System mag zwar auf lokaler Ebene robust sein, global betrachtet ist es aber fragil. Es beruht darauf, dass alle anderen nicht mehr sparen, als sie investieren. Dieses neue Europa ist ein Trittbrettfahrer, der davon profitiert, dass andere Geld ausgeben. Damit aber liegt auch das Schicksal der europäischen Wirtschaft in fremden Händen. Da die Asiaten und Europäer zur gleichen Zeit auf den Export setzen, droht das ganze System ziemlich schnell an seine Grenzen zu geraten: Nämlich dann, wenn der Rest der Welt aufhört zu konsumieren.
Was folgt daraus? Kurzfristig ist der Euro sicher vor einer Pleite Griechenlands und ähnlichen Risiken. Langfristig wird sich sein neues Wachstumsmodell aber als großer Schwachpunkt erweisen.