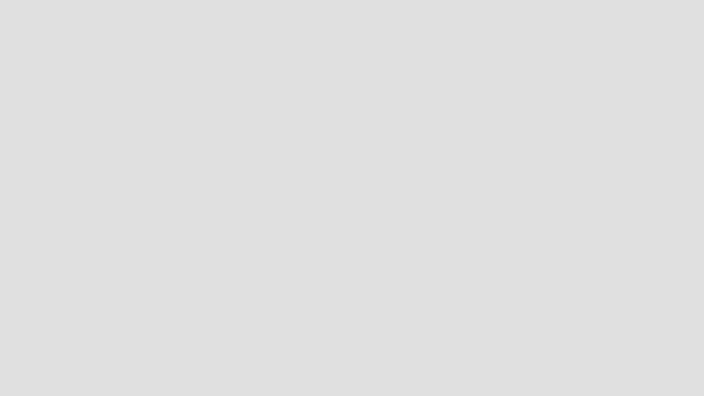Kurzfristig wirkt das Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU vor allem als ökonomischer Schock. Die schwersten Folgen zeitigte der Brexit jedoch weder in London, Frankfurt oder Berlin, sondern in Rom. Dort schwelt seit Jahren eine große Bankenkrise. Weil der Schock aus London das Vertrauen in den gesamten Finanzsektor erschüttert hat, wurde die Krise jetzt akut. Die drittgrößte Bank des Landes, Monte dei Paschi di Siena, gleichzeitig die älteste noch bestehende Bank der Welt, muss sehr schnell gerettet oder abgewickelt werden.
Der Aktienkurs von Unicredit, der größten Bank Italiens und Mutter der deutschen HVB, brach seit dem Brexit um ein Drittel ein. Insgesamt sitzen Italiens Banken auf einem Berg von 360 Milliarden Euro fauler Kredite, bei denen die Schuldner mit Zins und/oder Tilgung im Rückstand sind. Die Summe entspricht einem Fünftel der italienischen Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig grassiert die Angst, dass aus der italienischen eine europäische Krise werden könnte.
Statt zu sanieren wurde in Italien munter weitergewurstelt
Die Dimension des Problems erschließt sich, wenn man vier Jahre zurückblickt. Am 26. Juli 2012 hielt Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, seine "Whatever-it-takes"-Rede und versprach: "Innerhalb ihres Mandates wird die EZB tun, was immer nötig ist, um den Euro zu bewahren. Und glauben Sie mir, es wird genug sein." Kritiker werfen Draghi seither vor, er habe Europas Politikern einen Blankoscheck ausgestellt und den Reformdruck von ihnen genommen. Die Befürworter sagen: Draghi hat den Euro gerettet, ohne seine Nullzins-Politik bräuchte man über Reformen gar nicht mehr zu reden.
Das Problem ist: Beide Seiten haben recht. Man möchte nicht wissen, wie die Welt aussähe, hätte sich Draghi nicht durchgesetzt und die Spekulation gegen die Währungsunion gestoppt. Es stimmt aber auch, dass viele Regierungen die Zeit, die ihnen Draghi gekauft hatte, nicht nutzten. Krassestes Beispiel ist Italien. Dass dessen Bankensektor marode ist, wissen alle Beteiligten seit der Finanzkrise. Nach 2008 hätten die Institute einen dreistelligen Milliardenbetrag gebraucht, um ihre faulen Kredite abzuschreiben. Zu der Sanierung ist es nie gekommen, auch weil man dank Draghi weiterwursteln konnte. Das hat schwerwiegende Folgen für die gesamte italienische Wirtschaft. Unterkapitalisierte Banken verleihen zu wenig Geld, Firmen investieren zu wenig und schaffen zu wenige Arbeitsplätze.
Niemand kann von Matteo Renzi erwarten, dass er Kleinsparer enteignet
Es geht dabei längst nicht nur um Italien. Auch die anderen großen Banken Europas stehen schlecht da. War das Problem vor der Finanzkrise, dass sie zu viel Geld mit zu riskanten Geschäften gemacht hatten, so verdienen sie heute eindeutig zu wenig. Das lässt sich an den Aktienkursen ablesen: Die Deutsche Bank kostet heute weniger als in der Finanzkrise. Wenn ein Institut so abstürzt, spielen immer auch hausgemachte Probleme eine Rolle. Es gibt aber auch eine Krisenursache, die alle trifft, und da kommt wieder Draghi ins Spiel: Weil die Zinsen null oder negativ sind, ist die traditionelle Einnahmequelle einer Bank, die Marge zwischen Einlagen- und Kreditzins, praktisch verschwunden. Banken, die kaum Gewinne machen, sind aber besonders anfällig für Vertrauenskrisen wie nach dem Brexit.
Es kommt darauf an, die Vertrauenskrise zu beenden und schnell die Lage in Italien zu stabilisieren. Die gute Nachricht ist, dass in Rom inzwischen mit Matteo Renzi ein Ministerpräsident regiert, der zu Reformen entschlossen ist. Er will einen Staatsfonds auflegen, der Kapital in die Banken einschießt. Gegen den Plan gibt es vier gewichtige Einwände: Erstens würden private in staatliche Schulden umgewandelt. Zweitens ist der Fonds zu klein. Drittens verstößt der Plan gegen EU-Regeln, und viertens widerspricht er allem, was man unmittelbar nach der Finanzkrise geschworen hatte: dass bei künftigen Bankenrettungen Aktionäre und Gläubiger zahlen, nicht die Steuerzahler.
Das Problem ist nur: Im Falle der italienischen Banken sind die meisten Gläubiger nicht irgendwelche Spekulanten, sondern italienische Kleinsparer, deren Rücklagen fürs Alter aus Bankaktien bestehen. Wer auf der strengen Einhaltung der Regeln besteht, der verlangt von Renzi, dass er Italiens Sparer enteignet. Das wird er nicht tun, schon um das italienische Verfassungsreferendum im Herbst zu überstehen. Wichtiger als eine strenge Auslegung der EU-Regeln ist Schnelligkeit und Gründlichkeit. Man muss das Feuer austreten, solange es klein ist. Was immer Renzi macht, es darf nicht zu klein ausfallen, sonst kehrt die Krise über kurz oder lang zurück. Die EU-Kommission und die Bundesregierung sollten Renzi unterstützen, so gut es geht. Es gibt heute nicht mehr sehr viele Reformer in Europa.