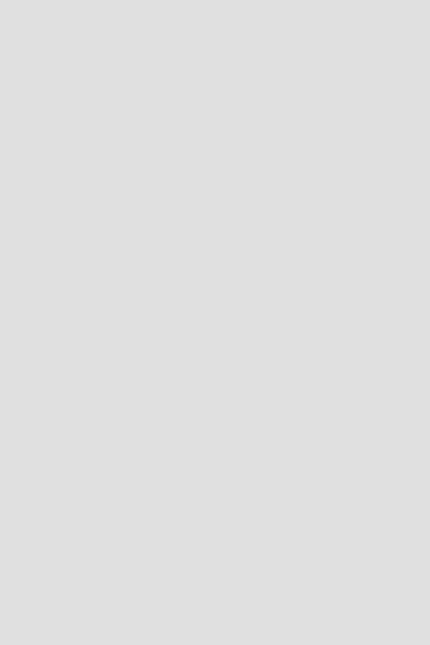An einem der letzten Tage im November, als sich die Augen der Welt auf den G20-Gipfel in Buenos Aires richteten, fand im noblen Stadtteil Barra da Tijuca von Rio de Janeiro ein Frühstück statt, das öffentlich kaum beachtet wurde. Dabei ging es um nicht weniger als um eine Achsenverschiebung in der Geopolitik.
Am Frühstückstisch, gedeckt mit Maiskuchen und Kokoswasser im Tetrapack, saß neben dem Hausherrn Jair Bolsonaro auch John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater von Donald Trump. Es war der erste direkte Kontakt des kommenden brasilianischen Staatschefs mit dem engen Zirkel des US-Präsidenten. Es war das erste informelle Treffen dieser Art zwischen Brasilien und den USA seit Jahren. Manche meinen, es war der Beginn einer neuen Ära.
Worüber geredet wurde? Über das, was beide Seiten als die dringlichsten Probleme Lateinamerikas empfinden: Kuba, Venezuela, der wachsende Einfluss Chinas. Man darf davon ausgehen, dass der dritte Punkt Priorität hatte.
Lateinamerika ist ein oft unterschätzter Nebenkriegsschauplatz des Handelsstreits zwischen Washington und Peking. Die USA haben die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit ihrem sogenannten Hinterhof in der jüngeren Vergangenheit allenfalls als Nischenthema behandelt. Präsident Obama entdeckte so etwas wie eine Lateinamerika-Strategie erst viel zu spät - mit der Annäherung an Kuba. Trump hatte nie eine Strategie, wenn man mal von der strategischen Beleidigung der Mexikaner absieht.
In diese Lücke stießen die Chinesen. 80 Jahre lang waren die USA der wichtigste Handelspartner der regionalen Großmacht Brasilien, seit 2009 ist es China. Chinesische Firmen kaufen, investieren und bauen in ganz Lateinamerika ohne die lästigen Restriktionen, die sie beispielsweise in Europa vorfinden würden. Da geht es etwa um einen Freihandelshafen auf Kuba, um Ölbohrungen in Venezuela, um ein Atomkraftwerk in Argentinien, um die komplette brasilianische Stromversorgung. Neu ist, dass sich Washington daran stört.
Ein nur vermeintlich kleines Beispiel: die Sojabohne. Seit Peking im Zuge des Zollkrieges 25 Prozent Aufschlag auf Soja-Importe aus den USA verhängt hat, verlegen sich chinesische Einkäufer noch mehr als bisher auf den brasilianischen Markt - zum Leidwesen der US-Farmer. Boltons Frühstücksbesuch in Rio dürfte also vor allem einen Hintergrund gehabt haben: Es war der Versuch, den Präsidenten bereits vor dessen Amtsantritt auf die amerikanische Seite der Front zu ziehen.
Aus ideologischer Sicht dürfte es da keine größeren Hemmnisse geben. Der ultrarechte Jair Messias Bolsonaro, 63, ist stolz auf seinen Spitznamen "Tropen-Trump". Der Vergleich hinkt ziemlich, benutzen sollten ihn nur diejenigen, die Bolsonaro einen Gefallen erweisen wollen. Fest steht, dass er den US-Präsidenten bewundert, er sieht in Trump einen strategischen Partner im Kampf gegen alles, was aus seiner Warte links ist oder auch nur ansatzweise rot schimmert. Dazu zählt er offensichtlich auch den chinesischen Staatskapitalismus. Im März 2018, als Bolsonaro noch ein vermeintlich aussichtsloser Präsidentschaftskandidat war, unternahm er eine Asienreise. Er besuchte Japan, Südkorea und: Taiwan. Um die Volksrepublik China indes machte er einen großen Bogen. Auf Twitter teilte er mit, der Trip habe deutlich gemacht, dass die bisherige brasilianische Politik eines "freundlichen Umgangs mit kommunistischen Regimen" bald vorbei sein werde. Immer wieder erklärte er im Wahlkampf um das Amt des Präsidenten, er werde nicht erlauben, dass "China Brasilien aufkauft".
Bolsonaro ist aber auch ein Meister des ständigen Widerspruchs, da ähnelt er dem US-Präsidenten. Sein designierter Superminister für Wirtschaft und Finanzen, Paulo Guedes, will möglichst viele brasilianische Staatsbetriebe privatisieren. Es wäre ein gigantischer Supermarkt, der da plötzlich entstünde, nicht zuletzt für chinesische Investoren. Bolsonaro, der bekennt, keine Ahnung von Ökonomie zu haben, hat mit der Personalie Guedes im Wahlkampf die Börsen und einen Großteil der Unternehmer auf seine Seite gebracht. Sie erwarten von ihm jetzt den angekündigten wirtschaftsliberalen Reformkurs.
Gleichzeitig steht der neue Präsident aber auch bei seiner wichtigsten Lobbygruppe, den Militärs, zu denen er selbst gehört, im Wort. Und die betrachten die brasilianischen Staatsbetriebe traditionell als nationales Eigentum. Eine der spannendsten Fragen wird sein, wie Bolsonaro vom 1. Januar an mit diesem Dilemma regieren will. Die politische Annährung an die USA, die an Nachäffung grenzt, ist schon jetzt unübersehbar. Dazu gehört die Ankündigung Bolsonaros, die brasilianische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Er spielte auch offen mit dem Gedanken, wie Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten, was er angesichts sinkender Umfragewerte im Wahlkampf-Endspurt wieder dementierte. Das muss aber nicht heißen, dass der Plan damit erledigt ist. Der künftige Außenminister Ernesto Araújo gilt als einer der größten Trump-Fans Südamerikas. Den Klimaschutz hält er für eine "marxistische Ideologie" mit dem Ziel, den Einfluss Chinas in der Welt zu fördern.
Das Bizarre an diesem Konfrontationskurs mit Peking ist, dass ihn sich Bolsonaro eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Er muss so schnell wie möglich die brasilianische Wirtschaftskrise beenden, wenn er nach seinem rauschhaften Wahlsieg nicht direkt eine allgemeine Katerstimmung auslösen will. Dafür braucht er zweifellos chinesisches Geld. Gut ein Viertel aller brasilianischen Exporte, allen voran Soja und Eisenerz, gehen heute nach China, Tendenz steigend. Die USA kaufen nicht einmal halb so viel in Brasilien ein.
Chinesische Investoren und Diplomaten, die in Brasilien deutlich diskreter vorgehend als etwa John Bolton, setzen darauf, dass Bolsonaro den Pfad des wirtschaftlichen Pragmatismus entdecken wird, wenn er erst einmal die Geschäfte führt. Vielleicht auch um bei diesem Denkprozess ein wenig nachzuhelfen, hat Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels demonstrativ ein Paket von 30 Handelsverträgen unterzeichnet - mit Brasiliens Nachbarn Argentinien.