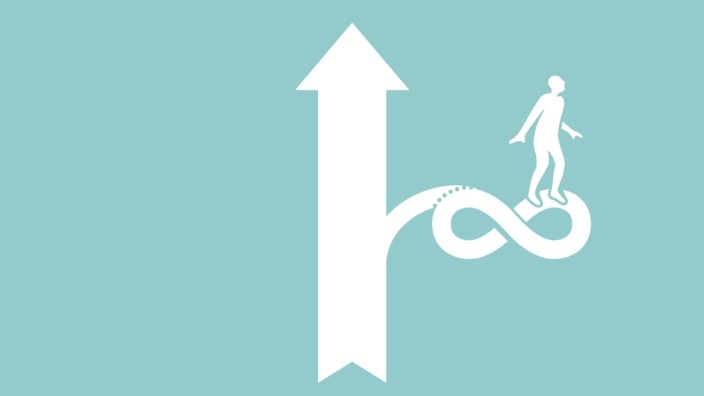Hartz IV hilft Menschen in Not, die nicht durch Arbeit auf den eigenen Beinen stehen können. Hier springt der Staat ein und verspricht Solidarität. Die aktuellen Überlegungen zu einem sogenannten solidarischen Grundeinkommen wollen erwerbslosen Hartz-IV-Empfängern ein Grundeinkommen im unteren Tariflohnbereich oder wenigstens auf Mindestlohnniveau ermöglichen, wenn sie bereit sind, eine gemeinnützige Tätigkeit auf Vollzeitbasis aufzunehmen. So hätten sie ein höheres Einkommen als bei Bezug von Hartz IV und wären unbefristet davon freigestellt, einen regulären Job zu suchen. Die Umsetzung dieses Plans käme einer arbeitsmarktpolitischen Bankrotterklärung gleich. Es würde das Prinzip der Solidarität auf den Kopf stellen. Dieses bedeutet eigentlich, dass der Staat das Versprechen gibt, alles zu tun, um Hilfebedürftige aus ihrer Notlage zu befreien. Im Gegenzug verspricht der Hilfebedürftige aber auch zu versuchen, bald wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
Der Vorschlag eines solidarischen Grundeinkommens kommt zu einem denkbar unpassenden Zeitpunkt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung legte seit 2014 Jahr für Jahr um zusätzlich 600 000 bis 700 000 Personen zu. Wir erleben gerade einen Beschäftigungsaufschwung, der seinesgleichen sucht. 1,2 Millionen Stellen sind unbesetzt. Die Chancen auf einen Job standen schon lange nicht mehr so gut wie jetzt, und das gilt - wenngleich nicht im selben Maße - auch für Langzeitarbeitslose und Hartz-IV-Empfänger. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist zuletzt weiter zurückgegangen. Inzwischen sind noch rund 850 000 Personen länger als ein Jahr ohne Arbeit, 85 000 Personen weniger als im Vorjahr.
Oft scheint in Vergessenheit zu geraten, dass wir bei Einführung von Hartz IV 2005 mit 1,7 bis 1,8 Millionen etwa doppelt so viele Langzeitarbeitslose hatten. Auch die Zahl der arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger hat sich von knapp drei Millionen halbiert. Wenn sich Verbesserungen eines solchen Ausmaßes einstellen, können die Reformen so schlecht nicht gewesen sein. Im Gegenteil: Hartz IV hat wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge den Aufschwung am Arbeitsmarkt unterstützt.
Die Zahlen zeigen: Das bisherige System kann so schlecht nicht sein
Das solidarische Grundeinkommen käme deshalb zur Unzeit, weil Beschäftigungserfolge damit infrage stünden. Zwar ist die angedachte Wahlfreiheit für alle erwerbslosen Hartz-IV-Bezieher im Sinne eines neuen Rechts auf Arbeit auf den ersten Blick attraktiv. Doch könnten auch Personen das solidarische Grundeinkommen wählen, die sehr wohl vom Beschäftigungsaufschwung am regulären Arbeitsmarkt profitieren können und nicht nur diejenigen in geförderte Beschäftigung kommen, die ansonsten keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Anreize, einen regulären Job aufzunehmen, sinken beträchtlich.
Verstärkt werden die Probleme des Vorschlags dadurch, dass der gemeinnützige Job nach den derzeitigen Überlegungen nicht befristet wäre. Daher würden bei Bezug des Grundeinkommens mögliche Alternativen einer nicht subventionierten Beschäftigung unter Umständen auch langfristig gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Die betroffenen Personen wären in diesen Jobs regelrecht geparkt - und das in Zeiten, in denen Arbeitskräfte mehr denn je benötigt werden.
Zwar ist das dem Konzept innewohnende Grundprinzip der gesellschaftlichen Teilhabe durch Arbeit gut und richtig. Wir können aber nachweisen, dass öffentlich geförderte Beschäftigung sich auf arbeitsmarktferne Personen beschränken muss. Geschieht dies nicht, läuft man wie bei den früheren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Gefahr, die gewünschten arbeitsmarktpolitischen Effekte zu verfehlen und sogar ins Negative umzukehren.
Eine Arbeitsaufnahme muss sich lohnen
Durch die Konzentration auf gemeinnützige Jobs in Vollzeit nimmt man der Gruppe, die von einer Teilhabe durch Arbeit und geförderte Beschäftigung profitieren können, die Möglichkeit, am solidarischen Grundeinkommen teilzuhaben. Diese Gruppe ist arbeitsmarktfern und eine vollzeitnahe Tätigkeit könnte überfordern. Zum Teil unterliegt diese Gruppe auch gesundheitlichen Einschränkungen, die einen Vollzeitjob unmöglich machen.
Mit dem Vorschlag des solidarischen Grundeinkommens wird ein als ungerecht empfundenes System infrage gestellt. Jetzt kann man natürlich lange und auch zurecht darüber streiten, wie hoch Leistungen für Menschen ausfallen sollten, die keine Arbeit finden und deren individuelle Ressourcen ausgeschöpft sind. Doch hier tut sich ein Zielkonflikt auf: Die Grundsicherung muss ein soziokulturelles Existenzminimum bieten. Es darf aber möglichen Übergängen in den ersten Arbeitsmarkt nicht im Wege stehen und mit dem dabei erzielbaren Erwerbseinkommen nicht zu sehr in Konflikt geraten. Eine Arbeitsaufnahme muss sich lohnen.
Hartz IV setzt darauf, dass Selbsthilfe und arbeitsmarktpolitische Hilfe Hand in Hand gehen sollen. Die Gesellschaft kann und darf für die von ihr gezeigte Solidarität erwarten, dass Individuen eigene Anstrengungen unternehmen, um ihre Notsituation zu beenden. Von daher ist es zumutbar, dass sie sich auf Stellen bewerben, Vorstellungsgespräche wahrnehmen, zu regelmäßigen Terminen im Jobcenter erscheinen und für angebotene Maßnahmen zur Verfügung stehen. Für ein wechselseitiges Vertrauen zwischen Arbeitslosen und Vermittlungsfachkräften braucht es aber selbstverständlich Augenmaß und Fingerspitzengefühl beim Einsatz von Sanktionen. In aller Regel ist dies gegeben: Befragungen von Vermittlern zeigen, dass diese Sanktionen nicht gerne und eher zurückhaltend einsetzen.
Die Arbeitsmarktreformen sind keinesfalls gescheitert. Aber es steht im Grundsicherungssystem auch nicht alles zum Besten. Es gibt einen klaren Weiterentwicklungsbedarf und es gibt Instrumente, die den aktuellen Herausforderungen besser gerecht werden und zielgerichteter Solidarität schaffen als das solidarische Grundeinkommen. Fünf Punkte sollte die neue Bundesregierung angehen:
Erstens muss es für die Menschen noch attraktiver werden, einen Job aufzunehmen, auch wenn dieser zunächst im Niedriglohnbereich liegt. Der gesetzliche Mindestlohn war ein richtiger Schritt in diese Richtung. Wir können aber noch mehr tun, um Arbeit zu belohnen. Zu denken ist hier an den Ausbau von Wohngeld und Kindergeldzuschlag genauso wie an niedrigere Steuern und Sozialabgaben für Geringverdiener. Auch könnten Erwerbstätige, die zusätzlich Hartz IV beziehen, bei steigender Stundenzahl mehr von ihrem Lohn behalten. Einen Beitrag zur Finanzierung kann der Abbau von Steuer- und Abgabenprivilegien bei Minijobs leisten, die einen Anreiz in die falsche Richtung setzen.
Zweitens sollte die aktuell gute Finanzsituation des Bundes dazu genutzt werden, um endlich den Jobcentern die notwendigen finanziellen Mittel für einen kleineren Betreuungsschlüssel zur Verfügung zu stellen, damit Langzeitarbeitslose gezielter, intensiver und ganzheitlicher beraten werden können. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Die Jobcenter waren in den letzten Jahren finanziell nicht ausreichend ausgestattet, um Arbeitslose intensiv zu betreuen und erforderliche Maßnahmen durchzuführen.
Drittens: Da dennoch nicht alle Hartz-IV-Empfänger sofort einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden werden - sei es aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, fehlenden Qualifikationen oder schwierigen persönlichen Lebensumständen -, brauchen wir für diesen begrenzten Personenkreis einen sozialen Arbeitsmarkt. Es ist unbestritten, dass Arbeiten ein wichtiger Faktor ist für die soziale Teilhabe. Im Gegensatz zum solidarischen Grundeinkommen ist der soziale Arbeitsmarkt aber zielgerichtet für diejenigen zu reservieren, die in absehbarer Zeit keinen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt finden können. Begleitet werden sollte die Einrichtung eines sozialen Arbeitsmarktes durch Coaches, die auf die individuelle Situation der Langzeitarbeitslosen eingehen können und gemeinsam mit ihnen an der sozialen Stabilisierung und Heranführung an reguläre Beschäftigung arbeiten.
Die Bekämpfung von Bildungsarmut muss im Vordergrund stehen
Viertens: Ein wichtiger zusätzlicher Faktor für mehr gesellschaftliche Solidarität ist der Ausbau der sozialen Infrastruktur. Hier gibt es viele Ansatzpunkte, Gerechtigkeit voranzubringen und Personen mit niedrigem Einkommen besserzustellen: beispielsweise durch bezahlbaren Wohnraum, günstige Betreuungs- und Pflegeangebote sowie stark ermäßigte öffentliche Verkehrsmittel. Mehr kostenlose Bildungs-, Sport und Freizeitangebote können zusätzlich dazu beitragen, dass Personen Kontakte knüpfen können und sogar ein funktionierendes Netzwerk etablieren können, das sie mitunter auch bei einem beruflichen Neustart unterstützen kann. All dies würde dazu beitragen, dass Menschen besser an der Gesellschaft teilhaben können und nicht abgekoppelt werden.
Fünftens und nicht zuletzt: Um den wachsenden Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens auch künftig Rechnung tragen zu können, wird es noch mehr darauf ankommen, Prävention zu intensivieren und damit zu verhindern, dass Menschen ins Abseits geraten. Die Bekämpfung von Bildungsarmut steht dabei im Vordergrund. Insbesondere kommt es darauf an, Bildungsarmut möglichst schon im frühkindlichen Bereich zu verhindern. Folgeprobleme am Arbeitsmarkt könnten zudem vermieden werden, wenn im Erwerbsverlauf die Beschäftigungsfähigkeit durch lebenslanges Lernen erhalten wird. Das würde wiederum beim anderen Risikofaktor Gesundheit weiterhelfen. Denn so sind Personen, die eine körperlich oder mental stark belastende Tätigkeit nicht länger ausführen können, imstande, eine andere Tätigkeit aufzunehmen. Verantwortung beim Thema Prävention muss sowohl der Staat als auch Betriebe und jeder Einzelne übernehmen.
Mit all diesen Weiterentwicklungen kämen wir noch mal einen großen Schritt voran und könnten tatsächlich mehr Solidarität schaffen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Ulrich Walwei ist Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.