
Plötzlich hat man Bob Dylan im Ohr und wird ihn nicht mehr los. "Shelter From the Storm", summt es innerlich. Auf den Magdalenen-Inseln kann das schon mal passieren. Denn dort stürmt es oft. Die Madelinots, wie die Bewohner heißen, waren früher fast alle Fischer. Ein sicherer Ort, ein sicherer Hafen ist ihnen immer noch wichtig. Kein Zufall also, dass die Inselbrauerei "À l'abri de la Tempête" heißt, was auch nichts anderes bedeutet als Schutz vor dem Sturm.
Anne-Marie Lachance und Élise Corneillier Bernier brauen seit 14 Jahren Bier auf der Île du Cap-aux-Meules. Hergebracht hat sie aber kein Sturm, sondern der Wind, der hier zum Kitesurfen ideal ist. Sie sind geblieben, und wenn sie nicht gerade den Wind mit dem Kiteschirm einfangen, produzieren sie preisgekrönte Biere. Mittlerweile trinkt man sie in ganz Québec, der kanadischen Provinz, zu der die Inselgruppe gehört. Den Geschmack der Inseln soll man im Bier erkennen. Deshalb experimentieren sie mit Auszügen aus Algen, Räucherfisch und Hagebutten. Der Bestseller heißt Cale Sèche, Trockendock, ein anderes Bier Terre Ferme, Festland.
Die Îles de la Madeleine, so ihr französischer Name, liegen abgeschieden vom restlichen Kanada im Sankt-Lorenz-Golf. Sieben bewohnte Inseln, 12 000 Einwohner, zwei Verkehrsampeln. Jeder kennt hier jeden. Wenn jemand stirbt, sendet das Inselfernsehen die Todesnachricht. Wenn jemand etwas verliert, wird der Suchaufruf im Radio gebracht. Zweimal am Tag kommt die Fähre von Prince Edward Island, die Überfahrt dauert fünf Stunden. Québec City ist mehr als tausend Kilometer oder eineinhalb Flugstunden entfernt.
Sechs der sieben Inseln sind durch Sandbänke verbunden, auf denen die Inselstraße verläuft. 180 Kilometer sind es vom einen Ende des Archipels zum anderen. Ähnlich wie auf den Florida Keys, nur eben nördlicher. Bei 20 Grad Celsius kennt das Lokalradio nur ein Thema: die große Hitze und wie man sich vor ihr schützt. Rot, Blau und Grün sind hier die Grundfarben: rot wie der Sandstein, blau wie das Wasser und grün wie die Wiesen. Und natürlich weiß wie der Sand, will man denn Weiß als Farbe sehen. Ein weißer Sandstrand ist hier nie weit, fast überall sieht man Wasser auf zwei Seiten. 300 Kilometer Strand, und kaum Menschen weit und breit. Am Strand der Dune du Nord lernt die Inseljugend Auto fahren. Und auf der Plage de La Martinique lernt man, mit dem Drachen zu surfen - zum Beispiel bei Steven Mantha. Er hat hier vor zwölf Jahren Kanadas erste Kitesurfschule gegründet. Die Bedingungen hier seien optimal: Anderswo gebe es Stachelrochen, gefährliche Felsen, zu viele Leute. "Hier hast du Platz. In der Lagune ist es geschützt, das Wasser ist flach, hier können Anfänger gefahrlos lernen."
So sorglos ging es hier nicht immer zu. Früher war das Meer eine Bedrohung. Ein Strand auf der Isle de la Grande Entrée heißt "Plage de la Grande Échouerie" - Strand des großen Scheiterns. An die 1000 Schiffe sollen in den Gewässern untergegangen sein, die meisten davon im 18. und 19. Jahrhundert. Nebel, Stürme, Sandbänke und die Sandsteinfelsen wurden ihnen zum Verhängnis. Trauriger Rekord: "In einem einzigen Sturm sind 46 Schiffe gesunken", erzählt Roxanne Woodrow. Sie arbeitet im Little Red Schoolhouse im Ort Old Harry. Die ehemalige Schule beherbergt ein Heimatmuseum und das Zentrum der englischsprachigen Einwohner. Das alte Schulhaus erzählt die Geschichte der nur noch 450 anglofonen Inselbewohner. Sie sind Nachfahren von Schiffbrüchigen aus England, Irland und Schottland. Roxanne erzählt stolz, dass ihre Mutter von Entry Island stammt, der einzigen rein englischsprachigen Insel des Archipels.
Hier hat alles zwei Namen, einen englischen und einen französischen, oder man hört einen Mix. Aber was heißt schon Französisch. Hier spricht man Akadisch, ein ganz eigenes Idiom, denn die frankofonen Inselbewohner sind Nachfahren der Akadier oder Acadiens. Wie Gilles Lapierre: Musiker, Geschichtenerzähler und Teilzeit-Busfahrer. Schon mit sechs Jahren hat er angefangen, Gitarre zu spielen. Zur Begrüßung auf dem Flughafen gibt er eine Einlage - mit Kuhknochen als Instrumenten.
Sein Vater produzierte von Zeit zu Zeit drei Gallonen Home Brew, dann kamen Freunde vorbei, man hat zusammen Musik in der Küche gemacht. Solche Kitchen Partys gebe es auch heute noch, erzählt er. Spontan sei das, nicht planbar. Aber Jam Sessions gebe es regelmäßig. Zum Beispiel montags im Pas Perdus in Cap-aux-Meules oder dienstags auf dem Campingplatz auf der Dune du Sud. Seine Musik? "Einfach Inselmusik", sagt er, aber sie klinge ähnlich wie die Cajun-Musik in den Bayous in Louisiana, auch dorthin hat es einen Teil der akadischen Familie verschlagen.
Lapierres Vorfahren haben auf den Inseln einen sicheren Hafen gefunden. Er hat seine Familiengeschichte erforscht, redet aber nicht gern über diese schlimme Zeit. Nur so viel: Im 17. Jahrhundert waren seine Vorfahren aus der Bretagne nach Nova Scotia ausgewandert. Hundert Jahre später haben die Engländer diese Franzosen während des Siebenjährigen Krieges, der auch in Nordamerika ausgefochten worden ist, von dort brutal vertrieben. "Meine Familie hat die Deportation von Saint-Pierre und Miquelon überlebt", sagt er. "Sie ist Teil der Insel-DNA." Ein ebenso wichtiger Teil der Identität ist die Fischerei. Es gibt jedoch nicht mehr viel Fisch zu holen. Die Heringsschwärme sind verschwunden. Die Inselbewohner haben sie rücksichtslos dezimiert. In den traditionellen Räucherhäusern, beliebte Ausflugsziele für Touristen, trocknet Hering, der aus New Brunswick kommt.
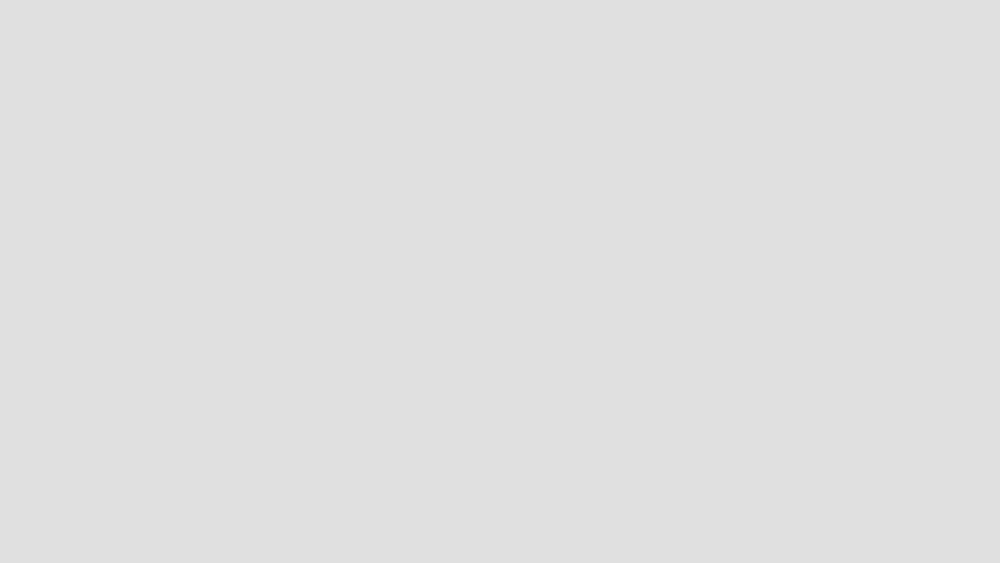
Hummer aber gibt es genug: Von Mai bis Mitte Juli verlassen morgens um halb vier die 115 Hummerboote den Hafen von La Grande Entrée, den größten Hummerhafen Québecs. Ein Boot ernährt vier Familien; neben dem Eigentümer arbeiten meist noch drei weitere Fischer an Bord. Auch Lapierre hat als 16-Jähriger auf einem Hummerboot angeheuert. "Aber schon nach ein paar Wochen hat der Boss zu mir gesagt: Aus dir wird kein richtiger Kerl." Tatsächlich passt der feingliedrige Mann mit Cowboystiefeln und Lederhut besser auf eine Bühne als auf einen Fischkutter. Mit seiner Musik ist er durch viele Länder getourt. Der Ruf der Insel habe ihn zurückgebracht. "Hier ist es ruhig, man lebt noch die Traditionen. Eine Fiedel bleibt hier ebenso in der Familie wie eine Hummerlizenz."
Auch Rosie Rankin ist auf der Insel aufgewachsen, hat aber den größten Teil ihres Lebens in Los Angeles verbracht. Jetzt wohnt sie wieder im Haus ihrer Kindheit und erklärt Besuchern im Seal Interpretation Center die Lebensweise der vier Seehundarten, die im Sankt-Lorenz-Golf heimisch sind. Aber auch, dass es zur Lebensweise der Menschen hier gehöre, Seehunde zu jagen und zu verspeisen - was vielen Touristen nicht wirklich zu vermitteln ist. Eine Kostprobe serviert Köchin Cathy McCartney gleich eine Tür weiter in der Auberge La Salicorne: Paté, Rillette, Würstchen und sogar Frühlingsrollen - alles von der Robbe.

Gejagt würden aber keine jungen, sondern nur ausgewachsene Tiere, betont Rosie Rankin. Und die Jagd sei stark rückläufig. Ein heikles Thema, das ihr sichtlich unangenehm ist. Seit Brigitte Bardot im Jahr 1976 damit begann, medienwirksam gegen die brutale Robbenjagd in Grönland zu protestieren, sind auch die Madelinots in der Kritik, obwohl es auf den Inseln nie üblich war, neugeborene Robben zu erschlagen. Stattdessen verdient man hier drei Wochen im Jahr Geld mit Robbenstreicheln. Wenn die Sattelrobben Mitte Februar bis Anfang März auf dem Eis des Sankt-Lorenz-Golfs ihre Jungen zur Welt bringen, können Besucher dort schneeweiße Jungtiere besuchen und sogar anfassen.
Während der Hummersaison bringt Hotelchef Robert St-Onge seinen Gästen bei, wie ein Hummer richtig geknackt und verspeist wird. Jetzt, im Spätsommer, ist Makrelenzeit, also zeigt er ihnen, wie man mit der Handleine Makrelen fischt. St-Onge liebt es, Urlaubern die Insel nahezubringen, sei es zu Fuß oder mit dem Rad.

Oder er schickt sie auf eine Kajak-Tour in die Sandsteinhöhlen. Im Neoprenanzug paddeln die Gäste vom Strand zu den von der Brandung ausgewaschenen Grotten. Wer sich traut, springt ins Wasser, schwimmt und klettert im Halbdunkel der Höhlen. Roter Stein und türkisblaues Wasser. Die Guides Michel, Élouard und Étienne, noch keine zwanzig Jahre alt, sind von der Insel. Hier weggehen? Höchstens zum Studieren. Sie wollen hier leben, arbeiten, eine Familie gründen. Wie es scheint, haben sie hier ihren Hafen gefunden.