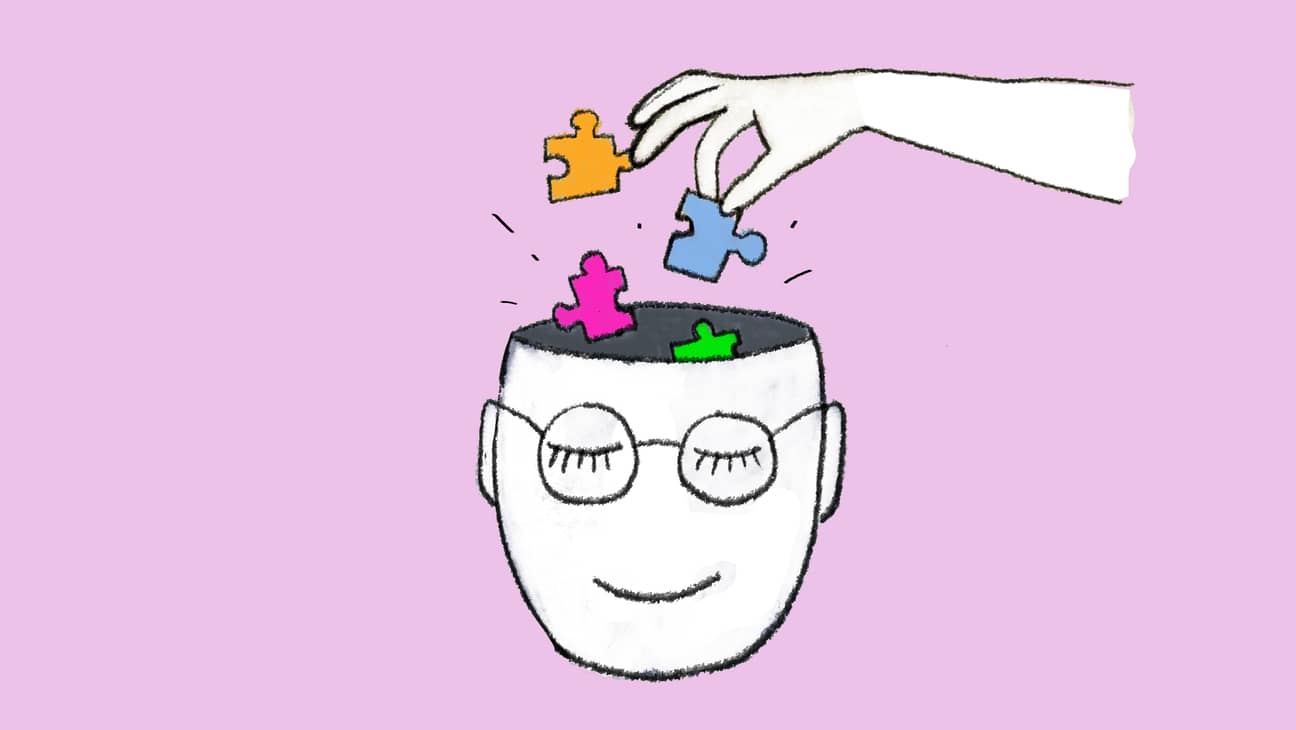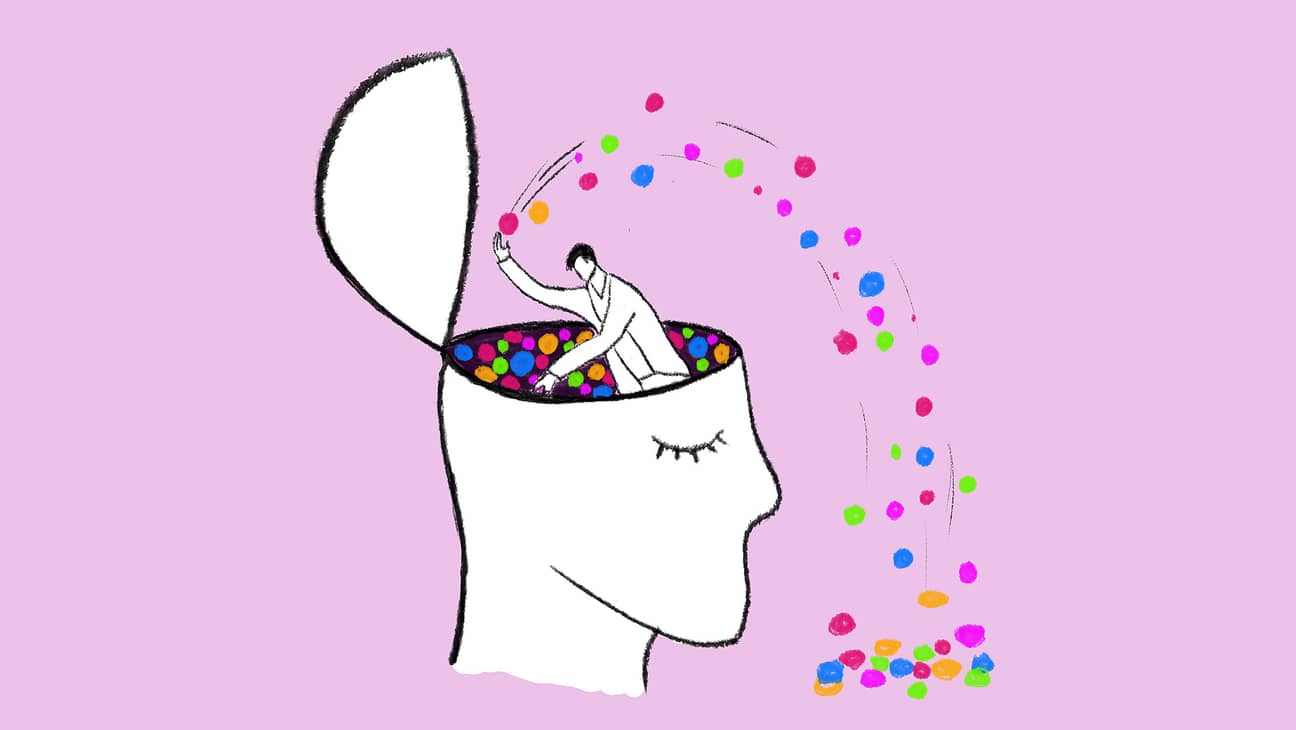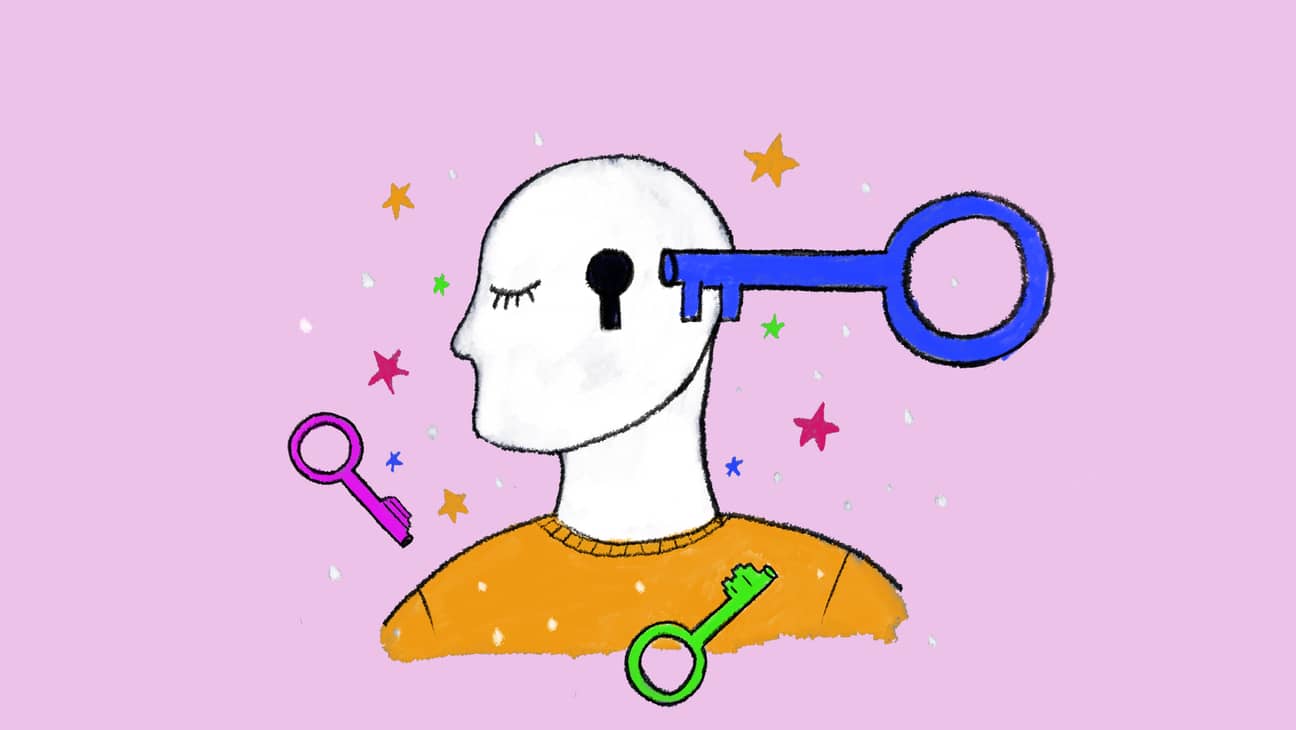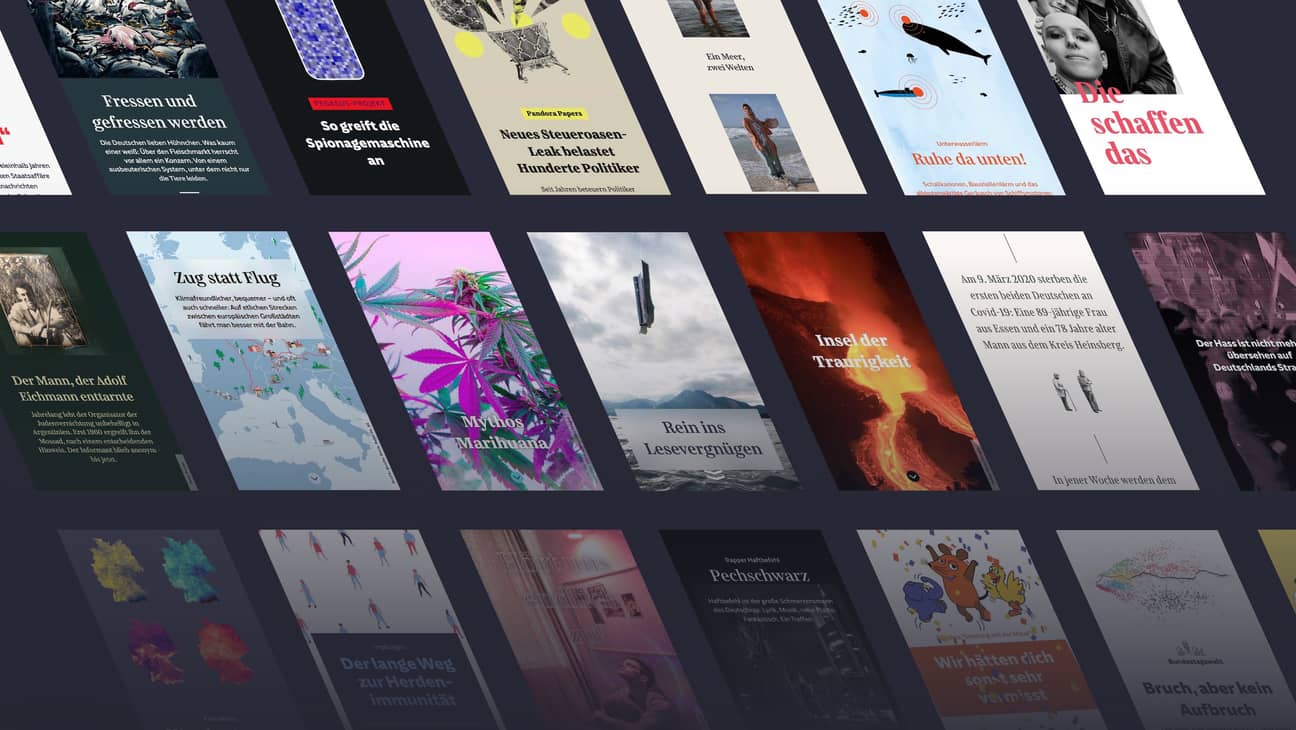Hilfe für die Seele, Teil 8
Apps auf Rezept
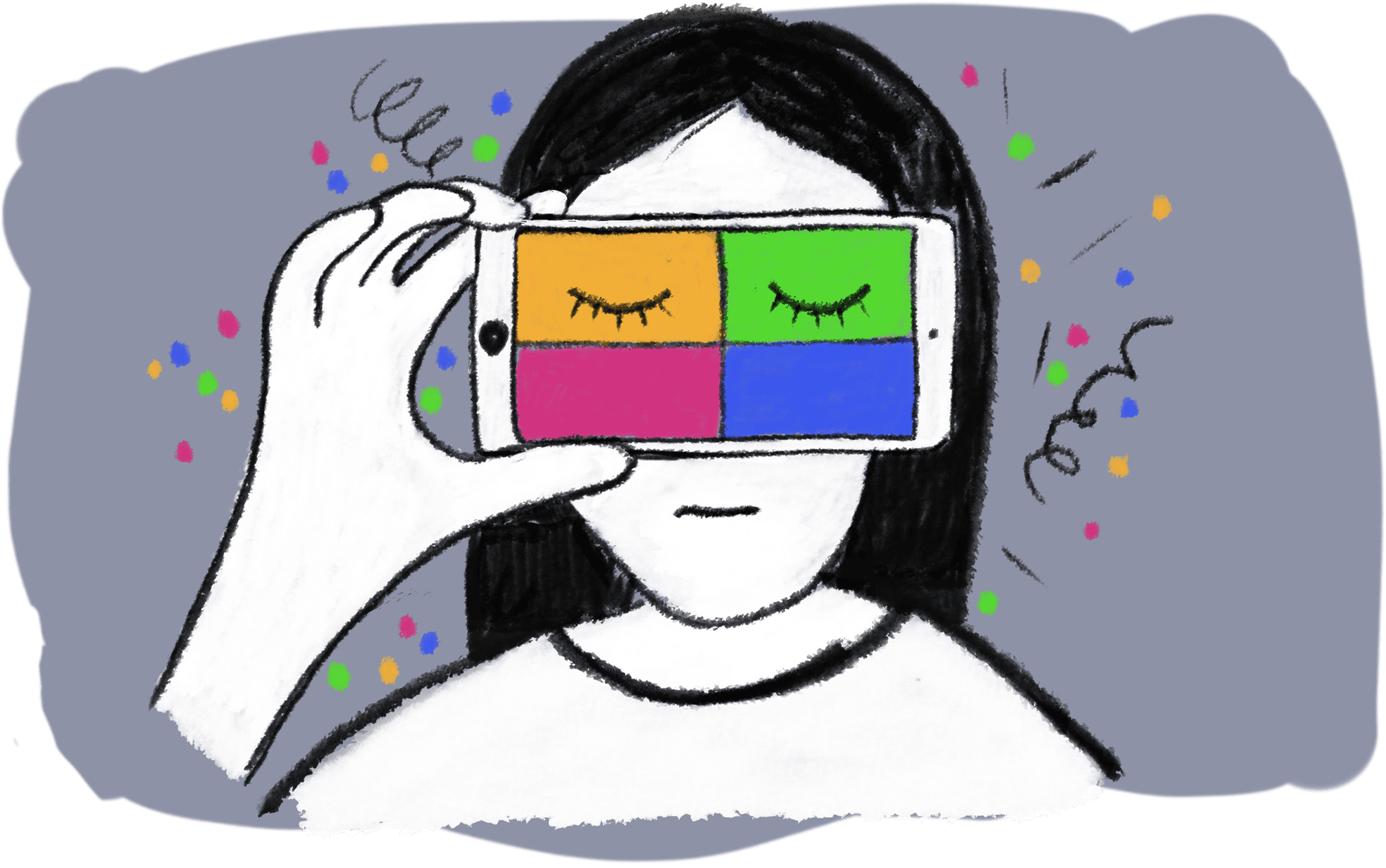
24. November 2022
-
4 Min. Lesezeit
Digitalisierung ist ja so ein Wort, das beinahe immer vorkommt, wenn es um Fortschritt, Entwicklung und die Zukunft geht und bei dem dann aber meist im Vagen bleibt, was damit überhaupt gemeint ist.