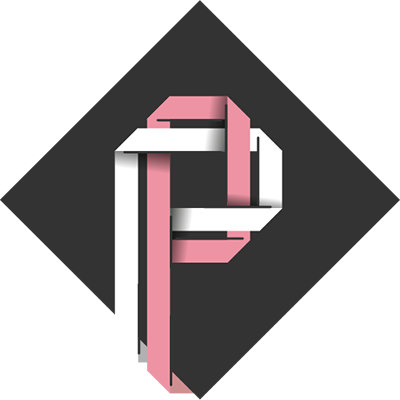Ganz schön abgezockt
Zum runden Geburtstag ließ Paul Gauselmann mehr als 100 weiße Zelte errichten, ein Riesenrad und eine große Bühne, drei Tage lang wurde Anfang September im ostwestfälischen Lübbecke gefeiert. Sein Unternehmen war 60 Jahre alt geworden, aus einem Vertrieb für Jukeboxen und Spielgeräte hat der Unternehmer Deutschlands größten Glücksspielkonzern geschmiedet. Gauselmann und seine Merkur-Spielotheken haben das Gesicht der Innenstädte geprägt, die lachende Sonne im Logo, er selbst wurde zum Milliardär. Heute ist Gauselmann 83 Jahre alt und immer noch Chef seines Imperiums. Der ehemalige Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin von der SPD, adelte ihn in seiner Rede zum Auftakt des Fests: "Sie sind ein Teil der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik."
Das Glücksspielgeschäft, das war einmal ein gut sortierter Monopol-Markt, sauber aufgeteilt zwischen staatlichen Lotterien und Sportwetten, staatseigenen Spielbanken und dem gewerblichen Automatenspiel. Doch seitdem jeder ständig online ist, ist daraus ein kaum zu durchschauendes Geflecht geworden, mit ungezählten Internet-Kasinos, die von Steuerparadiesen wie der Isle of Man aus in rechtlichen Graubereichen um das Geld der Spieler konkurrieren. Der Staat ist heillos überfordert, die strengen Verbote für das Glücksspiel im Netz setzt er seit Jahren nicht durch. Der Internet-Glücksspielmarkt hat sich zu einer Wildwestbranche entwickelt, zu einer Spielwiese für Kriminelle und Geldwäscher, mit tatkräftiger Unterstützung der Finanzindustrie.

Paul Gauselmann konnte diese Entwicklung nicht ignorieren. Er war der Automatenkönig, der Pate des deutschen Glücksspiels, das sollte auch in Zukunft so bleiben. Anhand der internen Unterlagen aus der Kanzlei Appleby lässt sich nun erstmals nachvollziehen, was Gauselmann alles unternommen hat, um den Boom im Online-Geschäft nicht zu verpassen. Sein Vorgehen zeigt, wie einfach es mithilfe findiger Anwälte sein kann, die deutschen Glücksspielgesetze auszuhebeln.
Gauselmanns Vorstoß in die Online-Welt beginnt 2008, da kauft er einen Hamburger Spiele-Entwickler, die Edict Egaming. Kaum zwei Jahre später gründet er auf der Isle of Man einen Ableger der Firma namens Edict IoM. Appleby-Anwälte entwickeln für die neue Tochterfirma Geschäftsbedingungen und Lizenzvereinbarungen, sie bekommt eine Genehmigung von der Glücksspielaufsicht in der Inselhauptstadt Douglas. Auf Anfrage bestätigt die Gauselmann-Gruppe dieses Vorgehen und schreibt, man habe "lediglich eine Vertriebsorganisation auf der Isle of Man geschaffen, die nach den dortigen Bestimmungen ordnungsgemäß lizenziert ist". Gauselmanns Einstieg ins Online-Geschäft ist von da an aufs Engste mit der Isle of Man und mit Appleby verbunden.