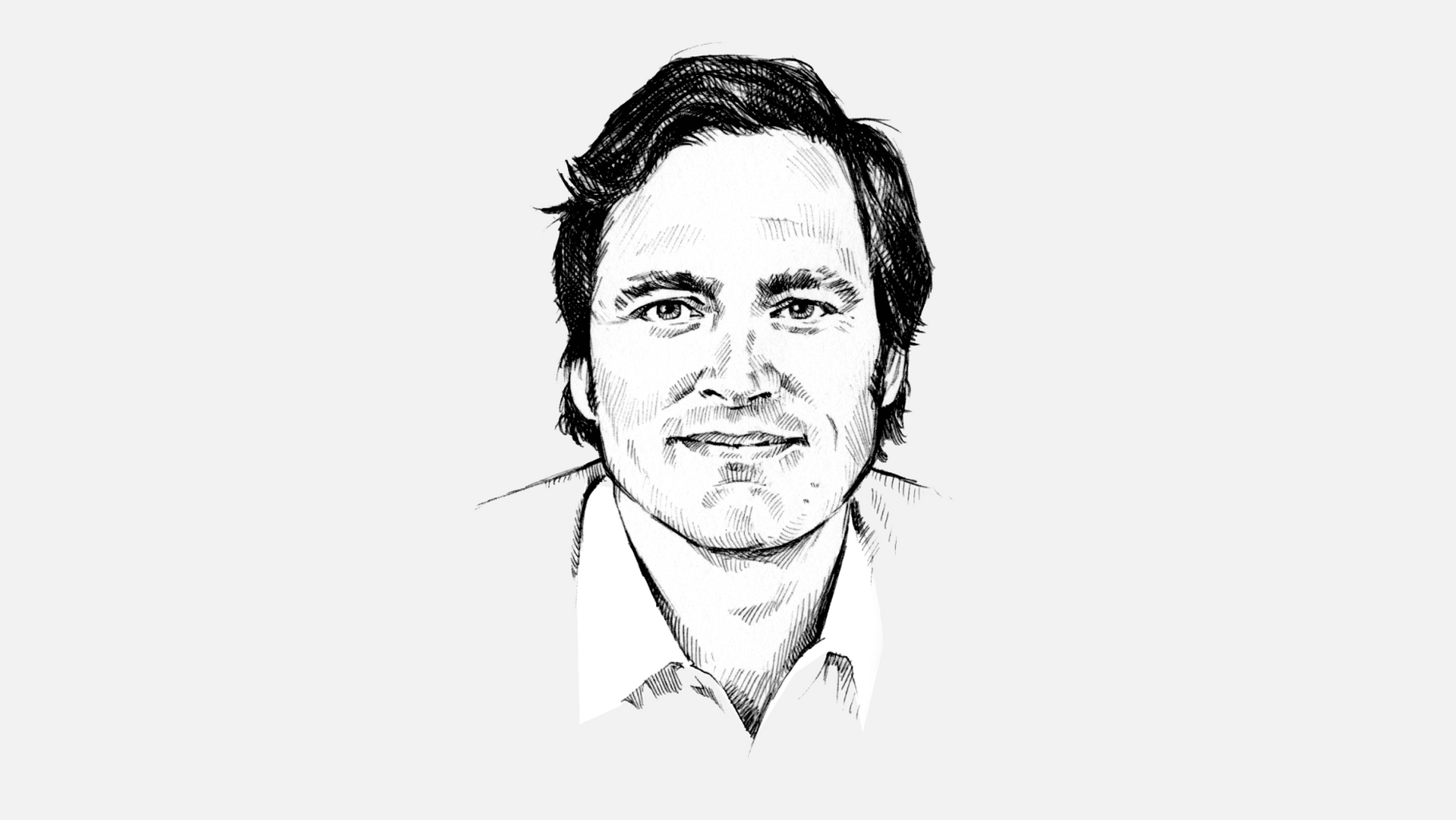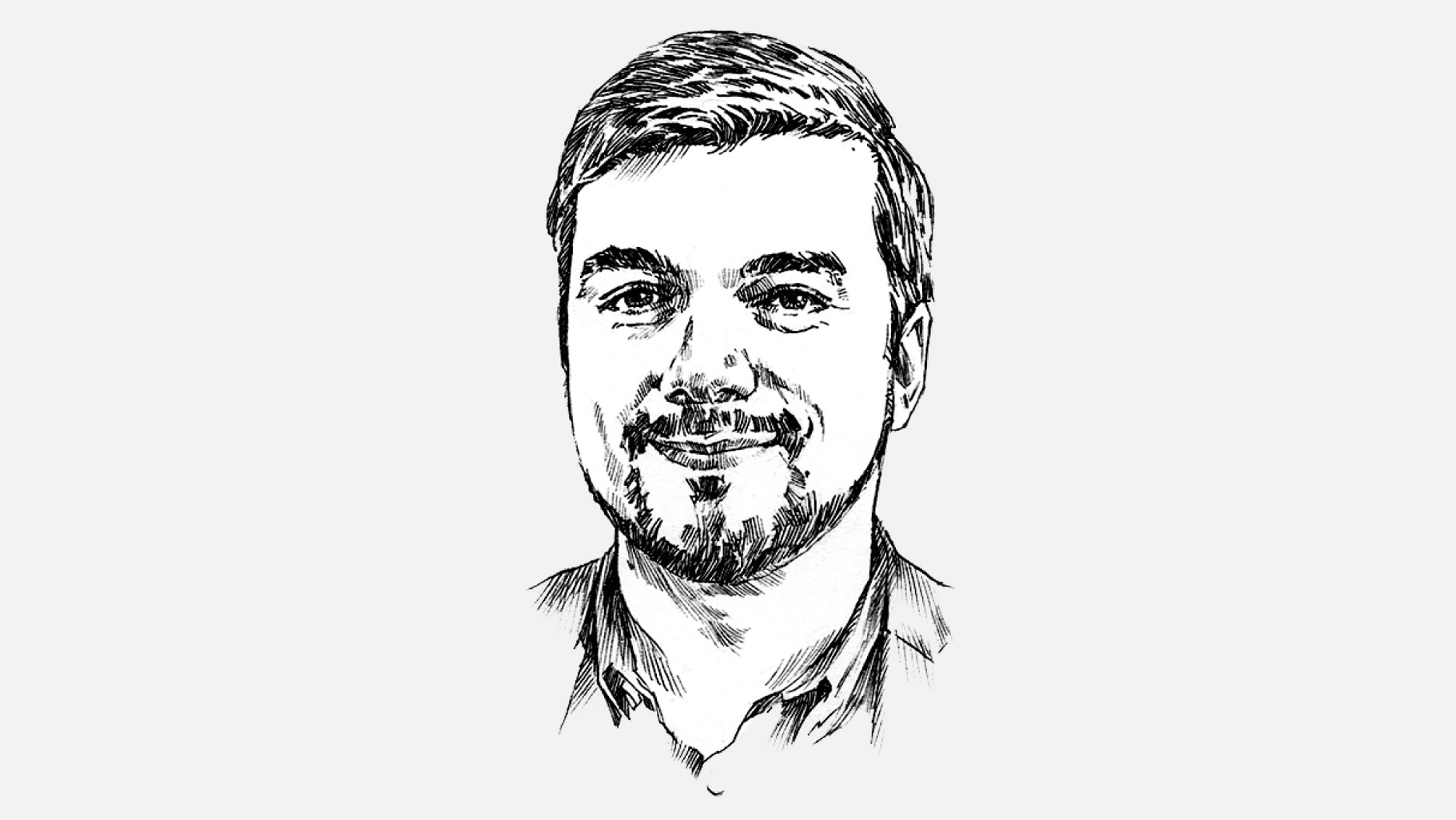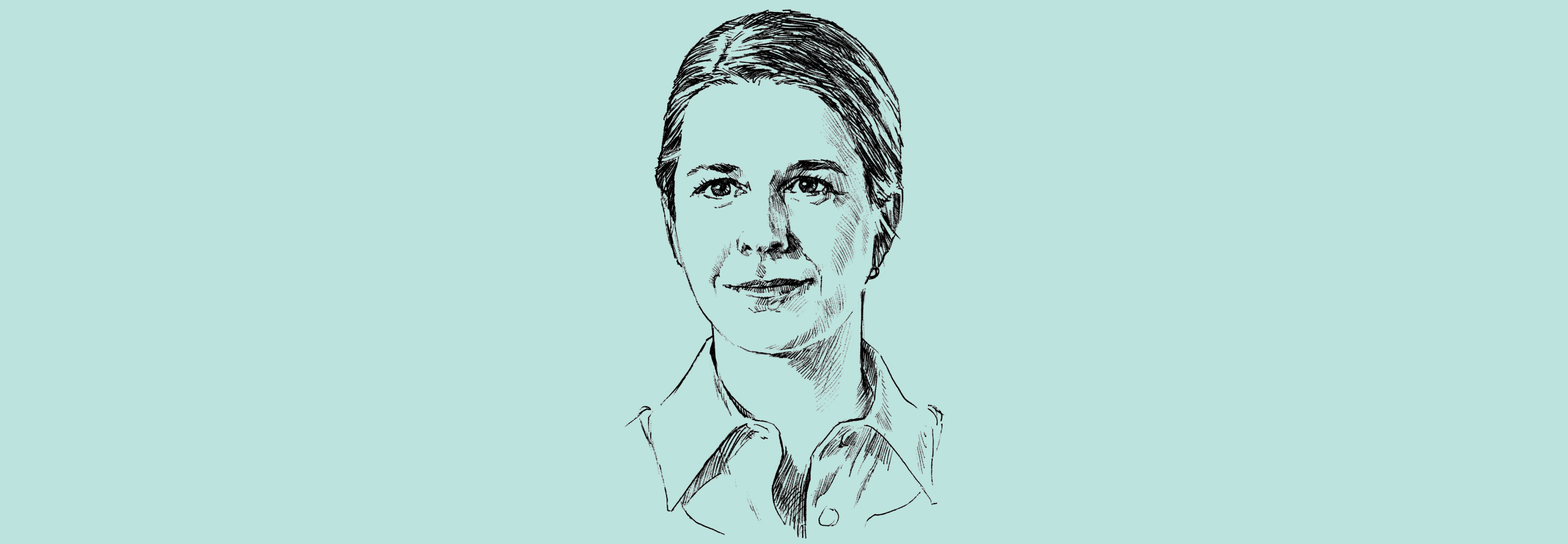
Transparenz-Blog
Warum verzichtet die SZ auf das Sternchen?
Sprache ist etwas Lebhaftes, täglich wird sie um neue Wörter bereichert. Im aktuellen Duden finden sich zum Beispiel erstmals das „Gendersternchen“ (und der „Männerdutt“). Die „Kammerjungfer“ oder die „Vorführdame“ hat das Standardwerk der deutschen Rechtschreibung vergangenes Jahr hingegen gestrichen. Sie sind veraltet. Das „Fräulein“ ist bereits vor fünfzig Jahren verschwunden, das Bundesinnenministerium hat es aus dem Amtsdeutsch entfernen lassen. Vorangegangen war dieser Entscheidung eine „Genderdebatte“, wie wir es heute nennen würden. Schon im Nachkriegsdeutschland stritt man über den richtigen Sprachgebrauch.
Das Ringen hält bis heute an. Durch die Political Correctness und die sozialen Medien ist die Diskussion um eine diskriminierungsfreie Sprache für viele von den Rändern gar ins Zentrum gerückt. Immer wieder fragen auch Leserinnen und Leser bei der Süddeutschen Zeitung nach, wie die Redaktion zur gendergerechten Sprache steht: Warum verzichtet die SZ auf das Sternchen? Was hält sie vom Binnen-I? Oder: Wie bezeichnet sie queere Personen?
Zeitungen haben eine Vorbildfunktion, was Sprache angeht. Sie sollten so schreiben, dass die Texte für möglichst viele (im Idealfall alle) Leserinnen und Leser verständlich sind. Das gilt insbesondere für eine „Familienzeitung“, als die sich die SZ versteht – also ein Blatt, das grundsätzlich Eltern, Kinder und Großeltern ansprechen will. Wenn Jugendliche eine Zeitung lesen, sollten sie dort nicht auf eine Sprache oder Rechtschreibung stoßen, die ihnen in der Schule als Fehler angekreidet würde.
Schon deshalb pflegen die Autorinnen und Autoren der Süddeutschen Zeitung eine sorgfältige, verständliche und nicht verletzende Sprache. Wir formulieren achtsam und vermeiden Diskriminierungen, ohne Fragen von Lesbarkeit, Lesefluss, Tradition, Schönheit und Eleganz zu vernachlässigen. Der SZ-Journalismus setzt immer bei den Inhalten an und nicht bei der Sprache über die Inhalte.
Die Süddeutsche Zeitung lebt von und mit der Sprache; verändert sich diese, diskutiert auch die Redaktion über den Umgang mit der Veränderung. Zur gendersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache haben wir uns nach einem intensiven Austausch auf eine Praxis verständigt, die für alle Beiträge in Schrift, Bild und Ton gelten soll. Es ist eine Momentaufnahme – im Wissen, dass sich Sprache wandeln und weiterentwickeln wird.
Eine gendersensible Sprache ist für die SZ keine Frage von Sonderzeichen. Diese sind umstritten, weil sie nach Ansicht sehr vieler Leserinnen und Leser den Blick auf die Sprache über die Dinge statt auf die Dinge selbst lenken. Die SZ verzichtet deshalb auf Schreibweisen mit Gendersternchen (Mitarbeiter*innen), Binnen-I (MitarbeiterInnen), Unterstrich (Mitarbeiter_innen) oder Doppelpunkt (Mitarbeiter:innen). Sie stützt sich dabei auch auf den Rat für deutsche Rechtschreibung, der das amtliche Rechtschreibe-Regelwerk herausgibt und die Aufgabe hat, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu wahren.
Die Journalistinnen und Journalisten der SZ verwenden die weibliche und männliche Form (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), ohne ihre Beiträge durchgendern zu müssen. Erwünscht sind auch neutrale Formulierungen (Angestellte). Die SZ legt zudem Wert darauf, Rollenklischees (Arzt und Krankenschwester) und rein geschlechtsspezifische Berufsbezeichnungen (Feuerwehrmänner) zu vermeiden.
Nicht-binäre Menschen möchten oft nicht mit weiblichen oder männlichen Pronomen beschrieben werden. Im Deutschen werden nicht-binäre Menschen deshalb bislang sprachlich sehr unterschiedlich behandelt. Die SZ spricht sich für eine durchgehende Verwendung des Namens oder neutrale Formulierungen aus. Besteht eine non-binäre Person, eine Gastautorin oder ein Kolumnist auf der Verwendung eines Sonderzeichens, werden die Hintergründe dazu im Beitrag oder in der Fußnote thematisiert.
Sprache geht mit der Zeit. Über richtiges Sprechen und Handeln wird weiter gerungen werden. Die SZ wird die Debatten auch künftig journalistisch begleiten.