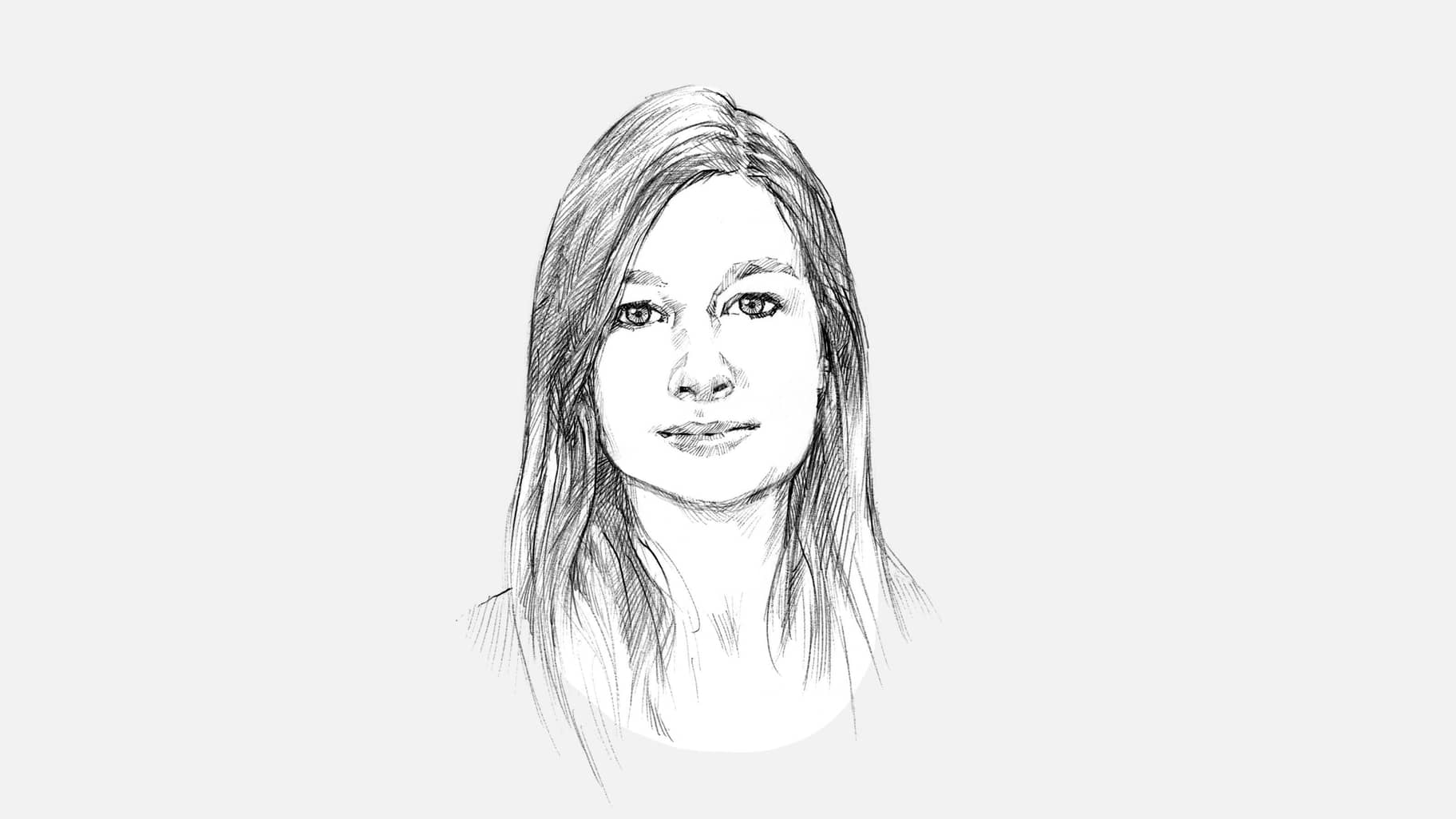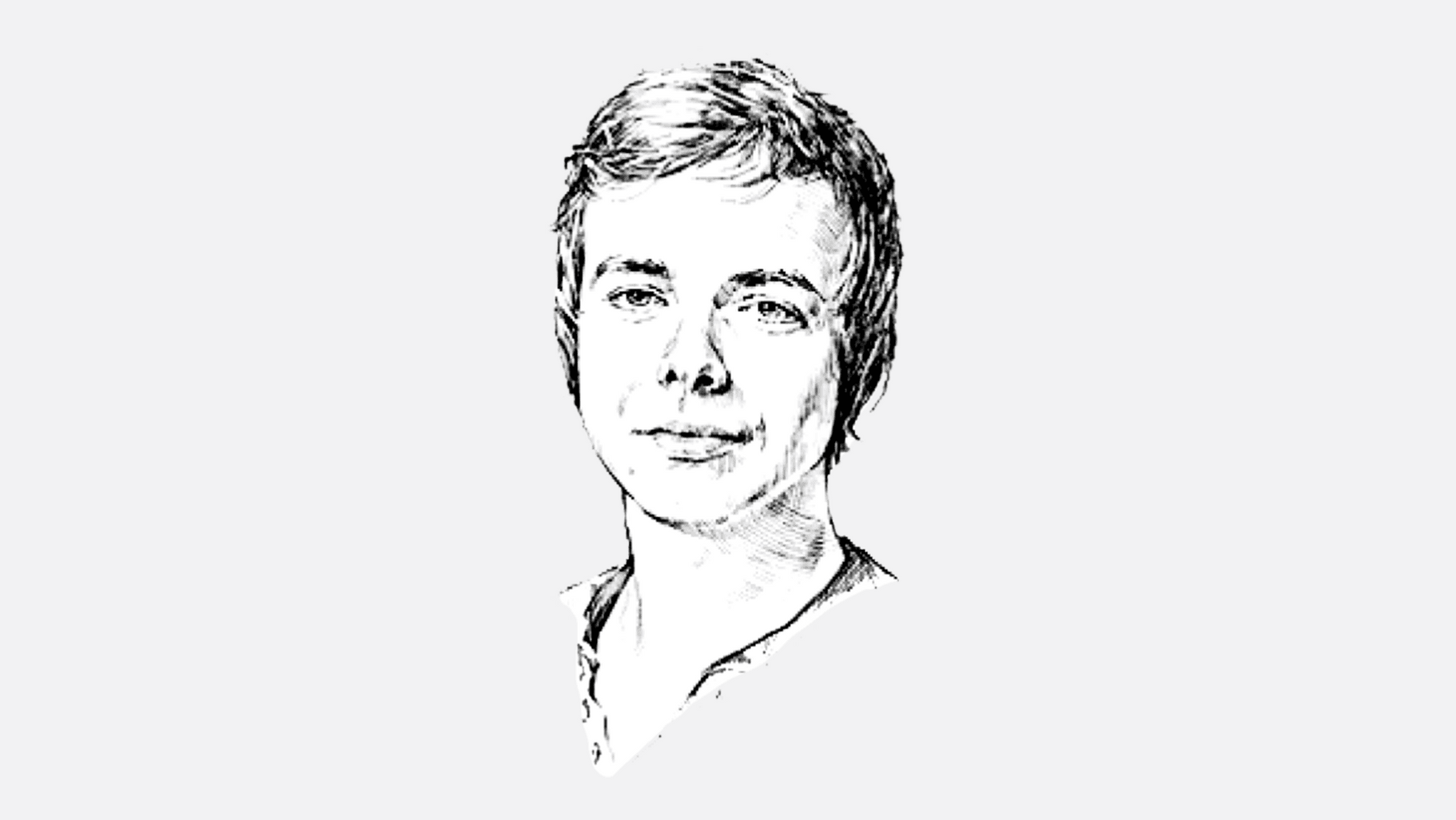Transparenz-Blog
Wie sieht der journalistische Arbeitsalltag in der Ukraine aus?

Mitten im Gespräch merkt der Unternehmer aus Luzk (Westukraine) an: „Sie haben doch sicher eine Mission“, sagt er. „Welche?“ Er ist ein tatkräftiger, vorausschauender Agrarmanager, der sich früh um alternative Routen für Weizen, Soja und Raps bemüht hat, die jetzt, da Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert, ausgebaut werden. Der Transport seiner Lieferungen mit der Bahn durch Polen und andere europäische Länder zu den Häfen in Rotterdam und Bremerhaven, um den Hunger der Welt zu stillen, müsse doch auch im Sinne Deutschlands sein und damit, so legt er nahe, im Sinne der deutschen Medien.
Es ist ein Irrtum, auf den man nicht nur in der Ukraine stößt. Dass internationale Berichterstatterinnen oder Berichterstatter die gleichen Ziele haben wie die Menschen in der Ukraine oder sogar die ukrainische Regierung. Sie beruht auf der Beobachtung, dass Zeitungen wie die SZ, Fernseh- oder Radiosender dem heimischen Publikum die Brutalität des russischen Überfalls vor Augen führen. Und da zu diesem Publikum auch Politikerinnen und Politiker gehören, übersetzt sich die Berichterstattung in zwingende Argumente für alle Arten von Unterstützung, die sogenannten „schweren Waffen“, die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, Lieferungen von Medikamenten oder Feuerwehrautos.
So oder so ähnlich sieht es der Unternehmer in Luzk. So oder so ähnlich sehen es viele Ukrainer. Und haben sie nicht recht? Ist Russlands Krieg nicht tatsächlich brutal und expansiv? Stimmen die Interessen der Journalisten und der Ukraine etwa nicht weitgehend überein? Dass auf die Bejahung der ersten Frage nicht zwangsläufig die der zweiten folgt, muss man oft erst erklären. Es hilft – wie im Falle des sympathischen Unternehmers in Luzk –, wenn man erläutert, dass deutsche Zeitungen wie die SZ keine von außen oder „von oben“ diktierte „Mission“ haben, weil sie nicht staatlich sind, oder drastischer: „Die SZ ist nicht die russische Rossijskaja Gaseta.“ Dieser Unterschied leuchtet den meisten ein.
Die Erwartungen an jeden, der aus der Ukraine berichtet, sind groß, zumal die Gesprächspartner oft Furchtbares erlebt haben. Anders als man denken könnte, scheinen die Augenzeugen oder Opfer von Folter oder Vergewaltigung geradezu darauf gewartet zu haben, dass ihre Geschichte gehört wird. Unter den aus Irpin in Sicherheit gebrachten Menschen etwa war ein Ehepaar, beide Mitte 60, das den Schrecken benennen wollte.
Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich die Berichterstattung aus der Ukraine von anderen Einsätzen. Der Flugverkehr ist eingestellt, man reist mit Auto oder Zug. Für die Rechercheplanung muss man sich einen Überblick über mehr oder weniger gefährliche Berichtsorte verschaffen. Viele Informationen sind schwer oder gar nicht zugänglich, weil das Risiko zu groß ist. Auf jeder Strecke schleppt man schwere Sicherheitskleidung und viel Technik mit, für den Fall, dass das Internet ausfällt. Die Konkurrenz durch andere, oft solventere internationale Medien ist gewaltig. Das betrifft nicht nur den Wettbewerb um Interviews mit hochrangigen Gesprächspartnern, die lieber mit der englischsprachigen New York Times reden möchten. An der syrisch-türkischen Grenze gab es irgendwann kaum noch syrische Medienmitarbeiter, weil große Sender wie die britische BBC alle an sich gebunden hatten. In der Ukraine ist das derzeit nicht zu befürchten. Ehemalige Tourismusexperten, Studenten, Journalisten bieten ihre Dienste in Chatgruppen an. So lässt sich in einem wirtschaftlich gebeutelten Land Geld verdienen. Durch die Unterstützung internationaler Journalisten könne er dem ukrainischen Sieg dienen, so ein junger Ukrainer.
Mehr noch als die Pandemie oder der Klimawandel wirft der Krieg die Frage nach der Objektivität von Journalisten auf. Muss man angesichts der Verbrechen in Butscha oder Borodjanka nicht „Farbe bekennen“ oder „Position beziehen“ – für die Ukraine? Kann es bei Massakern überhaupt so etwas wie „Objektivität“ geben? Wo Täter und Opfer so klar benannt werden können, kann man damit nichts falsch machen, oder? So einleuchtend die Forderung nach einem engagierteren Journalismus oft klingt – sie ist erfahrungsgemäß in Kriegsgebieten riskant. Wie würde man mit Informationen von Kriegsverbrechen der Ukraine umgehen? Müsste man sich die Informationspolitik der ukrainischen Regierung unter dem Kriegsrecht zu eigen machen? So unerreichbar völlige Neutralität auch sein mag, gerade in Kriegen ist das Bemühen um Distanz das wichtigste Werkzeug für Journalisten.