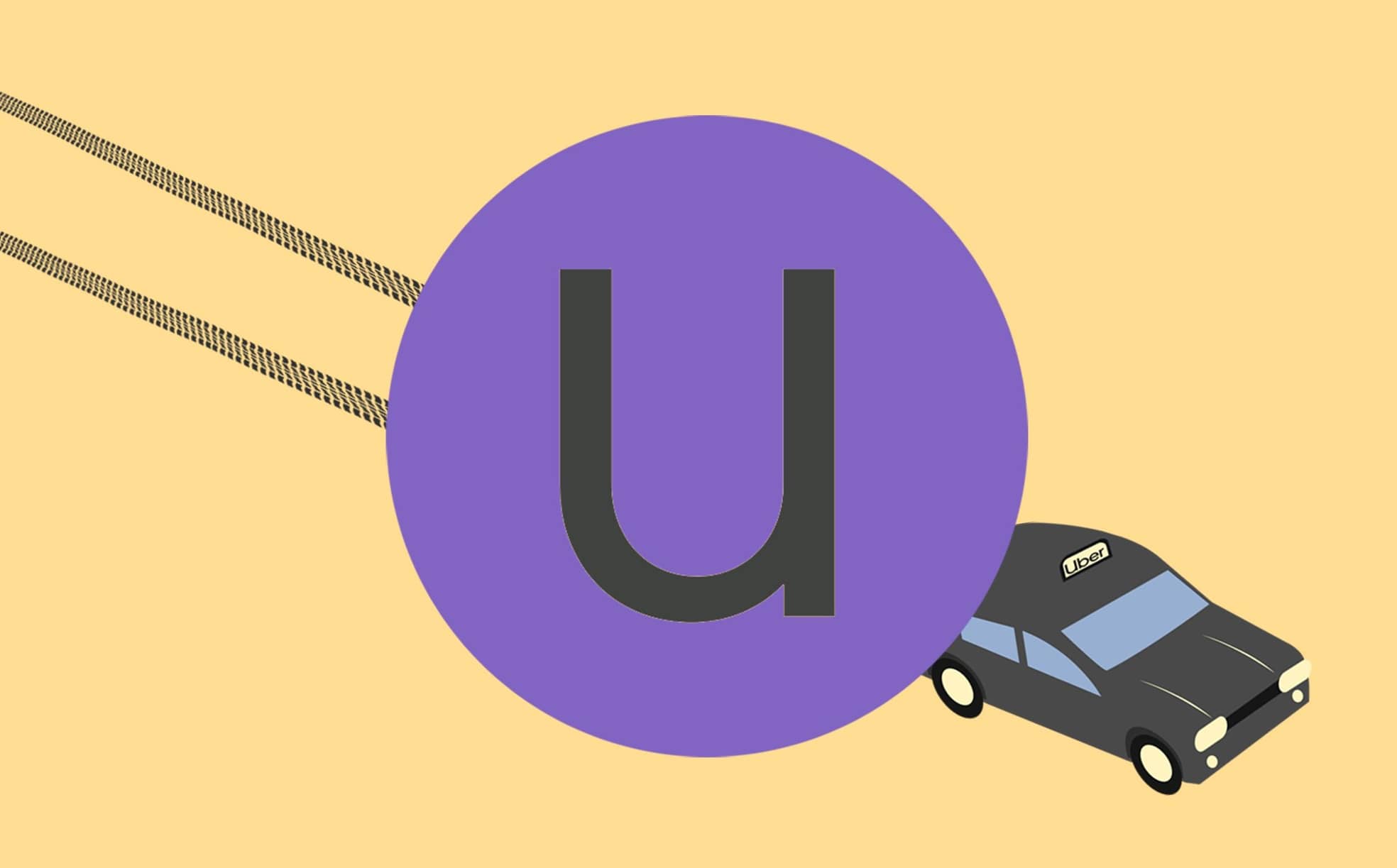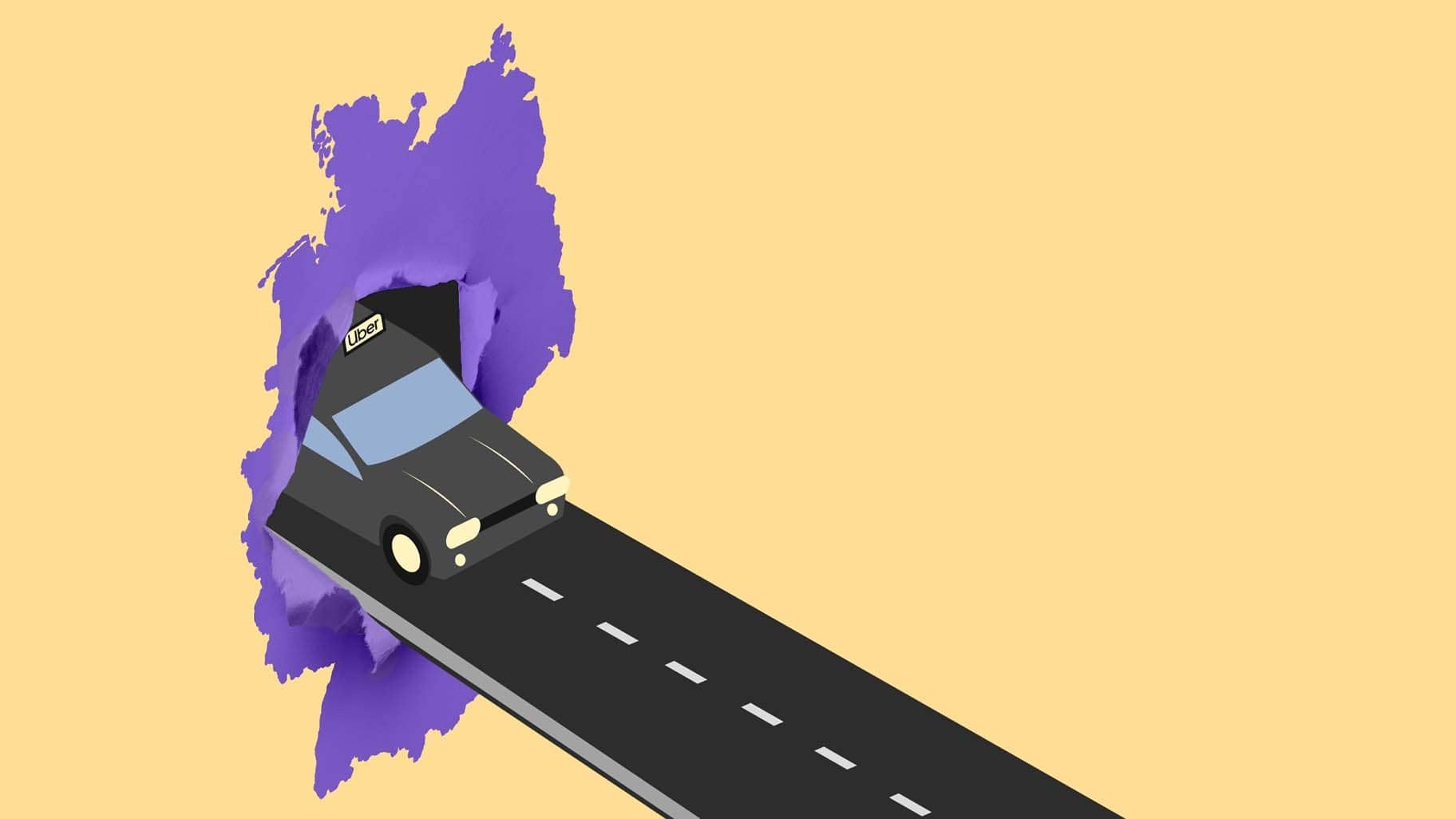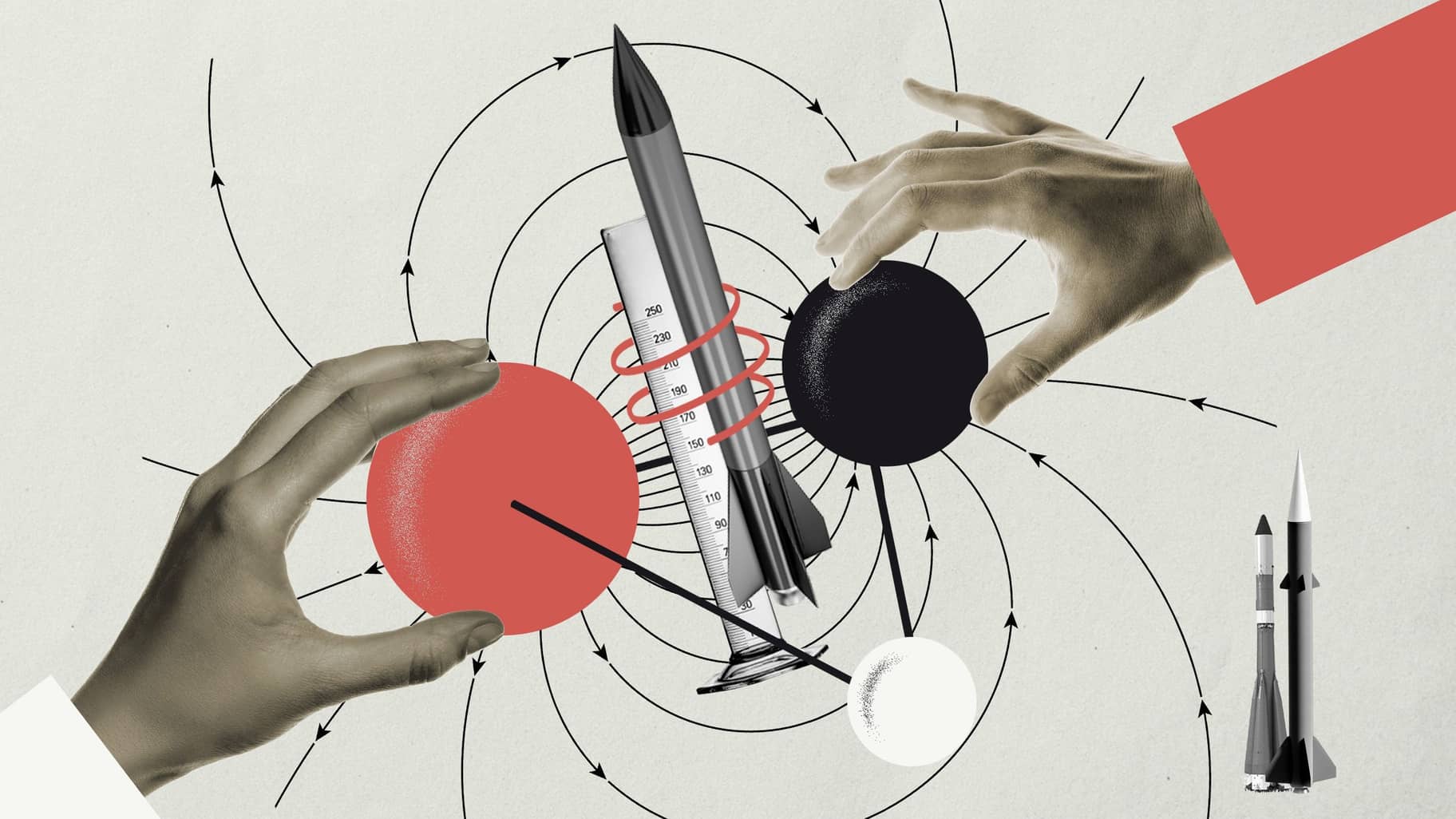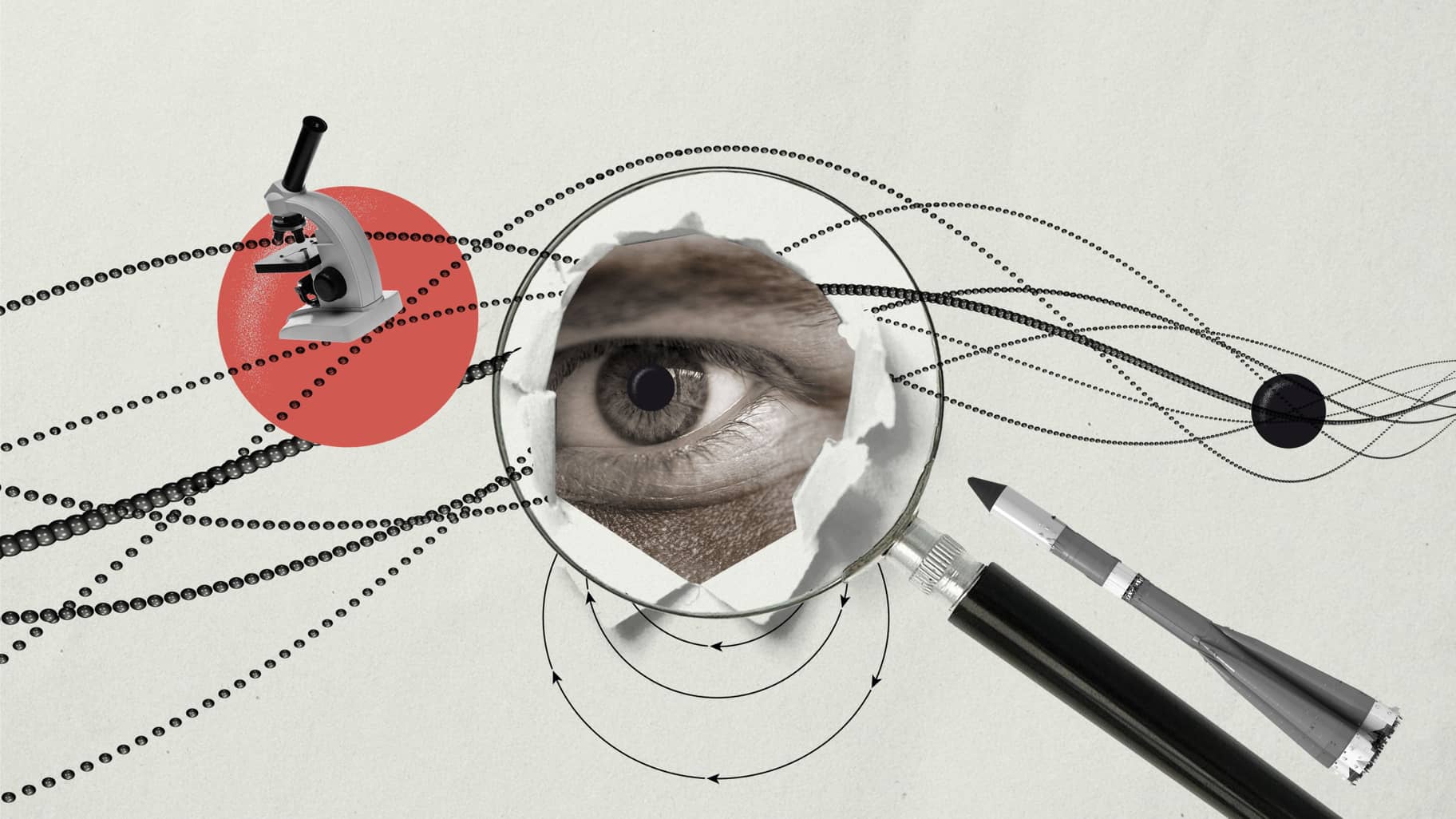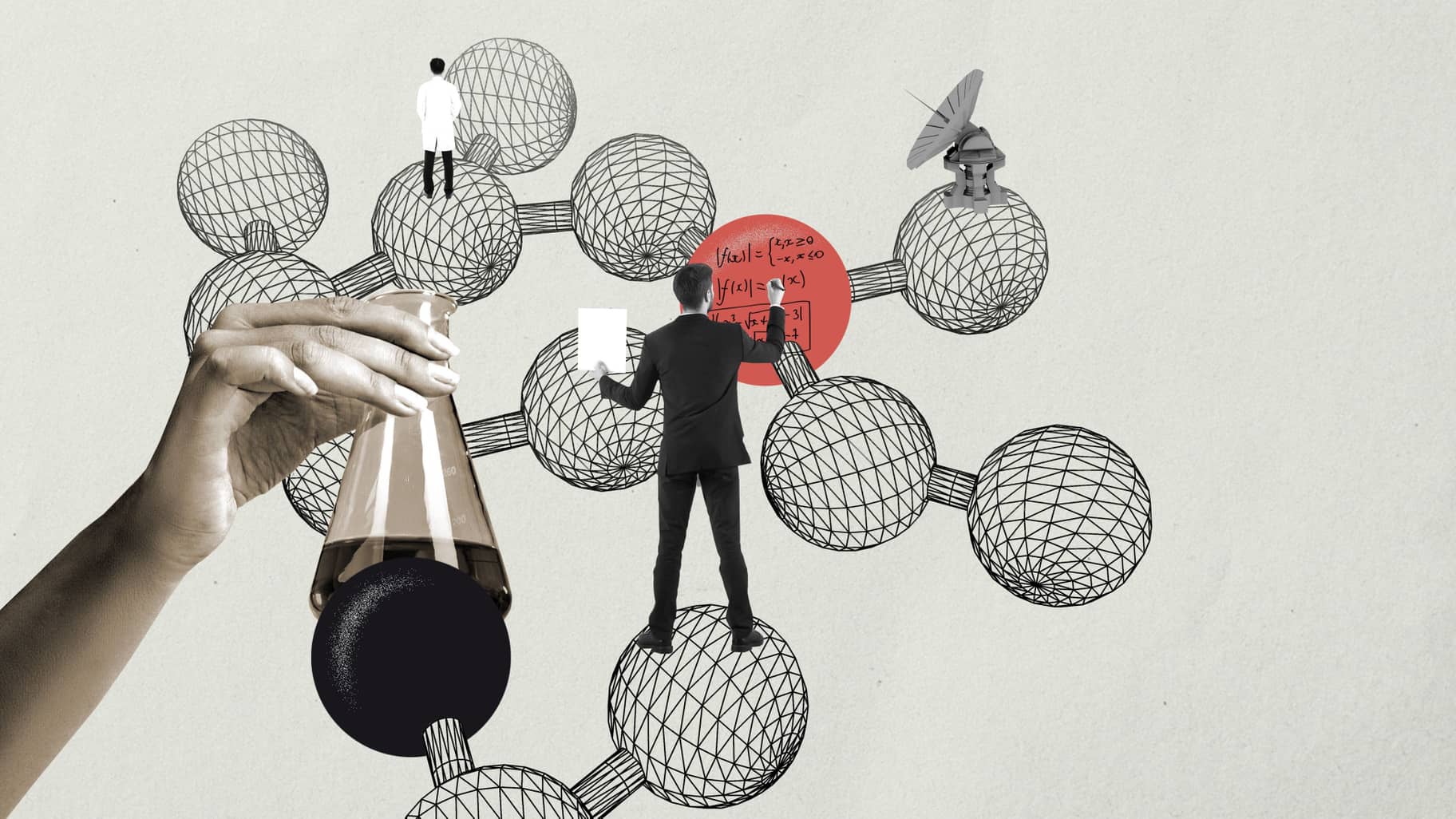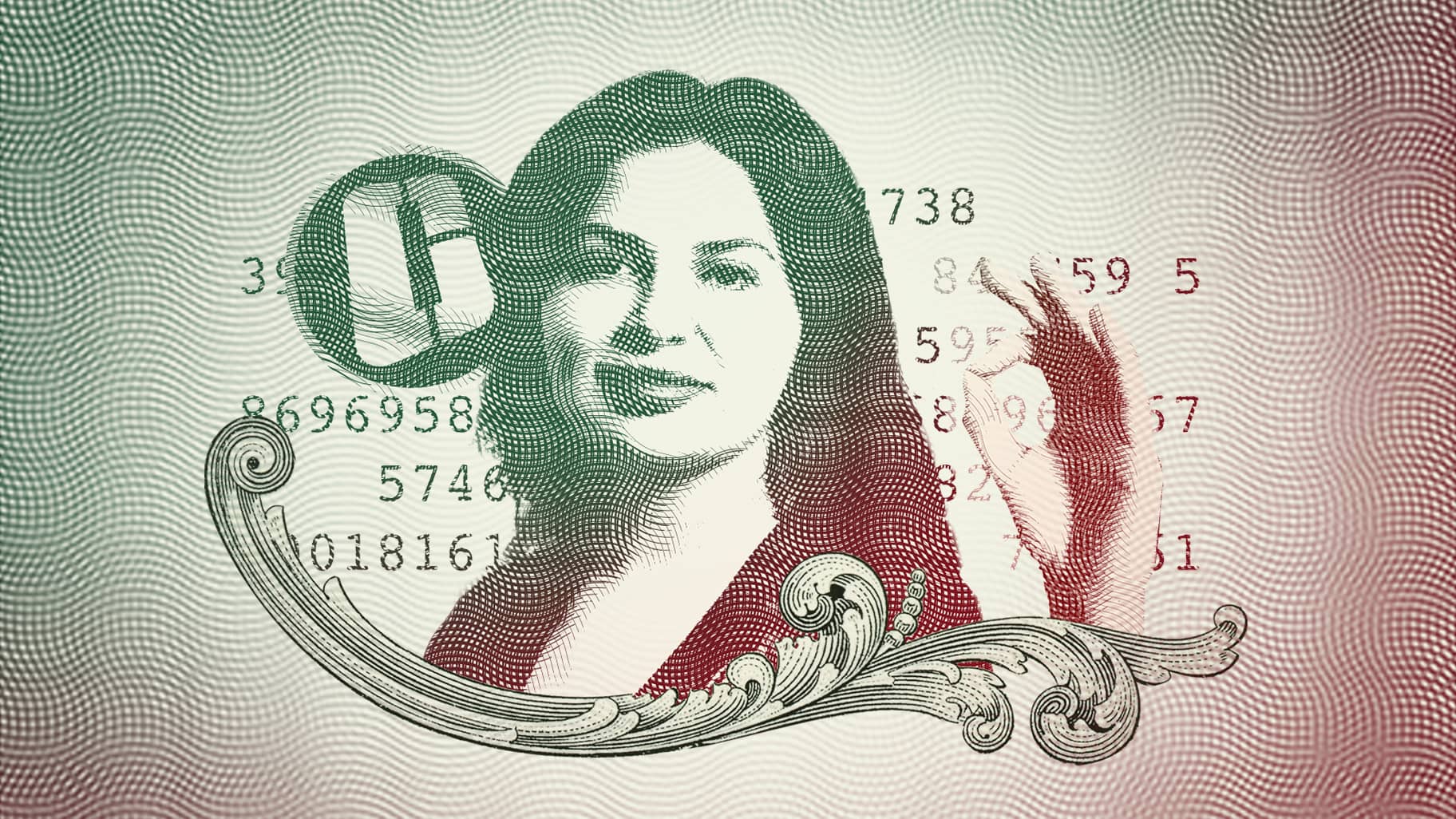Investigativprojekt
Was man über die Uber Files wissen muss
10. Juli 2022
Was sind die Uber Files?
Es handelt sich um mehr als 124 000 Dokumente aus dem Unternehmen Uber, das über eine Smartphone-App Fahrer und Kunden miteinander zusammenbringt und dafür eine Gebühr bekommt.