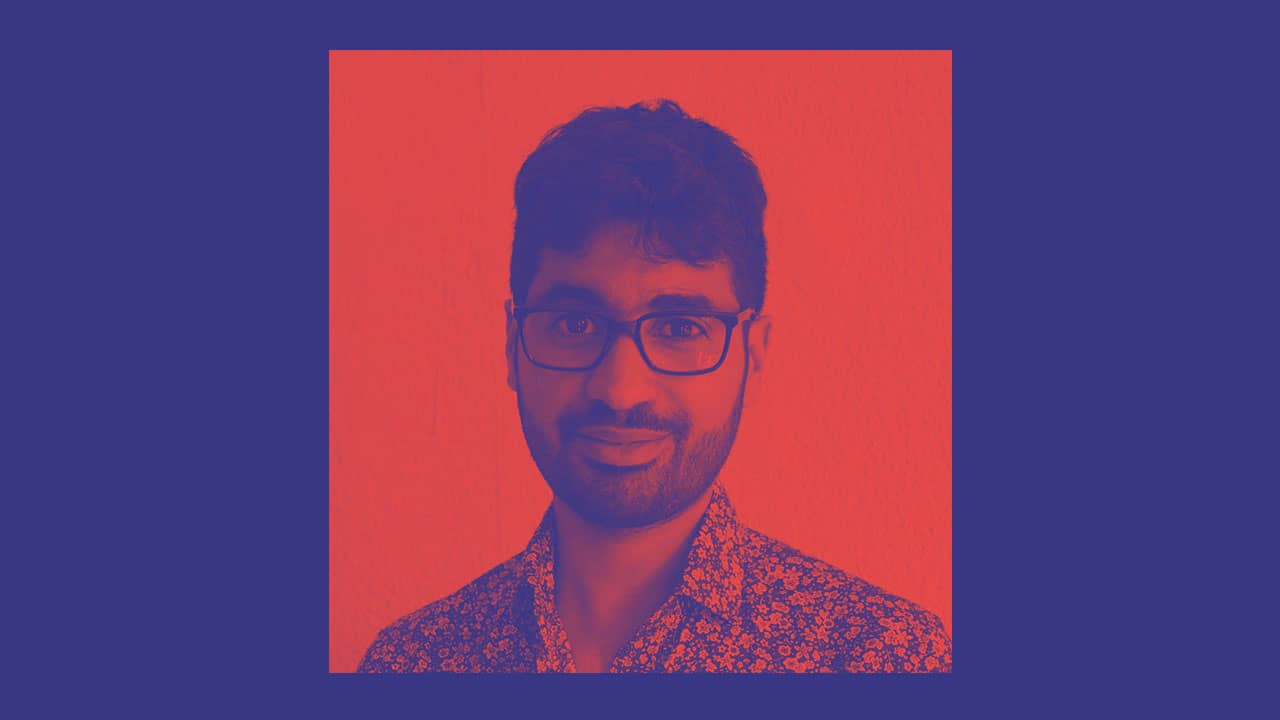SERIE: "WAS SICH ÄNDERN MUSS"
Die zweite Chance kommt meistens nicht
Wie gelingt vielfältiger Journalismus? Vanessa Vu erklärt, warum PoC im Journalismus so schnell auf bestimmte Rollen festgelegt werden - und wie schwierig das für junge Menschen ist.
In der Serie „Was sich ändern muss“ sprechen Medienschaffende aus ganz Deutschland darüber, was Redaktionen gegen rassistische Strukturen tun können und wie Journalismus diverser werden kann. In der dritten Folge erklärt Vanessa Vu, wie problematisch das Festlegen auf Rollenmuster für junge Journalistinnen sein kann. Vu, Jahrgang 1991, ist Redakteurin im Ressort X von „Zeit Online“ und widmet sich dort Reportagen, Essays und Interviews.
Als ich vor zwei Jahren den Theodor-Wolff-Preis gewonnen habe (eine der wichtigsten Auszeichnungen im Journalismus, Anm. d. Red.), wurde ich auf die Bühne gebeten, um ihn entgegenzunehmen. Allen anderen Preisträgern wurden an diesem Abend mehrere Fragen zu ihrer Motivation gestellt. Die einzige Frage an mich war, ob ich mich auch für andere Themen interessieren würde – andere Themen als Migration.
Ich glaube, dass Migrationsthemen generell als Themen zweiter Klasse behandelt werden. Viele Journalistinnen und Journalisten sehen überhaupt nicht, dass sie mindestens genauso komplex sind wie zum Beispiel der Klimawandel. Deswegen hat die Washington Post kürzlich zwölf Redakteurinnen und Redakteure zum Thema „race“ eingestellt. Zwölf – und nicht nur einen. Weil das Thema so viele Tangenten hat, historische, kulturelle, ökonomische, politische, gesellschaftliche.
Wer bestimmte Texte schreibt, „Ich“-Geschichten zum Beispiel, oder Texte über Diskriminierungen, wird gern in eine Ecke geschoben. Du hast einen wütenden Text geschrieben? Dann giltst du als zu emotional. Du hast biografisch argumentiert? Dann giltst du als persönlich befangen. Die zweite Chance kommt meistens nicht.
Was dem Journalismus fehlt: eine Fehlerkultur
In Redaktionskonferenzen wird dann mit den Augen gerollt, die Kolleginnen denken – und sagen vielleicht auch: „Die Person schreibt ja nur über sich.“ Kaum jemand denkt darüber nach, dass Ich-Geschichten oder Kommentare vielleicht die einzige Chance für Menschen sein können, überhaupt im Journalismus Fuß zu fassen. Es gibt so viele junge Autorinnen of Colour, die so viel mehr könnten, aber nicht die Chance dazu bekommen. Und die Aufträge zu Texten, in denen sie als „Betroffene“ sprechen, oft deshalb annehmen, weil es kaum andere gibt.
Redaktionen müssen den Mut aufbringen mit Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie viele weiße Akademikerkinder, zu arbeiten und in sie zu investieren. Auch auf das Risiko hin, dass es vielleicht nichts wird – oder erst nach ein paar Anläufen. Wofür es wiederum etwas bräuchte, das dem Journalismus hierzulande oft fehlt: eine echte Fehlerkultur. Wir müssen akzeptieren, dass Menschen an unterschiedlichen Punkten im Leben starten und mit ihren Aufgaben wachsen. Den Prozess zu begleiten kostet Ausdauer, Zeit und Geld. Diese Dinge bringen manche schon von zuhause mit, das ist natürlich bequem für Arbeitgeber. Andere konnten sie sich nie leisten.
Was ich mir wünsche, sind neue Perspektiven, neue Erzählungen, und dass die von Redaktionen gefördert werden. Viele Reportagen hören sich gleich an, weil sie aus dem immer gleichen Blickwinkel geschrieben werden – männlich, weiß, privilegiert. Ich will sehen, was eine schwarze Reporterin sieht. Ich will den Gedanken einer Transperson folgen. Und ich will mehr von Menschen hören, die arm aufgewachsen sind oder eine Behinderung haben – und zwar nicht nur zu ihrer eigenen Gefühlswelt, sondern auch zur deutschen Innen- oder Außenpolitik. Gerne aus ihrer Perspektive heraus. Das täte dem Genre der Reportage so gut. In Zeiten, in denen man mit wackeligen Handyvideos gefühlt überall unmittelbar dabei sein kann, sind es unterschiedliche Perspektiven, die mich packen und mitnehmen.