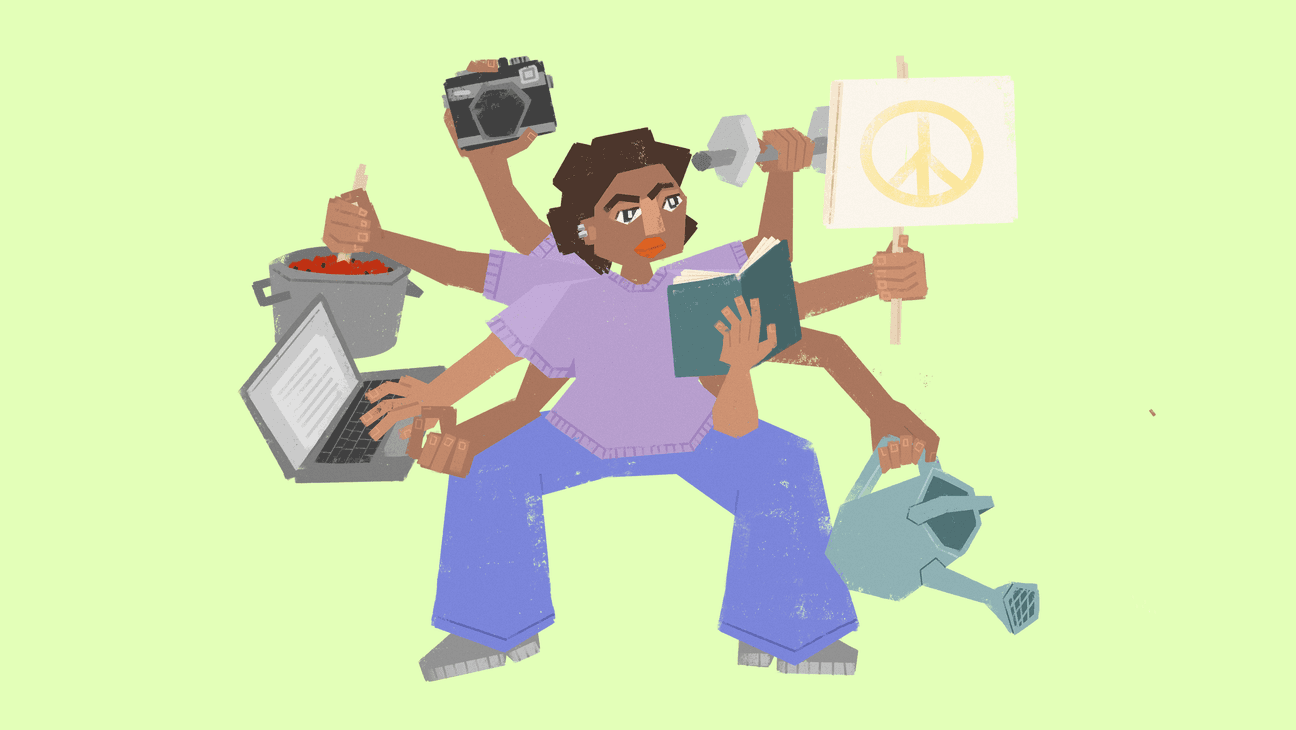Eigentlich gibt es die Klasse 9/21 des Mariupoler Gymnasiums gar nicht mehr. Es ist eine Gemeinschaft, die nur noch auf Handyfotos existiert, in Jahrbüchern und einem Telegram-Chat - weil russische Invasoren Mariupol erst zerschossen und dann besetzt haben.
Das Schulgebäude war beschädigt, die intakten Räume zunächst von russischen Kämpfern als Quartier genutzt worden, Matratzen, Lebensmittel lagen herum, als ein Schüler nach zweieinhalb Monaten Krieg zum ersten Mal zu seiner ehemaligen Schule fährt. Die meisten anderen, die darin gelernt und gelehrt haben – Mathematik, Chemie, Erdkunde und auch Deutsch –, waren entweder in ukrainisches Hoheitsgebiet geflohen oder, noch weiter, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Polen, Griechenland, in die USA. Nur weg vom Krieg, der alle trifft, aber Kinder ganz besonders.
Im vergangenen Sommer haben wir ihre Geschichte erzählt, die von Todesangst, Flucht und Hoffnung handelte. Damals sprachen wir mit Mädchen und Jungen, die gerade der Kindheit entwachsen waren, 14, 15 Jahre alt:
Inzwischen sind aus ihnen fast Erwachsene geworden. Viel zu schnell. Was sind jetzt ihre Träume, wo die Fremde nicht mehr nur das vorläufige Ende einer Flucht ist, sondern seit mehr als einem Jahr ihr Zuhause?
Das SZ-Magazin hat einige Schülerinnen und Schüler der ehemaligen 9/21 noch einmal angeschrieben, angerufen oder auf Telegram erreicht: »Як у вас справи минулого року?« Oder auf Deutsch: »Wie ist es euch ergangen im vergangenen Jahr?« Ihre Antworten zeichnen das Bild einer Schicksalsgemeinschaft, die sich gerade neu findet und erfindet.
»Ich wohne noch in Wittmund. Das Jahr war ziemlich schwierig, ich war oft überfordert. Alles ist neu. Ich versuche zu lernen und keine Angst vor dem freien Sprechen zu haben«, schreibt Anna, 16, die vor mehr als einem Jahr nach Wittmund floh. Sie antwortet auf Deutsch. Sie ist eine offene junge Frau, die sich für die Gruppe ein wenig verantwortlich fühlt. Anschluss zu finden aber sei schwer. »Leider haben wir keine deutschen Freunde gefunden. In unserer Stadt leben viele Menschen aus verschiedenen Ländern wie Syrien und Libanon, und es ist viel einfacher, mit ihnen befreundet zu sein. Vielleicht weil sie auch Freunde suchen und die Deutschen nicht.«
Oleksandra aus Wittmund sagt es so: »Ich vermisse immer noch mein früheres Leben und muss oft an die Zeit vor dem Krieg denken. Hier ist alles völlig anders, aber ich versuche, mich hier wohl zu fühlen.« Immerhin: ihre große Schwester, die zunächst mit ihrem Freund in Mariupol geblieben war, ist inzwischen auch in Wittmund angekommen und lebt wieder mit der Familie zusammen. Die Sorge um sie hatte Oleksandra sehr beschäftigt.
Die Flucht war für viele mit einem Kulturschock verbunden – für die Gruppe, die nach Wittmund floh, sieht der Alltag nun so aus: Ein Schulweg vorbei an herausgeputzten Klinkerbauten und gestutzten Hecken. Eine winzige Fußgängerzone, ab zehn Uhr abends leere Gassen. Ihre Industriestadt am Schwarzen Meer, den Hafen, das Drama-Theater, wo sie sich früher trafen, vermissen sie alle.
Ihr Vater ist noch in der Ukraine. Kämpfen muss er nicht, aber das Land verlassen darf er auch nicht, wie die meisten Männer im wehrfähigen Alter. Die Trennung habe die Familie sehr stark getroffen.
Mischa kommt jetzt in die 10. Klasse am Wittmunder Gymnasium, bestreitet aber wie Anastassia und andere parallel noch die 11. Klasse seiner ehemaligen ukrainischen Schule per Online-Unterricht. Das Gymnasium ist kurz nach der russischen Besetzung Mariupols nach Kiew umgezogen und bietet allen Geflohenen weltweit nun seinen Unterricht digital an. Viele der Wittmunder Jugendlichen wollen parallel zu ihrem deutschen auch einen ukrainischen Abschluss machen. Als Bekenntnis zu einem Land, von dem sie alle überzeugt sind, dass es sie in der Zukunft brauchen wird. Und dass es noch existieren wird. Dafür wollen sie gerüstet sein.
Viktor, der in Halver, Nordrhein-Westfalen, untergekommen ist, schreibt: »Ich suche noch nach meinem Weg, aber ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Welt bietet so viele Chancen. Ich bin ehrgeizig, ich lerne Programmiersprachen, denn ich will etwas Großes erreichen. Wenn sich mein Traum erfüllt, will ich mithelfen, die Welt zum Besseren zu wenden.« Vor dem Krieg sind sie hier in der Ferne sicher, nicht aber vor den Debatten, die ihn begleiten.
»Mein Jahr hier war schwierig, weil es schwierig ist, sich dem Kreis anderer Menschen anzuschließen, die nicht so denken wie man selbst«, schreibt Anastassia. »Die Wittmunder sind meist sehr freundlich, es gibt aber auch Menschen, die vor langer Zeit aus Russland hierher gezogen sind und den Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützen.«
Beklagen aber will sich niemand. »Alles ist viel besser geworden als vor einem Jahr«, findet Mischa. »Ich habe meinen eigenen sozialen Kreis, der hauptsächlich aus Ukrainern besteht, die ebenfalls hier leben. Meine Eltern und mein jüngerer Bruder Ivan leben im benachbarten Wilhelmshaven. Sie sind Ende letzten Jahres dorthin gezogen, meine Eltern besuchen Deutschkurse, mein Bruder wird bald in die fünfte Klasse eines deutschen Gymnasiums gehen.«
Die ehemalige Mitschülerin Valeriia lebt nun in Warschau, Polen. Im Sommer 2022 erzählte sie: »Seit dem 23. Februar hatte ich keine richtige Schule mehr. Ich lebe jetzt in der Westukraine, gehe tagsüber mit Gleichaltrigen im Wald spazieren, ich versuche, schlechte Erinnerungen aus dem Kopf zu kriegen, dieses Leben im Keller, während oben die Bomben niedergingen. Aber ich will Mariupol auch nicht vergessen.« Ihre Eltern hatten sie bei Freunden in Jaremtsche untergebracht. Ihre Mutter arbeitete nach dem Kriegsbeginn zunächst weiter als Verkaufsleiterin für medizinisches Zubehör in Kiew, und der Vater blieb bei seiner Mutter in Mariupol, passte auf die Wohnung und das Auto auf. Inzwischen leben alle zusammen in Warschau, Valeriia besucht wieder eine Schule. Eine Entscheidung für die Zukunft, aber gegen die Ukraine.
Auch bei den anderen außerhalb der Wittmunder Gruppe ist eine Zukunft in der Ukraine eher aus dem Blickwinkel geraten. Sie planen anders. Vor einem Jahr sagte Oleksandra aus Aschaffenburg noch, sie könne sich ein Studium in Deutschland vorstellen. Oder in der Ukraine. Oder auf dem Mars. Alles war offen.
Nun hat Oleksandra die Schule, in die sie vor mehr als einem Jahr eingestiegen ist, wieder verlassen. Eine Gemeinschaft wie die Jugendlichen, die zusammen nach Wittmund kamen, habe ihr gefehlt, sagt sie. In Mariupol war sie Klassensprecherin gewesen. Ein Leben im Kreise der anderen in Niedersachsen hätte sie sich auch vorstellen können, aber ihre Mutter hatte Kontakte in Aschaffenburg, und so gingen sie dorthin. »Es fällt mir ein bisschen schwer zu sehen, wie meine liebe Gruppe ohne mich lebt, da ich immer noch gerne dabei wäre. Ich hoffe aber, dass wir unsere Abschlussfeier irgendwie in Deutschland feiern können und ich die Gelegenheit haben werde, dabei zu sein.«
In Aschaffenburg fühlte Oleksandra sich lange einsam. »Ich wollte erst keinen Kontakt zu den deutschen Mitschülern. Ich dachte, ich brauche das nicht, weil es sowieso niemals so wie in Mariupol wird. In meiner Klasse war keiner gegen mich, für mich aber erst auch keiner. Es war anderen meistens egal, wie es mir geht. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie gar nicht verstehen, was mir passiert ist. Sie waren nicht gemein, aber die Gleichgültigkeit hat mir auch wehgetan.« Oleksandra hat zwei Klassen in einem Schuljahr abgeschlossen. Sie war schon in Mariupol eine der Besten. Nun bereitet sie sich online am Studienkolleg Halle auf ein Hochschulstudium in Deutschland vor. Sie habe sich damit abgefunden, Mariupol, wenn überhaupt, nur noch zu besuchen, aber in Deutschland zu leben.
Viele Lebenspläne sind durch den Krieg zerstört worden. Andere müssen neu entworfen werden. Natalia Shelhunova, die ehemalige Klassenlehrerin der 9/21, kann in Wittmund nicht als Lehrerin arbeiten, obwohl sie fließend Deutsch spricht: Ihr ukrainisches Diplom für Deutsch als Fremdsprache wird nicht anerkannt. Jetzt studiert sie noch einmal, macht einen Anpassungslehrgang. Auch sie sieht ihre Zukunft in Deutschland – erst einmal.
Derzeit unterrichtet sie vormittags Schüler mit geringen Deutschkenntnissen. In ihrem Kurs sind Kinder aus der Ukraine, aber auch aus der Türkei, aus Syrien und aus Kolumbien. Nachmittags gibt sie einen Integrationskurs für die Eltern ihrer Deutschklasse. Ihre zehn ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die mit ihr nach Wittmund geflohen waren, nehmen längst am normalen Unterricht teil. Sie wurden allerdings noch nicht bewertet. Das wird sich im kommenden Schuljahr ändern. »Sie können gut mithalten«, sagt Shelhunova, »wenn sie wollen. Wer sich nicht zwingen kann, selbstständig zu arbeiten, der muss eben das Jahr wiederholen.«
Und überhaupt: Die Schulleistungen stünden für sie erst einmal nicht im Vordergrund. »Wenn man einen Krieg überlebt hat, sieht man die Dinge anders. Meine Schüler halten sich zusammen.« Dass diese in Wittmund lieber unter sich bleiben, sieht sie gelassen. »Wir dürfen nicht vergessen, dass es Jugendliche sind, die viel durchgemacht haben. Nachdem alles zerstört worden ist, hat es erstmal keine Ziele gegeben. Wir alle mussten uns erholen, unsere Stabilität wiederfinden.«
Shelhunova lebt mit ihrem Mann und ihrer 15-jährigen Tochter in Wittmund. Unter Lebensgefahr waren sie über den Umweg Russland aus dem eingekesselten Mariupol rausgekommen. Die wenigen Nachrichten von Bekannten, die sie heute aus ihrer Heimatstadt erreichen, sind dünn. Das Thema Krieg werde dabei gemieden. »Die Menschen haben Angst, frei zu sprechen, es geht nur ums Persönliche. Das Leben dort ist nicht leicht, keiner mag es sich noch schlimmer machen.«
Manches hat sich normalisiert. Veronika, die mit ihrer Familie in Sacramento (USA) lebt, hatte im vergangenen Jahr wortreich ihre noch sehr präsente Fluchtgeschichte geschildert. »Wir sind zunächst aufs Land geflüchtet, nahe Mariupol. So wie die meisten. Als wir Mitte April nach Mariupol zurückkehrten, waren die Russen da und haben uns gewaltsam nach Russland gebracht. Von dort aus begannen wir unsere Reise. Wir flogen nach Istanbul, dann nach Spanien, dann Kolumbien, Mexiko, und von dort sind wir zu Fuß über die Grenze nach Kalifornien. Ende April kamen wir hier an. Ich bin meinen Eltern so dankbar, dass wir jetzt sicher sind.«
Nun ist das Leben in Kalifornien in Fahrt gekommen. Auf die erneute Anfrage, ob sie noch immer mit ihrer Familie in Sacramento lebe, reagiert Veronika wie eine sehr normale 16-Jährige, die Besseres zu tun hat, mit: »Yea«. Und auf die Frage, ob das Leben leichter geworden sei in dem Jahr: »Yea«. Beide Eltern haben Arbeit, die Familie plant, dort zu bleiben. In der Schule komme sie gut mit, obwohl keine Förderklassen entstanden sind oder Extra-Englischunterricht angeboten wurde. Veronika nimmt seit dem ersten Tag am Unterricht der Muttersprachler teil und wird benotet.
Ihre Heimatstadt erscheint vielen Geflüchteten inzwischen wie eine Phantomstadt, die nur noch in der Erinnerung existiert. Die Bitterkeit darüber ist zu spüren, auch bei Victor in Halver: »Seit ich Mariupol verlassen musste, war ich nicht wieder dort. Nur meine Mutter und meine Großmutter gingen zurück, da mein Onkel, der Arzt war, an der Front gefallen war. Er hatte versucht, Leben zu retten, nicht Leben zu ruinieren, wie es Russland heute tut. Ich bin im ständigen Austausch mit Verwandten und Freunden per Telefon oder Chat, ich habe kein einziges Mal gute Nachrichten von ihnen gehört.«
Victor hat sich im vergangenen Jahr das Ruhrgebiet angeschaut, er war in Dortmund, Düsseldorf und Köln. Köln habe ihm am besten gefallen, dort besuchte er die Gedenkstätte im ehemaligen Gestapo-Gefängnis: »Ich habe alle Schrecken dieses Gefängnisses gespürt«, schreibt er. Und: »Ich bin so froh, dass meine Eltern mit mir nach Deutschland geflohen sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was ich ohne sie tun würde.« Natürlich verfolge er die Nachrichten von der Front und verstehe, dass viele Menschen mit dem Verlauf des Krieges unzufrieden seien. »Aber die Wahrheit ist, dass viele Kämpfer sterben müssen, um Fortschritte zu erzielen. Ich will das nicht, genau wie die Kommandanten, die unsere Truppen befehligen und niemanden verheizen wollen.«
Victor hofft, wie viele seiner Mitschüler und Mitschülerinnen, dass Mariupol irgendwann befreit wird.
Igor lebt alleine in Wittmund. Seine Eltern sind im Dorf Melekyne nahe Mariupol untergekommen. Ihre alte Wohnung im neunten Stock in Mariupol steht noch, aber der Aufzug funktioniert nicht mehr. Er und seine Familie halten Kontakt über Videotelefonie. Wenn sie sich treffen, dann in ukrainischen Nachbarländern.
Glaubt man Igor, ist das Leben in Mariupol und den besetzten Gebieten noch genauso wie vorher, nur dass es allen schlechter geht. Vor allem der Landwirtschaft. Nachrichten über die Kampfhandlungen verfolgt Igor schon lange nicht mehr.
Manches erfährt man ganz nebenbei, nicht aus langen Nachrichten oder Unterhaltungen, sondern aus der Sprache, in der einer antwortet. Veronika antwortet auf Englisch, manche antworten auf Deutsch, viele auf Ukrainisch, einer auf Russisch. Es ist Bohdan, inzwischen 16 Jahre alt. Er lebt in Mariupol.
»Hallo, ich wohne noch dort, wo ich immer gelebt habe. Die Stadt wird recht schnell gebaut, was sehr erfreulich ist. Meine Familie und ich haben uns fast das ganze Jahr über mit Dokumenten befasst und nun eine Entschädigung für den verursachten Schaden erhalten. Nach dem Krieg fühlt sich jeder Tag wie ein Feiertag an.« Für ihn ist der Krieg vorbei. Wenige Tage nach unserem Mail-Wechsel mit Bohdan berichtet die ukrainische Regierung aus einem Kreml-internen Papier, dass Russland 300.000 Bürger nach Mariupol umsiedeln wolle.
Die alte Heimat der Klasse 9/21 verändert sich. Eine neue Stadt entsteht. In Mariupol gilt der Krieg offiziell als vorüber, die Stadt nicht als besetzt, sondern befreit. Bohdan lebt zwischen den Realitäten. Denn, dass die allermeisten seiner ehemaligen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen den Krieg nicht als beendet ansehen, merkt er täglich: »Leider habe ich nur noch sehr wenige Freunde hier, keiner kehrte zurück. Ich habe die zehnte Klasse abgeschlossen, die elfte Klasse und die Abschlussprüfungen stehen noch bevor. Meine neue Schule ist jetzt russischsprachig, aber die Kinder können auf Wunsch Ukrainisch-Sprachkurse belegen.«
Natalia Shelhunova hat lange keinen Kontakt zu Bohdan in Mariupol gehabt. Nie würde sie über ihn urteilen, weil er sich mit den neuen Gegebenheiten arrangiert. »Die Leute müssen sich anpassen. Vielleicht hatte er keine andere Wahl. Für mich kam das nicht in Frage, deshalb sind wir weg.« In ihrer Heimat war sie seitdem nicht mehr, zu tief sitzt der Schmerz über den Verlust. »Sollte Mariupol jemals befreit werden«, sagt Shelhunova, »wird es eine andere Stadt sein. Nicht das Mariupol, in dem wir gelebt haben. In jedem Hinterhof ist ein Friedhof. Es liegen Menschen begraben, in den Rasenstücken zwischen den Alleen. Selbst kurz vor unserer Flucht wurden in einem Park in unserer Nachbarschaft Menschen begraben. Bis Mariupol wieder ukrainisch ist, sollten wir Geflüchtete unsere Zeit sinnvoll nutzen, egal wo wir gerade sind.«