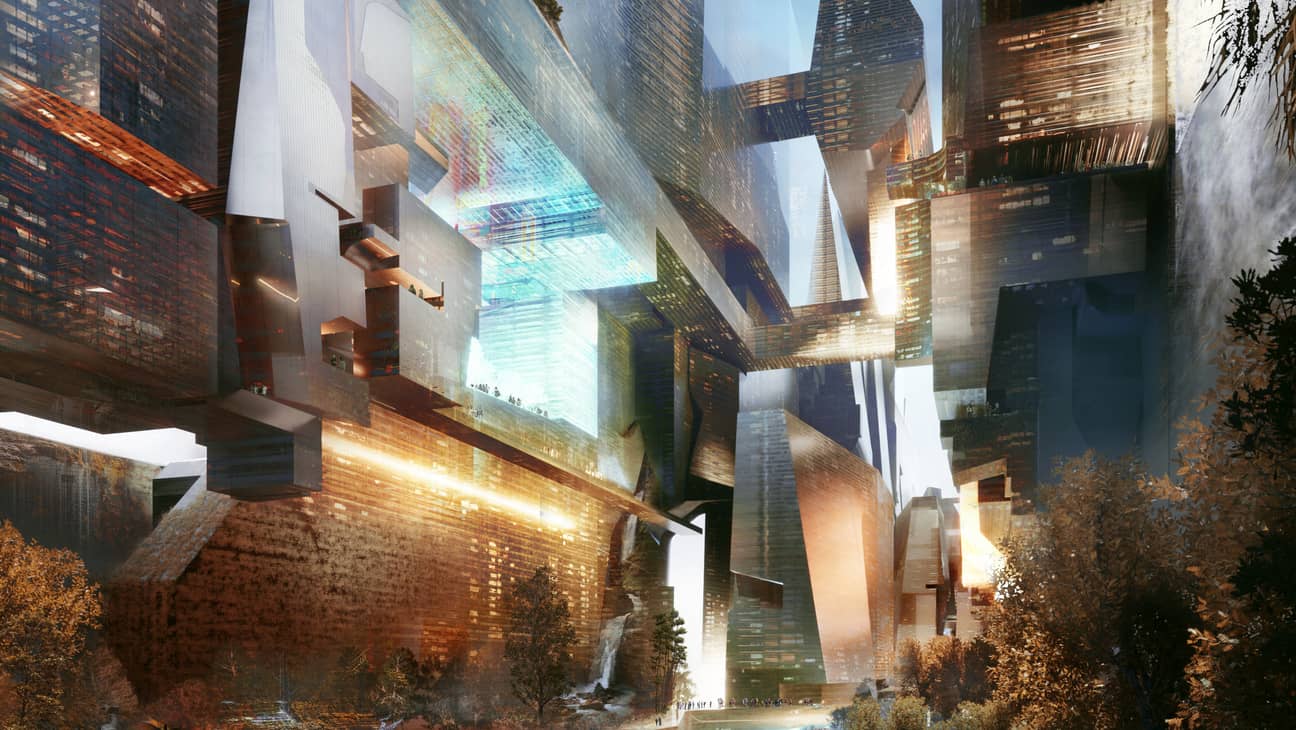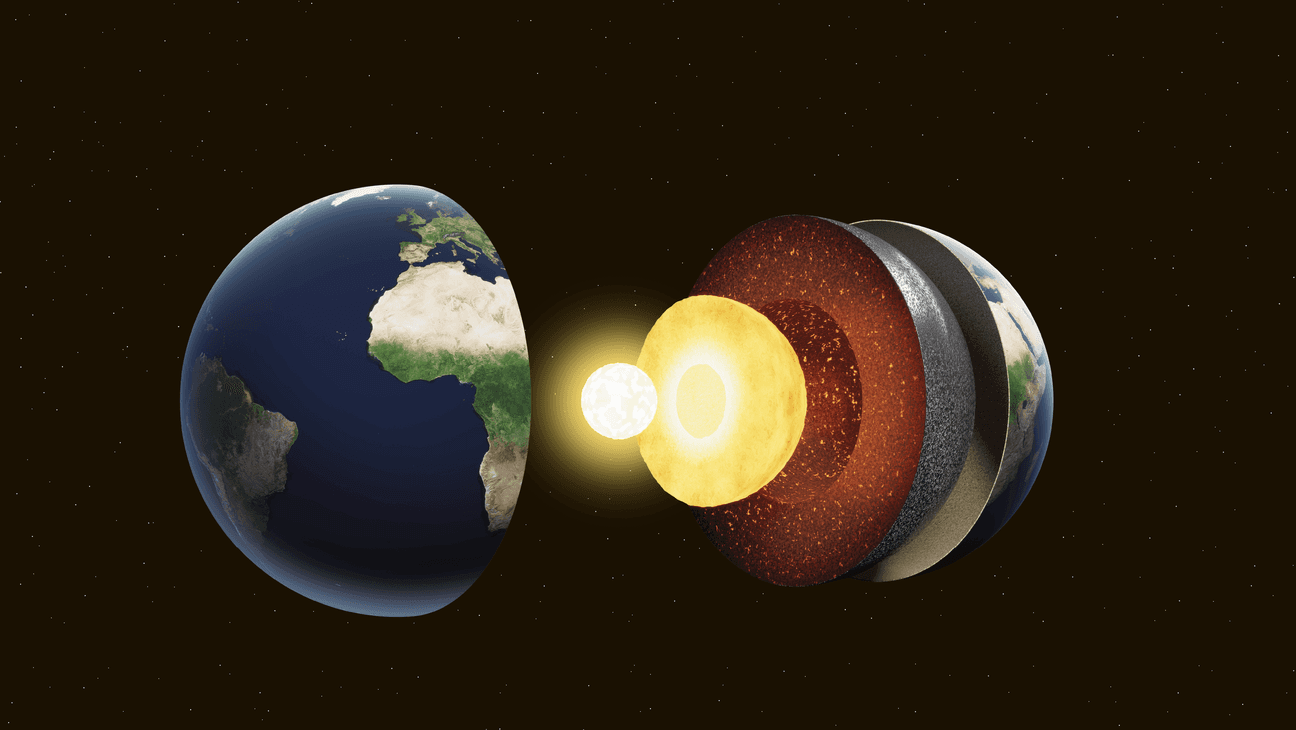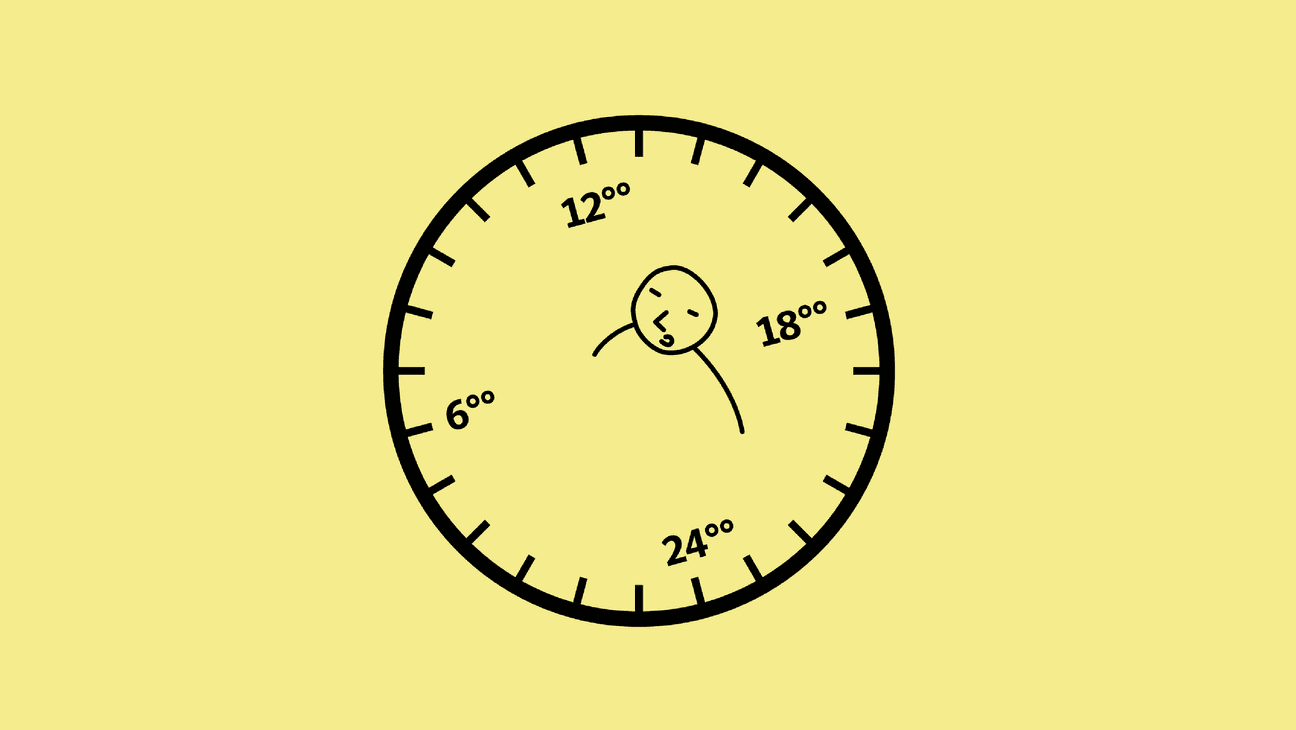Abriss von Stammheim
Die Knastfestung fällt
Vorschriftsmäßig blüht das Barock in der ehemaligen Residenzstadt Ludwigsburg, der Frühling kann da kaum mithalten. Weit und breit keine gefährlichere Waffe als der Laubbläser, mit dem eine Mitbürgerin auch noch das letzte im Sturm abgefallene Magnolienblütenblatt aus den Fugen ihrer vollverpflasterten Garageneinfahrt schießt. Da muss sich auch der Polizeistaat von seiner besten Seite zeigen: Die beiden Beamten (männl. u. weibl.) haben eine Frau vom Rad geholt, die sich damit widerrechtlich auf den Gehsteig gewagt hat. Aber die Konfrontation mit der Staatsmacht geht glimpflich ab, es gibt Schlimmeres.
Im Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg erinnern die Exponate an ganz andere Zeiten. Da steht die Guillotine, mit der noch 1949, wenige Tage vor Inkrafttreten des Grundgesetzes, ein Mann hingerichtet wurde. Hier werden auch etliche Kuriosa aus der Gefangenenwelt gezeigt wie zum Beispiel die Arbeiten, die der Häftling Jan-Carl Raspe heimlich verfertigt hat: Ein kleiner Pizzaofen auf Keksdosenbasis, vor den Wärtern, wo auch sonst, in einer „Illustrierten Geschichte der deutschen Revolution“ versteckt; ein Tauchsieder aus Filzschreibern; eine Alkohol-Destille aus Bordmitteln, nämlich dem Schlauch, der für die künstliche Ernährung der Gefangenen vorgesehen war, die in den Hungerstreik getreten waren.
Die Rote Armee Faktion (RAF) ist spätestens seit ihrer Auflösungserklärung von 1998 Geschichte und längst reif fürs Museum. Am heutigen Montag kommt noch mehr in die Asservatenkammer: Abgesandte des Strafvollzugsmuseums, vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart und vom Bonner Haus der Geschichte reisen nach Stammheim, um dort ein historisches Gebäude zu entrümpeln und die besten Stücke für sich herauszuholen.
Der Bau wurde aus Asbest, PCP und auch sonst jedem seinerzeit marktgängigen Giftmüll errichtet
Die Furcht vor den RAF-Terroristen, die im Mai 1972 in einer Serie von Bombenanschlägen US-Einrichtungen, Polizisten, Richter und den Springer-Verlag angegriffen und dabei vier Menschen ermordet und 74 zum Teil schwer verletzt hatten, war so groß, dass sie nach ihrer raschen Verhaftung in einem Hochsicherheitstrakt im Stuttgarter Gefängnis Stammheim isoliert werden mussten. Für den anstehenden Prozess wurde innerhalb weniger Monate aus Stahlbetonfertigteilen, Asbest, PCP und auch sonst jedem seinerzeit marktgängigen Giftmüll gleich neben dem Gefängnis ein Flachbau hochgezogen – bis heute im besten Technokratie-Deutsch „Mehrzweckgebäude“ genannt und behördlicherseits brav MZG abgekürzt – der zu einem keinem anderen Zweck gedacht war, als mit der terroristischen Bedrohung der Bundesrepublik kurzen Prozess zu machen.
Es wurde ein quälend langer Prozess, der längste vor dem NSU-Verfahren. Unendlich viel Zeit kosteten Verfahrensfragen, Beschwerden, Einsprüche, Befangenheitsanträge, Beratungen. Die Gefangenen traten mehrmals in den Hungerstreik, wurden krank oder von der Verhandlung ausgeschlossen. Das Verfahren sollte unbedingt revisionsfest geführt werden, was aber nicht gelingen konnte. Als die Angeklagten Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Raspe im Herbst 1977 Suizid begingen, waren sie zwar wie erwartet zu lebenslanger Haft verurteilt, doch hatten die Anwälte dieses Urteil bereits angefochten. Es wurde nie rechtskräftig.
Filme wie der reichlich agitatorische „Stammheim“ (1986) von Reinhard Hauff, in dem der junge Ulrich Tukur den auch nicht sehr alten Baader spielt, haben das Verfahren in diesem Bau als teilweise brutales Schreidrama überliefert. Sehr spät tauchten Tonbänder auf, auf denen eine getriebene Gudrun Ensslin zu hören ist, eine stotternde Ulrike Meinhof und ein Andreas Baader, der mit erstaunlich ruhiger Stimme und recht gelassen vorträgt.
Der Polizeistaat zeigte, was er konnte, und fuhr in Stammheim im Panzerspähwagen vor
Der Vorsitzende Richter Theodor Prinzing, bei Prozessbeginn am 21. Mai 1975 knapp fünfzig Jahre alt, war selbstverständlich im Zweiten Weltkrieg gewesen. Jahrzehnte nach dem Prozess, aus dem er nach 85 Befangenheitsanträgen unrühmlich ausgeschieden war, weil er unberechtigt Akten an die nächste Instanz weitergereicht hatte, die sie noch viel weniger berechtigt an den damaligen Chefredakteur der Welt weiterreichte, Jahrzehnte nach dem Tod der Angeklagten, schickte Prinzing seinem Prozessgegner Baader ein generationstypisches Kompliment hinterher: „Wenn er vor dem Krieg geboren worden wäre, dann wäre er ein ganz brauchbarer Soldat geworden.“
Das klang schon 2007 wie aus jeder Zeit gefallen, entsprach aber genau dem konfrontativen Denken der Siebzigerjahre. Die RAF hatte dem Staat den bewaffneten Kampf angesagt, der Staat nahm es als Kriegserklärung und rüstete auf. Der Polizeistaat zeigte, was er konnte, fuhr in Stammheim im Panzerspähwagen vor, unterm Arm baumelte die halbautomatische Waffe, Scheinwerfer machten die Nacht taghell, und über allem kreiste der Hubschrauber. Stammheim war das Symbol für Repression, eine Knastfestung mit angeschlossenem Gerichtssaal, betongewordene Staatsgewalt.
Das Gesetz verbietet aus guten Gründen den Prozess im Gefängnis, verhindert aber nicht die Prozessführung in einem Nebengebäude. Nicht zufällig war mit Anklängen an die Nazi-Justiz von „Sondergericht“ und „Sondergesetzen“ die Rede. Es war aber der Bundestag, der das Recht gebeugt hatte, der in Windeseile Sondergesetze zusammenstrickte, um die Rechte der Verteidiger und ihrer Mandanten nach Kräften einzuschränken. Otto Schily sprach vom „Stammheimer Landrecht“.
Damit die Gefangenen niemand zu sehen bekam, wurden sie die hundertfünfzig Meter zwischen Gefängnis und Gericht in einem VW-Bus transportiert und zur Sicherheit in die Vorführzange genommen. Weil Meinhof und Ensslin durch den Hungerstreik so dünn geworden waren, musste sie nachgebogen werden, um auch wirklich zu schließen. Der Kontakt nach draußen wurde, soweit er sich nicht ganz unterbinden ließ, streng überwacht. Angehörige, Rechtsanwälte und auch die Journalisten wurden leibesvisitiert. Der Gerichtsreporter Ulf Stuberger, der als einziger Journalist alle 192 Verhandlungstage wahrnahm, hat berichtet, dass eine Kollegin vor der untersuchenden Beamtin ihre Monatsbinde entfernen musste. Trotzdem gelangte Material in die Zellen, konnte Raspe mit Glühdrähten experimentieren, kamen schließlich Pistolen; nach dem Suizid der Gefangenen fanden sich unter der Bodenleiste sogar Dynamitstangen.
Der 90-jährige Otto Schily hat wenig Lust, über Stammheim zu sprechen, wo er zum Star wurde, er gibt aber dann doch ein kunstrichterliches und auch noch zutreffendes Urteil ab: „Sie sollen das ruhig abreißen, das Gebäude hat sowieso keinen guten Geist, und architektonisch ist es scheußlich.“
Der Eindruck beim letzten Rundgang durch das eben noch denkmalgeschützte Haus ist nicht viel besser. Es handelt sich um 1a-Gefängnisarchitektur: das ganze Haus wehrhaft nach außen und alles nach innen konzentriert, Büros, Besprechungszimmer, Überwachungsräume korallenartig um den Gerichtssaal angeordnet. Wie um wenigstens etwas Geist zu verbreiten, hat ein unbekannter Ausstatter überall Strafgesetzbücher ausgelegt. Es sollten die Richter sicher sein vor den Gefangenen, und die Gefangenen unter keinen Umständen herausgeholt werden können. Die RAF, das würde niemand vergessen, hatte 1970 mit der gewaltsamen Befreiung des Gefangenen Andreas Baader begonnen.
Der Gerichtssaal in der Mitte ist so irreal und realistisch zugleich wie eine Filmkulisse, auf eine Weise tot, wie das nur die damals modernste Architektur fertigbrachte. Die Hartschalenstühle sind in jenem Orange gehalten, das sich in den frühen Siebzigern vorübergehend die SPD zur Leitfarbe wählte, als sie versprach, das moderne Deutschland zu schaffen, und nebenbei für einen Abgrund an Brutalismus am Bau sorgte.
Es ist aber nicht alles tot, irgendwo oben am Dach und zwischen den Versorgungsleitungen tropft es. War das Gebäude doch nicht vollkommen sicher? Sonst ist es ruhig, kein Hubschrauber, der da kreiste.
In diesem Saal also, bei dem niemand das Wort Aura einfiele, saßen sich in der „Strafsache gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin wegen Mordes u.a.“ von 1975 an fast zwei Jahre lang Bundesstaatsanwaltschaft und Angeklagte gegenüber, wie auf einer römischen Trireme mit den drei übereinander gestaffelten Bänken: Vorne die Verteidiger, in der Mitte die Angeklagten, dahinter, für alle Fälle bereit, Polizisten. Hinter dem Richtertisch waren an die zweihundert Leitzordner mit Akten aufgereiht, darüber, in schlichtester Ausführung, das Hoheitszeichen von Baden-Württemberg, die drei schreitenden Löwen.
Hier war es, wo Ulrike Meinhof am 41. Verhandlungstag davon sprach, dass der Gefangene in der Isolation zu einer Gesinnungsänderung nur durch Verrat gelangen könne. Genau das sei „Folter“, sagte sie mit der schneidendsten Stimme und wiederholte, die Silben zerhackend, „das ist Folter, ex-akt Folter“. Der Richter Prinzing entzog ihr das Wort, Folter gab es in der Bundesrepublik nicht. Sieben Monate später erhängte sie sich.
Hier war es, wo der Zeuge Klaus Jünschke seinen Auftritt einige Wochen nach dem Tod Ulrike Meinhofs nutzte, um sich auf seine Art zu rächen. Jünschke hatte sich bereits eine zusätzliche Woche Ordnungshaft eingefangen, weil er die Richter als „dreckige Faschisten“ bezeichnet hatte, da sprang er plötzlich los, hechtete über den Richtertisch, warf den verblüfften Prinzing um und schrie, während er schon von seinem Opfer weggerissen wurde: „Für Ulrike, du Schwein!“ Dafür gab es keine Ordnungsstrafe mehr, aber bei seinem eigenen Verfahren im Jahr darauf floss dieses parajuristische Ereignis als Beleg für seine „von fanatischem Hass geprägte Einstellung gegen den Staat“ in die Urteilsbegründung und in das Urteil lebenslänglich mit ein.
Die Angeklagten von damals haben Stammheim nicht überlebt. Für sie wie für ihre Anwälte war der Saal im Mehrzweckgebäude eine Bühne, auf der sie vor der Presse und wenigen Zuschauern brillieren konnten. Einige Anwälte wurden durch den Prozess berühmt: Rupert von Plottnitz, der einmal „Heil, Dr. Prinzing!“ gerufen hatte, brachte es zum hessischen Justizminister. Hans-Christian Ströbele, im vergangenen Jahr gestorben, holte als Grünen-Abgeordneter seiner Partei regelmäßig das Berliner Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg. Schily wurde Mitgründer der Grünen, leitete den Flick-Untersuchungsausschuss und zeigte, inzwischen zur SPD gewechselt, als Innenminister in der Regierung Schröder ganz neue Qualitäten.
Wenigstens ein Jahr soll der Abriss des Mehrzweckgebäudes beanspruchen, schließlich sind nicht nur Schadstoffe zu entsorgen, es ist auch der Brutschutz der Vögel zu beachten. Ein bisschen unmenschlich ist es schon, dass man ihnen das Gemäuer wegnimmt, in dem sie sich ohne ästhetische oder politische Bedenken niedergelassen haben.