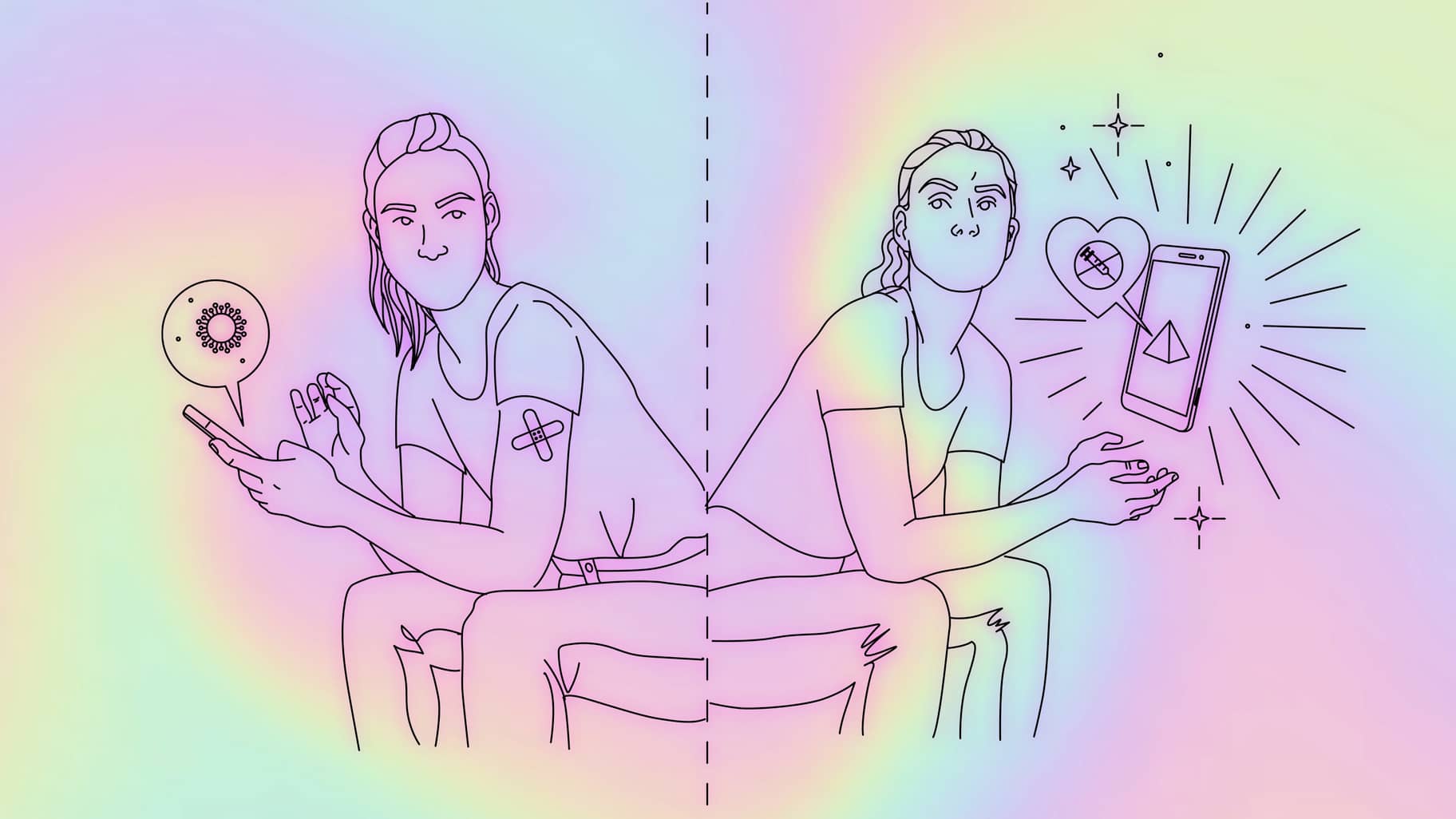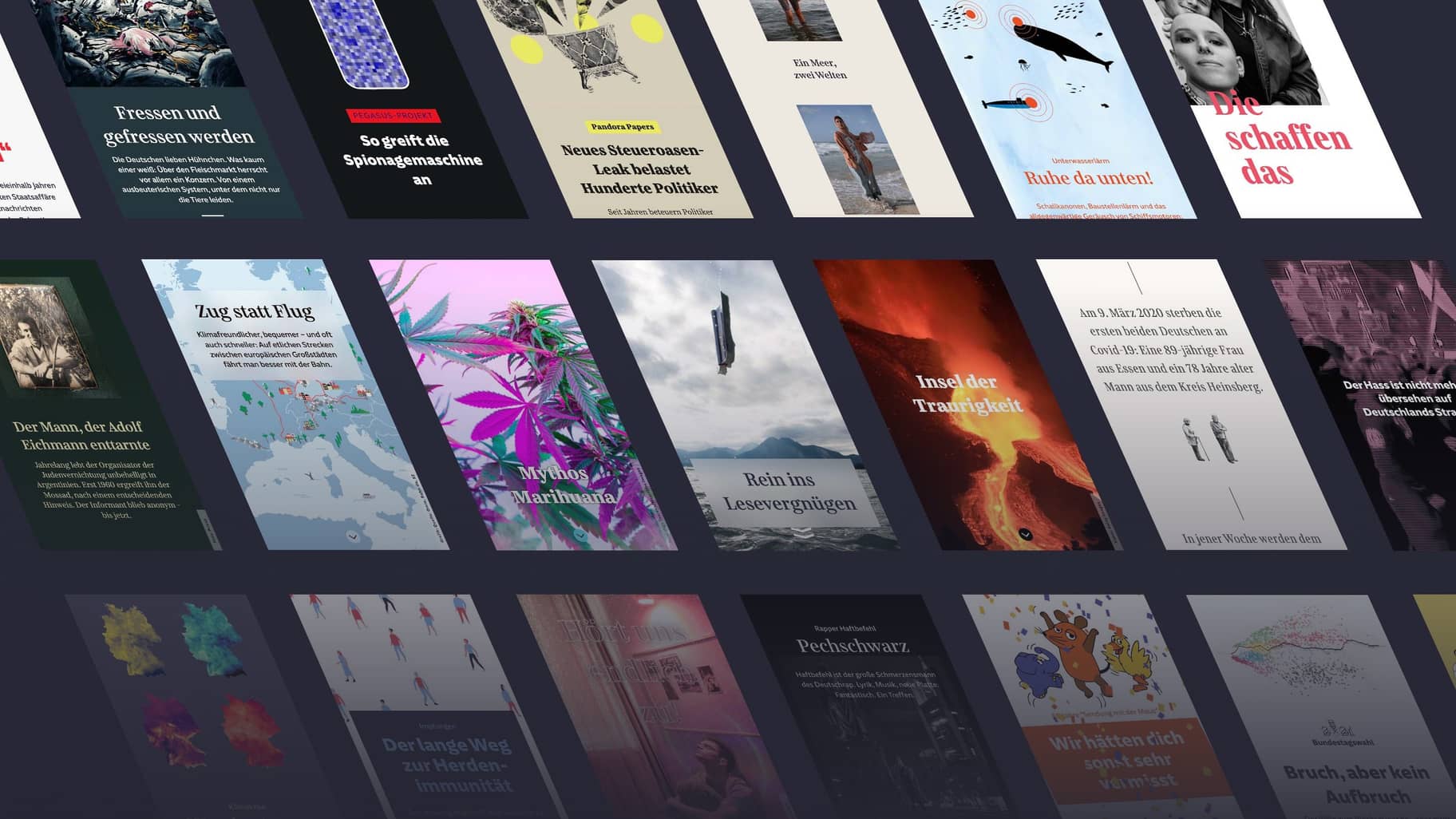Gemälde von der Intensivstation
Wollte man diese Pandemie in all ihrer Wucht auf einen einzigen Ort reduzieren, dann wäre das vielleicht der Arbeitsplatz von Simon Surjasentana: die Intensivstation im Krankenhaus.
Der Ort, an dem diejenigen sterben, die den Kampf gegen das Coronavirus verloren haben, und an dessen Auslastung in den vergangenen Monaten vermessen wurde, wie viel soziales Leben gerade noch möglich ist. Ein politischer Ort, Gegenstand vieler Debatten im Bundestag, für viele ein Angstort mit zu wenig Personal und abgezählten Betten.
In Öl verewigt er seine Kolleg:innen auf großformatigen Leinwänden, fast immer mindestens 1,60 Meter auf 1,80 Meter. „Dann ist man drinnen in dem Bild, man ist ein Teil davon, das ist mir wichtig“, sagt er.
Auf Simons Bildern sieht man Szenen, die man in den vergangenen Jahren tausendfach gesehen hat, in der Tagesschau und auf Instagram-Posts, auf Zeitungsseiten und in Youtube-Dokumentationen: Ärzt:innen, Pflegekräfte, Patient:innen. Masken, Kittel, Liegen. Man könnte meinen, sich an diese Szenen gewöhnt zu haben, doch die Ölbilder, die Simon in seinem Atelier in Weimar malt, transportieren eine Stimmung, die Fotografien selten eigen ist.

Seine Zeit teilt sich Simon zwischen Atelier und Station auf, am Wochenende ist er im Krankenhaus, unter der Woche malt er. Seit kurzem gibt er außerdem viele Interviews. Seine Gemälde treffen einen Zeitgeist, obwohl das nie so geplant war, seine Kunst nie politisch sein sollte. „Meine WG sieht mich kaum noch gerade, ich bin immer unterwegs“, sagt Simon, dunkle Haare, bordeauxfarbener Hoodie und gleichfarbige Mütze, im Video-Interview. Er sitzt in seinem WG-Zimmer, hinter ihm an der Wand hängen abstrakte Bilder. Vor einer Stunde habe eine Journalistin aus Bulgarien angefragt. Bulgarien! Er klingt fassungslos, als er das sagt. Aber ja, er freue sich. „Das ist sehr aufregend für mich, und surreal.“
Fühlt er sich in erster Linie als Pfleger oder als Künstler? Kurzes Schweigen. „In erster Linie würde ich mich als Künstler bezeichnen.“ Er beschreibt sich selbst als jemanden, der gerne herumalbert und oft verrückte Ideen hat, der auf der Station manchmal ein bisschen herausfalle. Wenn er spricht, sprudelt er. „Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne als Krankenpfleger, ich verbinde gerne beide Welten miteinander.“
Was eine malenswerte Szene ausmacht, fällt ihm schwer zu definieren, er entscheidet nach Gefühl. Eine Bewegung, ein ausgetauschter Blick, ein bestimmter Satz, all das kann ein Motiv ausmachen. „Mittlerweile störe ich keinen mehr. Meine Kollegen sehen mich gar nicht mehr, wenn ich fotografiere. Das war früher anders“, erzählt er.
Seine Kolleg:innen und Vorgesetzten zu fragen, ob er sie fotografieren und malen dürfe, kostete Simon, der sich selbst als eher schüchtern bezeichnet, zu Beginn Überwindung. Doch er hatte seinen Alltag auch schon vor der Pandemie gemalt. Ein Fotoprojekt an der Uni gab den Anstoß. Als er auf seinen Chef zuging und ihm ein paar seiner bisherigen Bilder vorlegte, waren alle neugierig – und begeistert.
Mittlerweile hängt im Krankenhausflur eine Auswahl der Gemälde und die Kolleg:innen scannen die Bilder auch darauf hin, ob und wie sie selbst darauf dargestellt werden. „Mal mich doch mal mehr!“, ist ein Satz, den Simon immer wieder hört.
Simon dachte viel darüber nach, sagt er. Und entschied sich dann für einen Mittelweg: „Ich achte immer darauf, dass man die Patienten nicht erkennt.“
Wenn man ihn fragt, wie er das eigentlich alles schafft, wird Simon ernst, spricht langsamer. „Ich konnte das alles noch nicht verarbeiten, und das ist bei den anderen Kollegen genauso. Ich bin gespannt, was noch mit uns passiert, wenn das dann alles wirklich mal vorbei ist.“
Während der ersten Monate der Pandemie arbeitete er Vollzeit im Krankenhaus und hatte weder Zeit noch Kraft zum Malen: „Ich konnte mein Team ja nicht alleine lassen, auch wenn ich in erster Linie Student bin.“ Zu Beginn des Lockdowns begann er mit Selbstporträts. „Ich habe mich mit mir beschäftigt und damit, wie es mir eigentlich so geht.“ Heraus kam eine Serie, die er unter anderem auf seinem Instagram-Kanal teilte.
Der Einstieg zurück in die Krankenhaus-Malerei fiel Simon schwer, das Thema schien omnipräsent. Doch nach dem ersten Versuch fühlte sich alles ganz natürlich an. Und als die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte zum Politikum wurde, als Menschen auf Balkonen klatschten, Politiker:innen Stollen in Krankenhäusern vorbeibrachten und Pfleger:innen für bessere Löhne demonstrierten, verewigte Simon in Öl, was während dieser Pandemie auf der Intensivstation los war und ist: Ärzt:innen und Pflegekräfte während einer Operation. Menschen, liegend auf Intensivbetten, umringt von Personal. Die Angestellten hinter Masken bei der Übergabe. Das Licht auf Station während des Nachtdienstes.
Die Bilder sind ein Stück Zeitgeschichte. Simon kennt die politische Dimension seiner Arbeit und will dennoch nicht, dass seine Malerei als politisches Zeichen missverstanden wird. „Ich habe meinen Alltag im Krankenhaus auch vor dem Beginn der Pandemie gemalt. Ich werde das auch nach dem Ende der Pandemie tun. Ich will mit meinen Bildern weder schockieren noch verharmlosen. Ich will das zeigen, was ich erlebe und sehe.“
Vor der ersten Vernissage war er aufgeregt, hatte Angst, seinen Freund:innen zu viel zuzumuten: zu viel Pandemie, zu viele Kittel, zu viel Intensivstation. Doch das Gegenteil war der Fall: Zur Vernissage kamen viele Menschen, seine Kolleg:innen und Kommiliton:innen diskutierten die Bilder miteinander. Dass seine Malerei so viele Menschen berührt, liegt wohl auch daran, dass Simon kein externer Beobachter ist.
„In den Bildern steckt ganz viel drin von mir“, sagt Simon. „Wie ich male, das ist auch ein langsamer Prozess, er entschleunigt das, was passiert ist. Und das ist Malerei. Sich Zeit nehmen für das Gesehene.“ Beeinflusst haben ihn unter anderem Edward Hopper und dessen Umgang mit dem Licht und der Berliner Maler Jonas Burgert, der in seinen Werken ganze Fantasiewelten erschafft.
Ist das Krankenhaus als Motiv für ihn jemals auserzählt? „Das ist mein Leben, mein Alltag, ich kann nicht aufhören, dort zu fotografieren und diese Szenen dann zu malen, zumindest nicht jetzt. Solange ich im Krankenhaus arbeite, wird das weitergehen“, sagt er. Und selbst, wenn er den Job als Pflegekraft irgendwann aufgeben sollte: Auf seinem Handy finden sich Zehntausende nicht gemalte Bilder, nicht erzählte Fotos, ein riesiger Fundus: „Ich habe noch so viel nicht gemalt.“